| Zurück |
Impressum
Datenschutz
(Hinweis: Es empfiehlt sich, den vorigen Aufsatz "Stammt der Mensch vom Affen ab oder der Affe vom Menschen?" zu lesen, um den hierauf folgenden Aufsatz zu verstehen.)
Körpermerkmale des sagenhaften Urmenschen
Es ist uns wahrscheinlich
geworden, daß der Mensch in vielen
wechselnden Gestalten immerhin so uralt sein kann, daß Sagengut
von ihm, wenn auch noch so zusammenhangslos, überliefert sein
könnte aus Zeiten, die wir nach der landläufigen Lehre zwar
als erd- und lebensgeschichtlich, nicht aber als
menschheitsgeschichtlich anzusehen hätten. Von der Art und
dem Weg der "Überlieferung" sei hier noch abgesehen. Ist
nach unserer Lehre der Mensch als Mensch so alt, wie wir es zu
begründen versuchten und es jetzt annehmen wollen, und sind Mythen
und Sagen vielfach oder vielleicht größtenteils
vorweltliches, wenn auch längst nicht mehr ursprüngliches und
vielfach entstelltes Wissensgut, dann dürfen wir auch zu dem
Versuch fortschreiten, den die vorausgehenden Abschnitte (s.
obigen. Hinweis!) einleiten sollten: aus den Sagen und Mythen
nun einmal ein Weltbild aufzubauen, wie es der vorweltliche Mensch um
sich und in sich gehabt haben könnte, seine Umwelt und seine
eigene Gestalt und Seele zu ermitteln, indem wir uns in die Mythen und
Sagen und Kosmogonien einfühlen, ihren Kern zu gewinnen streben
und sie naiv als naturhistorische Erzählungen nehmen. So
bekommen sie umgekehrt dokumentarischen Wert, indem wir ihre Inhalte
nach jenen Urzeiten hin ausbreiten.
Daß man den älteren
Menschen fossil noch nicht gefunden hat,
liegt vermutlich daran, daß er in Gebieten lebte, die heute
größtenteils verschwunden sind, wie etwa der große,
von Südafrika bis Madagaskar über Indien und Australien bis
in die polynesische Inselwelt hinein sich erstreckende
Gondwanakontinent oder -archipel (Fig
.1); oder daß andere Gebietsteile, die etwa noch den
Schauplatz seines Daseins bilden konnten, geologisch so gut wie nicht
erforscht sind.

Fig.1 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und
Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)
Schematische Skizze der Lage des Gondwanalandes zur Permzeit. Im Borden das asiatische Angoraland. Die heutigen Landgrenzen existieren noch nicht. (Original.)
Schematische Skizze der Lage des Gondwanalandes zur Permzeit. Im Borden das asiatische Angoraland. Die heutigen Landgrenzen existieren noch nicht. (Original.)
In dieser Hinsicht ist von der
dereinstigen gründlichen
Untersuchung gewisser afrikanisch-indisch-australischer oder
polynesischer Schichtsysteme des mesozoischen und
spätpaläozoischen Erdzeitalters besonders viel zu
erwarten. Wer also unseren Standpunkt vom hohen Alter des
Menschenstammes teilt, wird es nicht verwunderlich finden, wenn eines
Tages in solchen südlichen, dem alten Gondwanaland
angehörenden Landformationen Abdrücke von Fußspuren,
Skelettreste, Gegenstände, Gräber oder Baureste eines
vorweltlichen Menschenwesens gefunden werden. Daß aber
Menschenskelette und auch Gegenstände, selbst dort, wo der Mensch
einmal zahlreich und in hohem Kulturzustand gelebt hat,
äußerst selten erscheinen, zeigt nicht nur die allgemeine
Schwierigkeit, selbst in gut erhaltenen, vom Spätmenschen
bewohnten Höhlen solcher Reste habhaft zu werden, sondern auch die
Tatsache, aus dem hellsten Licht der Nahgeschichte, also etwa den
Franken, ja sogar den Menschen der verflossenen Jahrhunderte kann mehr
nennenswerte Reste im Boden finden, verglichen mit ihrer Zahl und
Kulturhöhe. Denn damit etwas fossil wird, sind so
außerordentlich günstige Umstände nötig, daß
man sie im allgemeinen nur im Flachmeer bei rascher Sedimentation
erwarten darf und auch nur in flachmeerverlassenen gehobenen Böden
aus der Vorwelt in ausgiebigerem Maße hat. Wenn auf dem
Land Sedimentationen mit reicherer Fossileinbettung vorkommen, dann
gehen solche Lage in ihrer Entstehung fast stets auf katastrophale
Ereignisse zurück, etwa auf Vulkanausbrüche, bei denen
ungeheure Staub- und Aschenmassen herunterkommen und in
kürzester Zeit alles bedecken, oder indem dabei entstehende
Schlammregen und Schlammströme rasch alles ersäufen und
eindecken; oder auf rasche Flußverlegungen mit großen Sand-
und Schlammtransporten; oder auf ein rasches Versinken von Tieren in
Sümpfen. Beispiele für das Erste ist aus
geschichtlicher Zeit die Verschüttung von Pompeji, wo wir
tatsächlich eine Menschenansiedelung wie fossil finden und die
Körperabdrücke der Menschen dazu. In den
nordamerikanischen Bridger beds
haben wir die Überreste einer jungtertiärzeitlichen Sumpf-
und Seenlandschaft mit reichem Tier- und Pflanzenleben, welche von
vulkanischen Tuffmassen überdeckt wurden, wahrscheinlich von
erstickenden Gasen und Dämpfen begleitet, welche die dort lebende
Welt mit einem Schlage töteten und alsbald unter Bedeckung fossil
werden ließen; und das nicht nur einmal, sondern mehrere
Male. In derartigen Schichtsystemen könnten wohl einmal
tertiärzeitliche Menschenspuren, wenn auch nur in Form von
Gebrauchswerkzeugen entdeckt werden. Die Pithecanthropusschichten
auf Java, in denen der seinerzeit vielberufene Rest des Affenmenschen
gefunden wurde, sind solche, später von Flüssen wieder
umgelagerte diluvialzeitliche vulkanische Aschen. Auch aus sehr
alter erdgeschichtlicher Zeit gibt es, insbesondere im Süden, wie
schon erwähnt, solche und ähnliche Ablagerungen, und es ist
deshalb nicht ausgeschlossen, daß wir gerade in terrestren
Schichtsystemen vorweltlichen Alters einmal einen glücklichen Fund
ältester Menschenformen oder ihrer Kulturreste machen werden, der
dann wahrscheinlich auf eine katastrophale Einlagerung zurückgehen
wird. Unterdessen müssen wir uns mit anderen Hinweisen
begnügen und aus den Sagen das entnehmen, was wir von
Körpermerkmalen urältester Menschenrassen überliefert
bekommen und es anatomisch wie entwicklungsgeschichtlich prüfen
und tunlichst klarstellen.
Schon im vorigen Abschnitt (s.
obigen Hinweis!) wurde
auf die von Klaatsch behandelte Tatsache hingewiesen, daß jene
alten Reptil- oder, was wahrscheinlicher ist, Amphibienfährten aus
dem mitteldeutschen Sandstein der Perm-Triaszeit sehr an embryonal
gestaltete menschliche Hände erinnern. Diese Handform steht
in Zusammenhang mit dem bis zu einem gewissen Grade aufrechten Gang
solcher Tiere und den opponierbaren Daumen. Das alles ist in
mesozoischer Zeit typisch entwickelt als Zeitcharakter, wie früher
schon gezeigt wurde. Von Menschen mit einem von den Späteren
abweichenden Charakter der Hand ist nun in den Sagen gelegentlich die
Rede. So heißt es in einer Überlieferung der Juden:
die Hände aller Menschenkinder vor Noah "waren noch ungestaltig
und wie geschlossen, und die Finger waren nicht getrennt
voneinander. Aber Noah ward geboren, und siehe, an seinen
Händen waren die Finger einzeln und jeder für sich" (1). Hierzu liefert das
babylonische Gilgameschepos eine auffallende Parallele (2). Da fährt
Gilgamesch, der Gottmensch, ins Totenreich zu seinem Ahn Utnapischtim,
bei dem er sich Rats über Leben und Tod erholen will. Und
als er mit dem Schiffe über das Meer kommt, steht Utnapischtim
drüben am Ufer und wundert sich über den Ankömmling:
Ut-napistim - nach der
Ferne hin schaut [sein Antlitz],
Er redet zu sich und [sagt] das Wort ....
"Warum .... fährt einer [im Schiffe], der nicht zu mir gehört(?)?
"Der da kommt, ist doch gar kein Mensch,
"Die Rechte eines Ma[nnes(?) hat er doch nicht].
"Ich blicke hin, aber nicht [verstehe ich es]."
Er redet zu sich und [sagt] das Wort ....
"Warum .... fährt einer [im Schiffe], der nicht zu mir gehört(?)?
"Der da kommt, ist doch gar kein Mensch,
"Die Rechte eines Ma[nnes(?) hat er doch nicht].
"Ich blicke hin, aber nicht [verstehe ich es]."
Hier wundert sich also der Ahn
über die Rechte - das ist doch ganz
offenkundig die Hand und nicht die rechte Seite - des Nachfahren.
Ohnehin scheinen sie sich im Anschluß an diese
Handverschiedenheit über ihre nicht ganz gleiche
Körpergestalt auseinandergesetzt zu haben. Denn abgesehen
davon, daß Utnapischtim schon beim Herannahen des Fremden den
Unterschied in der Hand bemerkt, müssen sie auch noch von ihrer
Unterschiedlichkeit gesprochen haben, mit dem Ergebnis:
Gilgames sagt zu ihm, zu
Ut-napistim, dem Fernen:
"Ich schau' dich an, Ut-napistim,
Deine Maße sind nicht anders, gerade wie ich bist auch du....."
"Ich schau' dich an, Ut-napistim,
Deine Maße sind nicht anders, gerade wie ich bist auch du....."
Wenn es nicht schon aus anderem
Zusammenhang klar wäre, daß
die dem Gilgamesch den Sintflutbericht übermittelnde Gestalt des
Utnapischtim nur der Ahne schlechthin ist, welchem die Erzählung
in den Mund gelegt wird, und daß umgekehrt auch Gilgamesch im
Mythos ein Anderer ist als der nachmalige babylonische historische
König, an dessen Namen man ehrend das Epos knüpfte, so ginge
auch aus der Bemerkung über die Hand und die Körpergestalt
hervor, daß der Utnapischtim des Totenreiches nicht deshalb der
biblische Noah ist, weil er die Sintflut erzählt, sondern
daß hier im Gegensatz zu der jüngeren Menschengestalt
überhaupt eine ältere über die von ihr erlebte Sintflut
berichtet. Die Heterogeneität des Gilgameschepos ist ja von
Greßmann schon dargetan; es ist darin, gleich Ilias und Odyssee,
Mythologisches und Junggeschichtliches,
Äußerlich-Historisches und Wesenhaft-Metaphysisches
verbunden, ja vielleicht vom späten Verfasser und Verwerter recht
unverstanden durcheinandergebracht. Hier ist nun klar, daß
Utnapischtim, der ja nach anderer Sage auch als fellbehaart gilt und
dieses Haar nach seiner Vertreibung aus dem Paradies verlor (3), eine ältere
Handform besaß; welche - das bleibt dahingestellt; und Gilgamesch
als der Spätere besitzt eine andersartige. Jedoch scheint
die Differenz nicht so groß gewesen zu sein, daß sich die
Gestalten nicht als gleichen Stammes erkannt hätten. Das
Totenreich, wo sie sich treffen und erkennen, ist ein transzendenter
Zustand, in dem Vergangenes nicht mit den äußeren Sinnen
wahrgenommen wird.
Wir haben es also bei
Utnapischtim mit einer uralten Menschengestalt zu
tun; er wird also nicht der Spätmensch mit der spreizbaren Hand,
sondern der ältere Typus mit embryonal verwachsenen Fingern
gewesen sein. Ob Gilgamesch selbst als jüngerer
Menschentypus die vollendet spreizbaren Finger schon hat, oder ob es
sich da um noch andere mögliche Zwischenstufen handelt,
läßt sich auf Grund der Sage nicht feststellen; aber so viel
mag festgehalten werden, daß wir uns in einem uralten Zeitkreis
damit befinden und daß die äußerlich verwachsene Hand
dem Zeitcharakter nach in den Gestaltungskreis des Mesozoikums
gehört, wo solche Verwachsungen einer vollkommen
fünffingerigen primitiven Extremität zwar bei Wassertieren,
aber auch in menschlich embryonaler Form bei jenen
Sandsteinfährten vorkommen. Später, wo erst mit Beginn
der Tertiärzeit die Säugetierentfaltung dem
Paläontologen deutlich sichtbar wird, ist die unreduzierte
fünffingerige Landextremität jedenfalls völlig
spreizbar. Wo sie äußerlich verwachsen ist, wie bei
manchen wasserbewohnenden Säugern, da ist sie entweder zugleich
reduziert und nicht mehr wie bei mesozoischen Wassertieren
vollzählig fünffingerig; oder sie gehört Formen an, die
man von Landsäugern ableiten muß, deren landbewohnende
Vorläufer auf mesozoische Herausbildung deuten, weil sie mit
Beginn der Tertiärzeit schon einseitig spezialisiert
dastehen.
Aus diesen, wenn auch geringen
Anhaltspunkten - bessere sehe ich
derzeit noch nicht - stelle ich die These auf, daß der die
Sintflut überdauernde Menschentypus mit der spreizbaren Hand
unserer Art mesozoisch ist und allerspätestens schon mit dem
Beginn der Tertiärzeit vollendet da war. Wir werden ihn im
Anschluß an die jüdische Überlieferung den "noachitischen Menschentypus"
nennen. Seine Großhirnentwicklung war wohl noch nicht so
hochspezialisiert wie die unsere und die des Diluvialmenschen.
Zu einem anderen bemerkenswerten Ausblick führt uns der Bericht über eine andere Menschenform, von der es heißt, daß sie ein Auge oben auf dem Schädel oder ein "Stirnauge" trug (9a).
Nirgends kann man deutlicher sehen, wie die völkische Ausgestaltung einer solchen Sage sich an Fossilfunde knüpfen kann, die in geschichtlicher Zeit gemacht wurden und dann zum Anlaß und zur Unterlage für eine Neuausgestaltung des uralten, urgeschichtlichen Kernes werden konnten. Abel hat so die homerische Ausgestaltung und Lokalisierung der Polyphemsage auf Reste des Zwergelefanten in sizilischen Höhlen zurückführen vermocht (4).
Polyphem ist der einäugige Riese mit dem großen Kyklopenauge auf der Stirn, der die schiffbrüchigen Genossen des herumirrenden Odysseus, die in seine Höhle eingedrungen waren, erschlägt und dann von dem schlauen Odysseus geblendet wird. "Nach der Vorstellung der homerischen Griechen", schreibt Abel, "hausten in Sizilien riesenhafte Menschen mit einem einzigen großen Auge auf der Mitte der Stirne. Warum gerade Sizilien als das Kyklopenland gegolten habe? In den unweit des Meeres liegenden Höhlen der Gegend um Messina und an vielen anderen Stellen, so bei Palermo und Trapani, finden sich auch heutigentags noch Skelettreste des eiszeitlichen Zwergelefanten. Man hat sie auch früher gefunden. Sieht man den Schädel eines solchen Zwergelefanten mit den Augen des Laien an, so fällt sofort das riesige Stirnloch auf (Fig. 2.).
Zu einem anderen bemerkenswerten Ausblick führt uns der Bericht über eine andere Menschenform, von der es heißt, daß sie ein Auge oben auf dem Schädel oder ein "Stirnauge" trug (9a).
Nirgends kann man deutlicher sehen, wie die völkische Ausgestaltung einer solchen Sage sich an Fossilfunde knüpfen kann, die in geschichtlicher Zeit gemacht wurden und dann zum Anlaß und zur Unterlage für eine Neuausgestaltung des uralten, urgeschichtlichen Kernes werden konnten. Abel hat so die homerische Ausgestaltung und Lokalisierung der Polyphemsage auf Reste des Zwergelefanten in sizilischen Höhlen zurückführen vermocht (4).
Polyphem ist der einäugige Riese mit dem großen Kyklopenauge auf der Stirn, der die schiffbrüchigen Genossen des herumirrenden Odysseus, die in seine Höhle eingedrungen waren, erschlägt und dann von dem schlauen Odysseus geblendet wird. "Nach der Vorstellung der homerischen Griechen", schreibt Abel, "hausten in Sizilien riesenhafte Menschen mit einem einzigen großen Auge auf der Mitte der Stirne. Warum gerade Sizilien als das Kyklopenland gegolten habe? In den unweit des Meeres liegenden Höhlen der Gegend um Messina und an vielen anderen Stellen, so bei Palermo und Trapani, finden sich auch heutigentags noch Skelettreste des eiszeitlichen Zwergelefanten. Man hat sie auch früher gefunden. Sieht man den Schädel eines solchen Zwergelefanten mit den Augen des Laien an, so fällt sofort das riesige Stirnloch auf (Fig. 2.).
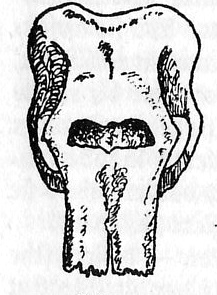
Fig.2 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und
Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)
Elefantenschädel mit der Nasenöffnung, ein Stirnauge vortäuschend. Stark verkl. (Aus O. Abel, Kultur der Gegenwart a. a. O. 1914)
Elefantenschädel mit der Nasenöffnung, ein Stirnauge vortäuschend. Stark verkl. (Aus O. Abel, Kultur der Gegenwart a. a. O. 1914)
Es ist die Nasenöffnung;
die Augen stehen seitlich am Schädel. Die homerischen
Irrfahrer kannten den Elefantenschädel als solchen nicht; die
gewölbte Form ließ auch einen Vergleich mit einem
Menschenschädel am ehesten zu, und daraus ergab sich die
Vorstellung riesenhafter stirnäugiger Wesen. Seefahrer der
homerischen oder vorhomerischen Zeit waren wohl die ersten, welche von
diesen Giganten Kunde in ihre Heimat gebracht haben. Sie konnten
in einer Strandhöhle Siziliens Schutz vor Unwetter gesucht und
beim Anzünden des Lagerfeuers einen aus dem Höhlenlehm
aufragenden Elefantenschädel erblickt haben. Alles andere
ist spätere Zutat. Eine Zeit, die geneigt war, überall
Götter und Göttersöhne zu sehen und überall
übernatürlichen Erscheinungen zu begegnen, formte aus diesem
Fund zuerst den lebendigen Riesen und zuletzt die ganze Sage von der
Bekämpfung und Überlistung des Ungetüms."
Ich will nicht leugnen,
daß die homerische Ausgestaltung der
Polyphemsage mit diesem Tatsachenbestand unmittelbar
zusammenhängt, und halte die Frage, soweit sie jenes
literarhistorische Problem betrifft, hiermit von Abel für
glücklich gelöst. Aber ich glaube nicht, daß er
damit dem Kern sehr nahe gekommen ist. Es muß schon stutzig
machen, daß die Nachricht vom stirnäugigen Riesen oder
Menschenwesen auch aus ganz anderen Kulturkreisen zu uns gedrungen ist,
worauf die Abelsche Erklärung nicht paßt.
Beispielsweise lesen wir in "1001 Nacht" von einem hohen Berg (5), auf dem eine große
Säule stand; darauf saß eine Statue aus schwarzem Stein, die
einen Menschen vorstellte mit zwei großen Flügeln, zwei
Händen wie die Tatzen eines Löwen, einem Haarschopf mitten
auf dem Kopf, zwei in die Länge gespaltenen Augen, und aus der
Stirne stach noch ein drittes häßliches dunkelrotes Auge
hervor wie das eines Luchses. Eine andere Stelle, die doch gar
keinen unmittelbaren literarischen und völkischen Zusammenhang mit
der homerischen und der arabischen Welt hat, kennt ebenfalls die
stirnäugige Menschengestalt: die nordischen
Volksmärchen.
"Eine Mutter war aus uraltem Geschlecht der Menschen, die nur ein Auge mitten auf der Stirn und eine Brust unter dem Kinn hatten" (6). Auch in dem urweltschwangeren Märchen von der Melusine kommt der Menschen- und Dämonensohn mit dem Stirnauge vor (7). Ferner zeigen die chinesischen Vasenornamente das Motiv in allen erdenklichen Abwandlungen wieder (Fig. 3.)
"Eine Mutter war aus uraltem Geschlecht der Menschen, die nur ein Auge mitten auf der Stirn und eine Brust unter dem Kinn hatten" (6). Auch in dem urweltschwangeren Märchen von der Melusine kommt der Menschen- und Dämonensohn mit dem Stirnauge vor (7). Ferner zeigen die chinesischen Vasenornamente das Motiv in allen erdenklichen Abwandlungen wieder (Fig. 3.)

Fig.3 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und
Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)
Das Stirnaugenmotiv in verschiedenen Abwandlungen als Ornament auf chinesischen Vasen.
(Aus dem chines. Bilderwerk Pokutulu.)
Das Stirnaugenmotiv in verschiedenen Abwandlungen als Ornament auf chinesischen Vasen.
(Aus dem chines. Bilderwerk Pokutulu.)
Das sind doch wohl zu weit
auseinanderliegende Zeugnisse, und das uns
darin entgegentretende Bild ist - einerlei wie es hier oder dort
allegorisch oder symbolisch verwertet und entstellt ist - so universell
gleichartig gerade inbezug auf dieses eine Organ, daß
demgegenüber die Abelsche Erklärung nicht mehr
ausreicht. Und dies um so weniger, als bei einer gemeinsamen
Quelle der Sage die Griechen sie doch eher aus dem östlichen Kreis
bekamen als daß sie selbst sie aus Sizilien aufgebracht und nach
Osten hinübergegeben hätten. Und überall hat man
auch nicht Fossilfunde wie die sizilischen Zwergelefanten oder die
paläozoisch-frühmesozoischen Amphibien- und
Reptilschädel gemacht, welche das Scheitel- oder Stirnauge trugen,
das rudimentär als Epiphyse oder Zirbeldrüse nicht nur bei
späteren Reptilien, sondern auch beim Menschen noch ein wichtiges
Gehirnorgan geblieben ist.
Es sei auf den vorigen
Abschnitt dieses Hauptteiles verwiesen, wo von
den für bestimmte Erdzeitalter charakteristischen und offenbar in
ihnen allein möglichen Organbildungen die Rede war.
Unter solchen wurde auch das Scheitelauge genannt, das bei niederen
Tieren, wie Krebsen, aber auch bei höheren, wie Fischen, Amphibien
und Reptilien, im paläozoischen Zeitalter voll entwickelt war und
im Mesozoikum fast nur noch von höheren Tieren, Amphibien und
Reptilien, getragen wurde, die aus dem paläozoischen Zeitalter
herüberkamen. Alle jüngeren Typen unter ihnen zeigen es
in stark rückgebildetem Zustand oder überhaupt nicht
mehr. Die Säugetiere hatten es vielleicht nur in
allerältester Zeit, später aber sicher nicht mehr. Die
Formen, die es haben, gehen also mit ihrem Typus bis in die letzte Zeit
der paläozoischen Epoche zurück. Beim Menschen nun
haben wir jenes von der Großhirnhemisphäre eingeschlossene
rudimentäre Organ, die Zirbeldrüse, welche in ihrer
Fortsetzung dem ehemaligen Scheitelauge entspricht, wenn man die
Entfaltung des Großhirns hintangehalten denkt. Man kann
sich vorstellen, daß durch die Entfaltung des Großhirns
jenes Organ unterdrückt und nach innen verlagert wurde und
daß es vermutlich ehemals teilweise an Stelle des Großhirns
funktioniert haben wird, wenn auch mit andersartiger
Tätigkeit. Die starke Gehirnentwicklung ist aber eine
für das Säugetier, namentlich für das bisher fast allein
bekannte Säugetier des Tertiärzeitalters, die wesentliche
Organbildung gegenüber den älteren amphibischen und
reptilhaften Typen der höheren Tierwelt.
Mit dieser Gehirnentwicklung aber hängt vielleicht die in der Sagenüberlieferung öfters ausdrücklich erwähnte Kleinheit der jüngeren Menschengestalt gegenüber der älteren zusammen. Denn in der neueren Medizin und Anatomie ist die Bedeutung der Zirbel des Menschen in ein Licht gerückt worden, das seinerseits auf diesen urgeschichtlichen Zusammenhang zurückstrahlt. Danach (8) ist sie eine Art Sinnesorgan, das wenigstens bei den Säugetieren nichts mehr von einer Sehfunktion besitzt. Bei Mißbildungen allerdings kommt sie gelegentlich als epizerebrales Auge noch zum Vorschein, was als Atavismus, d.h. als Rückschlag in die Ahnenform angesehen wird. Ihre derzeitige Bedeutung beim Menschen erstreckt sich aber auf Sekretausscheidungen für die Genitalsphäre, und sie ändert sich auch während der Schwangerschaft in Größe und Form. Sie sollen auch mit den sekundären Geschlechtscharakteren und auch mit der intellektuellen Reife zusammenhängen, welche erst mit beginnender Rückbildung der Zirbeldrüse einsetzt. Deren Zerstörung in einer frühen Lebensperiode führt zu körperlicher und geistiger Frühreife und gelegentlich auch zu Riesenwuchs. Bei noch nicht ausgewachsenen Tieren läßt sich nach operativer Entfernung des Organs ein völliger Stillstand des Wachstums erkennen, wie auch umgekehrt die Beseitigung der sexualen Keimdrüse eine Vergrößerung des Zirbelorgans nach sich zieht. Wir haben jedoch, wie die übrigen Säugetiere, noch eine andere Ausstülpung am Gehirndach, die sich zusammen mit der Zirbel anlegt, die Paraphyse. Beide Organe sind rückgebildet und haben früher Funktionen gehabt, die uns noch unbekannt sind. "Urväter Hausrat" schleppen wir mit ihnen herum, wie Gaupp es nannte, dem wir eine Darlegung über die Anlage dieser seltsamen Organe verdanken. Die Hypertrophie dieser Paraphyse führt beim jetzigen Menschen zu Funktionsstörungen oder zu Atrophie der Geschlechtszellen und dies angeblich wieder zu Riesenwuchs.
Mit dieser Gehirnentwicklung aber hängt vielleicht die in der Sagenüberlieferung öfters ausdrücklich erwähnte Kleinheit der jüngeren Menschengestalt gegenüber der älteren zusammen. Denn in der neueren Medizin und Anatomie ist die Bedeutung der Zirbel des Menschen in ein Licht gerückt worden, das seinerseits auf diesen urgeschichtlichen Zusammenhang zurückstrahlt. Danach (8) ist sie eine Art Sinnesorgan, das wenigstens bei den Säugetieren nichts mehr von einer Sehfunktion besitzt. Bei Mißbildungen allerdings kommt sie gelegentlich als epizerebrales Auge noch zum Vorschein, was als Atavismus, d.h. als Rückschlag in die Ahnenform angesehen wird. Ihre derzeitige Bedeutung beim Menschen erstreckt sich aber auf Sekretausscheidungen für die Genitalsphäre, und sie ändert sich auch während der Schwangerschaft in Größe und Form. Sie sollen auch mit den sekundären Geschlechtscharakteren und auch mit der intellektuellen Reife zusammenhängen, welche erst mit beginnender Rückbildung der Zirbeldrüse einsetzt. Deren Zerstörung in einer frühen Lebensperiode führt zu körperlicher und geistiger Frühreife und gelegentlich auch zu Riesenwuchs. Bei noch nicht ausgewachsenen Tieren läßt sich nach operativer Entfernung des Organs ein völliger Stillstand des Wachstums erkennen, wie auch umgekehrt die Beseitigung der sexualen Keimdrüse eine Vergrößerung des Zirbelorgans nach sich zieht. Wir haben jedoch, wie die übrigen Säugetiere, noch eine andere Ausstülpung am Gehirndach, die sich zusammen mit der Zirbel anlegt, die Paraphyse. Beide Organe sind rückgebildet und haben früher Funktionen gehabt, die uns noch unbekannt sind. "Urväter Hausrat" schleppen wir mit ihnen herum, wie Gaupp es nannte, dem wir eine Darlegung über die Anlage dieser seltsamen Organe verdanken. Die Hypertrophie dieser Paraphyse führt beim jetzigen Menschen zu Funktionsstörungen oder zu Atrophie der Geschlechtszellen und dies angeblich wieder zu Riesenwuchs.
Bei der schon einmal
erwähnten Brückenechse von Neuseeland,
jenem altertümlichen kleinen Reptil, das uns schon in der
Juraepoche begegnet und dessen Wurzel bis in das paläozoische
Zeitalter zurückreicht, ist jenes Parietalorgan noch ein richtiges
augenartiges Gebilde mit netzhautartiger innerer Auskleidung eines
Hohlraumes, der durch eine Linse nach vorne abgeschlossen ist und auch
sonst noch einige mit einem Auge übereinstimmende Einzelheiten
aufweist.

Fig.4 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und
Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)
Scheitelauge der neuseeländischen Brückenechse, unter einem dünnen Hautüberzug. (Nach B. Spencer aus O. Hertwig. Entwicklungsgeschichte 10. Aufl. 1915.) Vergr.
Scheitelauge der neuseeländischen Brückenechse, unter einem dünnen Hautüberzug. (Nach B. Spencer aus O. Hertwig. Entwicklungsgeschichte 10. Aufl. 1915.) Vergr.
Dies ist auch noch bei
Blindschleiche, Chamäleon und Eidechse der
Fall. Bei den Säugetieren wie beim Menschen dagegen ist das
Organ stark rückgebildet und rückwährend der embryonalen
Entwicklung immer mehr von außen nach innen.
Ursprünglich waren die beiden in Verbindung stehenden Organe
(Paraphyse und Zirbel) paarig und erscheinen so in ihren frühesten
erdgeschichtlichen Entwicklungsformen bei altpaläozoischen
Panzerfischen und einigen merostomen Krebsen. Aber schon bei den
Amphibien und Reptilien der Steinkohlen- und Permzeit erscheint
äußerlich nur noch das unpaare Scheitelorgan und ist als
solches für die in jener Zeit lebenden höheren Tiere
charakteristisch. Daß es dann später, nach seiner
Rückbildung, andere, besonders sexuale Funktionen übernahm,
ist eine bei rudimentären Organen gewöhnliche
Erscheinung. Interessant und wichtig ist, daß, wie gesagt,
auch das Längenwachstum der Knochen von Irritierungen der
Zirbeldrüse abhängig ist und daß ihre Sekrete das
Größenwachstum beeinflussen, ebenso wie die Entwicklung des
Intellektes; und dies ist umso auffallender, als uns die alten
"stirnäugigen" Menschen der Sage als Wesen von besonderer
Körpergröße und geringem Intellekt geschildert werden (9).
Haben wir also auch hier wieder
guten Grund, einer so alten und
vielseitig übermittelten und bei entsprechend vergleichender
Naturbetrachtung ein so bestimmtes, lebensmögliches Bild
liefernden Sage, wie der von den "Stirnäugigen",
menschheitsgeschichtlichen Wahrheitsgehalt zuzuerkennen, so verdanken
wir diesen Ausblick dem prinzipiellen Gegensatz zu einer Deutungsweise,
die von vornherein die Absicht hat, den realen naturhistorischen
Wahrheitsgehalt zu leugnen, wodurch sie stets zu Resultaten gelangt,
welche zwar scheinbar eine naturhafte Auslegung geben, aber sich
dennoch in ganz naturfremder Allegorisierung erschöpfen. So
heißt es über den Stirnäugigen in einer neueren
Mythologie: "Die späteren
Vorstellungen von den Kyklopen sind auf eigentümliche Weise
zugleich von der Dichtung der Odyssee und von dem alten Bilde der
Hesiodischen Feuerdämonen bestimmt worden, nur daß diese
jetzt auf vulkanische Gegenden der Erde übertragen werden, wo sie
fortan als Schmiede des Hephästos arbeiten. So besonders in
der Gegend am Ätna in Sizilien, welche die auffallendsten Merkmale
sowohl von poseidonischen als von vulkanischen Naturrevolutionen
aufzuweisen hatte... Dahingegen Polyphemos der Odyssee zuliebe
auch fernerhin in der Volkssage und Dichtung seine besondere Rolle
spielte...."
Wir haben gegenüber solchen Auslegungen immer wieder Anlaß, unserer bisherigen Betrachtungsweise vertrauend zu folgen und der alten Überlieferung vom stirnäugigen Menschenwesen naturgeschichtlichen Wert beizumessen und können bedingungsweise sagen: Wesen höherer Art mit einer geringen Großhirnentwicklung und einem vollentwickelten "Stirnauge" können nur jungpaläozoischer Herkunft sein und noch im Mesozoikum gelebt haben. Das Scheitel- und Stirnauge hat wahrscheinlich eine Funktion gehabt, womit es spätere intellektuelle Fähigkeiten auf andere, uns infolge der Rückbildung dieses Organs nicht mehr unmittelbar verständliche Weise zum Teil oder ganz ersetzte und hat daher wohl einem uns unbekannten Sinn oder einem anderen Zusammenhang der Sinne entsprochen. Mit der mesozoisch-tertiärzeitlichen Gehirnentwicklung des Menschenstammes ist dieses Organ und damit auch die ältere, körperlich wohl größere und daher vielleicht auch ein höheres individuelles Alter erreichende Menschengestalt verschwunden und hat dem noachitischen Gehirnmenschen mit spreizbaren Fingern und gewölbtem, völlig geschlossenem Schädel Platz gemacht. Wir nennen jenen älteren Menschentypus den "nachadamitischen" oder "vornoachitischen", weil wir ihn von dem jüngeren noachitischen, aber auch von einem noch älteren adamitischen und einem uradamitischen zu unterscheiden gedenken (10).
Wir haben gegenüber solchen Auslegungen immer wieder Anlaß, unserer bisherigen Betrachtungsweise vertrauend zu folgen und der alten Überlieferung vom stirnäugigen Menschenwesen naturgeschichtlichen Wert beizumessen und können bedingungsweise sagen: Wesen höherer Art mit einer geringen Großhirnentwicklung und einem vollentwickelten "Stirnauge" können nur jungpaläozoischer Herkunft sein und noch im Mesozoikum gelebt haben. Das Scheitel- und Stirnauge hat wahrscheinlich eine Funktion gehabt, womit es spätere intellektuelle Fähigkeiten auf andere, uns infolge der Rückbildung dieses Organs nicht mehr unmittelbar verständliche Weise zum Teil oder ganz ersetzte und hat daher wohl einem uns unbekannten Sinn oder einem anderen Zusammenhang der Sinne entsprochen. Mit der mesozoisch-tertiärzeitlichen Gehirnentwicklung des Menschenstammes ist dieses Organ und damit auch die ältere, körperlich wohl größere und daher vielleicht auch ein höheres individuelles Alter erreichende Menschengestalt verschwunden und hat dem noachitischen Gehirnmenschen mit spreizbaren Fingern und gewölbtem, völlig geschlossenem Schädel Platz gemacht. Wir nennen jenen älteren Menschentypus den "nachadamitischen" oder "vornoachitischen", weil wir ihn von dem jüngeren noachitischen, aber auch von einem noch älteren adamitischen und einem uradamitischen zu unterscheiden gedenken (10).
Nach diesen Feststellungen
tritt vielleicht eine figürliche
Darstellung in ein helleres Licht, die sich in der
mittelamerikanischen, in Dresden aufbewahrten Mayahandschrift (11) findet, woraus ein
bezeichnendes Feld nachstehend in einer Reihe mit zur Abbildung
gebracht ist (Fig. 5b).

Fig.5 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und
Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)
Dreigeteiltes Bildfeld aus der Dresdener Mayahandschrift. (Die welligen Schraffierungen sind Wasser, die schwarzen Punkte und Linien deuten wohl auf das Totenreich.)
Dreigeteiltes Bildfeld aus der Dresdener Mayahandschrift. (Die welligen Schraffierungen sind Wasser, die schwarzen Punkte und Linien deuten wohl auf das Totenreich.)
Die Geschichte der Mayas, wie
auch der Sinn jener viele Blätter
umfassenden Bilderschrift und ihrer Hieroglyphen liegt noch sehr im
Dunkeln. In dem bezeichneten Bildfeld fahren zwei menschenhafte
Wesen ganz verschiedener Gestalt über das Wasser. Die
hintere, dämonenhaftere Gestalt rudert, die vordere menschenhafte,
weiblich dargestellte macht eine Geste des verwunderten oder
überraschten oder beobachtenden Schauens. Bewegung und
Charakter des Ruderers hat entschieden etwas Aktivieres, auch
Brutaleres im Gegensatz zu Haltung und Gestalt des Menschen, der
vergeistigt aussieht; die hintere Gestalt hat etwas fratzenhaft
Dämonisches, die vordere etwas kultiviert Menschliches. Was
besonders auffällt, ist die Andeutung eines Stirnauges beim
Rudererdämon und das, daß seine Hand plump ist, einen sehr
großen opponierbaren Daumen, wie ein mesozoischer Iguanodon, und
wieder die verwachsene, embryonalhaft anmutende Fläche hat.
Sobald wir das Bild so sehen und uns an das erinnern, was wir über
den Urmenschen fanden, gibt es vielleicht für dieses Feld eine
gewisse Deutungsmöglichkeit. Entweder gehört es zu
einer symbolischen Erzählung über die Stammesfolge des
Menschen, worin der stirnäugige, dämonischer veranlagte Typus
mit dem größeren brutaleren Körper und den verwachsenen
Fingern eine Rolle spielt gegenüber dem noachitischen Typus mit
der vollendeten Hand und dem jetztmenschlichen Antlitz; oder es ist gar
eine ähnliche Erzählung wie die vom babylonischen Gilgamesch,
der mit dem Schiffer und Stammesgenossen seines Ahns über das Meer
oder in das Totenreich fährt und dort Visionen hat, wie das
unmittelbar links folgende Bild (Fig. 5a) anzudeuten scheint; also
vielleicht ein uralter, zu junger Zeit in Bildern- und
Hieroglyphenschrift wiedergebrachter Bericht, daß - sie fahren
von Osten her - einst ein Menschenwesen mit der "sonderbaren Rechten"
über das Meer oder in das Totenreich gefahren kam; also vielleicht
im Grund dasselbe, was uns im Gilgameschepos hinter einem verwirrten
Schleier und symbolisch, aber unverkennbar doch wieder auf
Urhistorischem fußend, übermittelt wird, nur hier vom
Westufer des Atlantischen Ozeans statt vom Ostufer aus gesehen und noch
einmal überliefert? Auch auf die Ähnlichkeit der Hand
eines anderen Dämonen (Fig. 6) mit einer Embryonalhand,
außerdem auch mit den paläozoisch-mesozoischen
Sandsteinfährten sei hingewiesen.

Fig.6 (Bildquelle/-text: Buch "Urwelt, Sage und
Menschheit" v. Edgar Dacqué, 8. Aufl. 1938, R. Oldenbourg)
Dämon aus der Dresdener Mayahandschrift ist mit verwachsener embryonaler Hand.
Dämon aus der Dresdener Mayahandschrift ist mit verwachsener embryonaler Hand.
Besaß nun, um zum Typus
des nachadamitischen stirnäugigen
Urmenschen zurückzukehren, dieser gleich der höheren Tierwelt
um ihn herum jenes merkwürdige Sinnesorgan, so ergibt sich daraus
auch ein Rückschluß auf die Gestaltung seines Hauptes: es
muß einer hochgewölbten Schädelkapsel zur Aufnahme
eines Großhirns entbehrt und statt dessen eine zugespitzte oder
rasch nach rückwärts laufende Form, keine abgesetzte, also
eine flache, liegende Stirn gehabt haben oder nur ein hocherhobenes
Hinterhaupt, wo das noch wesentlich kleinere Großhirn mehr
hintenoben lag und auf welcher das Parietalauge dominierte. So
werden uns mancherorts diese Menschen auch in der Sage geschildert; und
vielleicht deutet auch die indianische Sitte, den Köpfen durch
Einschnüren zwischen Brettchen von Jugend auf unter
Zurückdrängung der Großhirnkapsel jene spitze Form zu
verleihen, auf ein traditionelles Wissen um jenes uralte Organ, oder
hat zum unbewußten Ziel die Wiederfreilegung des Rudimentes, um
so einen Anreiz zu seiner Wiederentfaltung zu geben und sich
schließlich wieder in den Besitz jener alten Wirksamkeit zu
setzen.
Dieser Auffassung kommt eine Sage zu Hilfe, die in dem Bibelbuch jener zentralamerikanischen Quiche-Indianer steht (12). Dort wird von der Erschaffung schöner und vollendeter Menschen nach der Sintflut erzählt. Aber da sie so vollkommen waren, fürchteten die Götter, daß sie ihnen gleich werden wollten. Daher schwächten sie die körperliche Sehkraft der Neugeschaffenen. So sank ihr Wissen und ihr Erkenntnisvermögen; sie konnten nur mehr das in der Nähe Befindliche sehen, während ihre Blicke früher in unermeßliche Ferne geschweift waren.
Dieser Auffassung kommt eine Sage zu Hilfe, die in dem Bibelbuch jener zentralamerikanischen Quiche-Indianer steht (12). Dort wird von der Erschaffung schöner und vollendeter Menschen nach der Sintflut erzählt. Aber da sie so vollkommen waren, fürchteten die Götter, daß sie ihnen gleich werden wollten. Daher schwächten sie die körperliche Sehkraft der Neugeschaffenen. So sank ihr Wissen und ihr Erkenntnisvermögen; sie konnten nur mehr das in der Nähe Befindliche sehen, während ihre Blicke früher in unermeßliche Ferne geschweift waren.
Daß der spätere
noachitische Mensch, der das
mesozoisch-tertiäre Säugetier im Menschen repräsentiert,
wie alle Gattungen, nicht an einem einzigen örtlichen und
stammesgeschichtlichen Punkt seinen Ausgang nahm, sondern jedenfalls
aus vorher schon typenhaft verschiedenen Spezialzweigen des
Gesamtmenschenstammes entsprang, ist aus allgemein
entwicklungsgeschichtlichen Erfahrungen über das Werden der Formen
sehr wahrscheinlich. Übrigens nimmt man auch für den
Diluvialmenschen eine vielstämmige Entstehung an. Auch
hierfür bieten uns die Sagen, wenn wir ihnen folgen wollen,
allerhand Anhaltspunkte. So ist es nicht unmöglich,
daß unter den frühtertiärzeitlichen Menschenwesen,
deren vollendetster Typus wohl der noachitische war, auch solche mit
sehr tierischen Eigenschaften des Körperbaues sich noch
befanden. Hierfür sei nur auf eine Sage der
Fidschi-Insulaner verwiesen, wonach die Geretteten der Sintflut nur
acht Stämme betrugen; zwei gingen zugrunde und von denen bestand
der eine nur aus Weibern, der anderes aus Menschen mit einer Art
Hundeschwanz (13). Der
Hunde- oder Affenschwanz kehrt ja mancherorts in der Überlieferung
wieder. Und wenn er auch späterhin vielfach zur Verspottung
oder zu allegorischen Fabelgeschichten benützt wurde, so klingt
doch die uralte Bedeutung durch, was umso wichtiger erscheint, als ja
der jetzige Mensch am Ende der Wirbelsäule das deutliche Rudiment
eines Schwanzes hat.
Der noachitische Mensch hat die große Sintflut erlebt. Daß danach noch niedere, auf die schon höher entwickelten noachitischen Menschen wie tierisch wirkende Gestalten sich fortplanzten und allmählich menschenhafter wurden, schimmert gerade noch in einer Indianersage durch, wo es heißt, nach der Flut sei die Erde durch Verwandlung der Tiere in Menschen wieder bevölkert worden (14).
Wer weiß, was alles an Menschentypen und Menschenarten und -abarten in den erdgeschichtlichen Jahrmillionen durch die Welt gegangen ist. Ich glaube, wir können uns die Völker gar nicht mannigfaltig genug vorstellen. Ebenso wie die Säugetiere der Tertiärzeit in vielen grundverschiedenen Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten lebten und verhältnismäßig rasch kamen und gingen, dabei hervorkamen aus Stammlinien und Typen, die wir bis jetzt nicht imstande sind, genetisch miteinander zu verbinden, so mag es auch mit der Verschiedenartigkeit der Menschenstämme und -typen gewesen sein. Und so gibt es auch Platz, die vielen Sagen und Vorstellungsbilder von Menschen mit Vogelgesichtern oder Hundsköpfen, von kentaurischen oder faunischen, oder von ebenmäßigen Körpern mit sylvenhafter Zartheit und Schönheit reden zu lassen und ihnen naturhistorischen Sinn abzugewinnen. Es soll dies aber nicht dahin mißverstanden werden, daß etwa Faunen und Kentauren oder Riesen und Zwerge selbst wirkliche Menschenwesen in ihrem sagenhaften Abbild seien; vielmehr sind solche Gestalten vom Menschen erkannte Wesenheiten, die dem ursprünglichen naturverbundenen Menschen eben jene unmittelbar geschauten Wirklichkeiten waren, die wir Naturkräfte nennen, die aber lebendig wesenhaft erschienen und erscheinen mußten jenen Menschen, die mit einer entsprechenden, natursichtigen Seele begabt waren.
Der noachitische Mensch hat die große Sintflut erlebt. Daß danach noch niedere, auf die schon höher entwickelten noachitischen Menschen wie tierisch wirkende Gestalten sich fortplanzten und allmählich menschenhafter wurden, schimmert gerade noch in einer Indianersage durch, wo es heißt, nach der Flut sei die Erde durch Verwandlung der Tiere in Menschen wieder bevölkert worden (14).
Wer weiß, was alles an Menschentypen und Menschenarten und -abarten in den erdgeschichtlichen Jahrmillionen durch die Welt gegangen ist. Ich glaube, wir können uns die Völker gar nicht mannigfaltig genug vorstellen. Ebenso wie die Säugetiere der Tertiärzeit in vielen grundverschiedenen Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten lebten und verhältnismäßig rasch kamen und gingen, dabei hervorkamen aus Stammlinien und Typen, die wir bis jetzt nicht imstande sind, genetisch miteinander zu verbinden, so mag es auch mit der Verschiedenartigkeit der Menschenstämme und -typen gewesen sein. Und so gibt es auch Platz, die vielen Sagen und Vorstellungsbilder von Menschen mit Vogelgesichtern oder Hundsköpfen, von kentaurischen oder faunischen, oder von ebenmäßigen Körpern mit sylvenhafter Zartheit und Schönheit reden zu lassen und ihnen naturhistorischen Sinn abzugewinnen. Es soll dies aber nicht dahin mißverstanden werden, daß etwa Faunen und Kentauren oder Riesen und Zwerge selbst wirkliche Menschenwesen in ihrem sagenhaften Abbild seien; vielmehr sind solche Gestalten vom Menschen erkannte Wesenheiten, die dem ursprünglichen naturverbundenen Menschen eben jene unmittelbar geschauten Wirklichkeiten waren, die wir Naturkräfte nennen, die aber lebendig wesenhaft erschienen und erscheinen mußten jenen Menschen, die mit einer entsprechenden, natursichtigen Seele begabt waren.
Abgesehen von der allgemein
bekannten und hier nicht zu wiederholenden
biblischen Überlieferung, daß sich nach der
Sintflutkatastrophe die noachitischen Menschensöhne über die
Erde als verschiedene neue Grundrassen ausgebreitet haben, liefert uns
die Sagengeschichte noch zwei markante Erzählungen, die zwar nicht
im Wortlaut, wohl aber im Sinn ziemlich gleich sein dürften, zumal
die eine die andere wertvoll ergänzt und beleuchtet. Es ist
die griechische Überlieferung vom noachitischen Deukalion und die
babylonische vom wilden Gebirgsmenschen Engidu. Es sind neue
Rassen. Wenig rein und offenbar aus dritter und vierter Hand
übernommen, tritt uns in der griechischen und ovidischen
Überlieferung der Sintflutsage ein Anklang entgegen daran,
daß ein nachsintflutlicher Menschenstamm aus dem rauhen Gebirge
als seiner ursprünglichen Heimat gekommen ist. Man hat ja
oft überlegt, was es heißt, daß Deukalion mit seinem
Weib Pyrrha Steine hinter sich wirft und dadurch neue Menschen
erzeugt. Erinnern wir uns, daß hier eine symbolische und
von der Spätzeit, die es überlieferte, nicht mehr verstandene
Sprache ertönt und daß es in älterer vorovidischer
Überlieferung nicht heißt: sie warfen Steine hinter sich,
sondern: sie warfen das Gestein des Gebirges hinter sich (15), also mit anderen Worten: sie
ließen die Felsen des Gebirges hinter sich, woher sie gekommen
waren. Vergleichen wir nun hiermit die im Gilgameschepos viel
klarer und naturhafter berichtete Sage vom Hereindringen einer jungen
wilden, eben erst geschaffenen Rasse aus dem Gebirge, wo sie sich noch
herumtummelt mit dem Vieh, kulturlos lebend, und dann in den alten
Kulturkreis des Gilgamesch eindringt. Im weiteren Verlauf ist mit
dieser unverkennbaren Parallele wieder eine Art Vertreibung aus dem
Paradies naturhafter Unschuld verbunden, wie sie in der Bibel dem
Adamiten zugeschrieben wird, so daß hier, wie gesagt, die Stoffe
durcheinandergewoben zu sein scheinen. Der Inhalt (16) der wichtigen Zeilen ist, mit
einigen Auslassungen, folgender:
Als Aruru dieses
hörte,
Schuf sie in ihrem Herzen ein Ebenbild (?) Anu's;....
Lehm kniff sie ab, spie (?) darauf ....
Schuf einen Helden, einen erhabenen Sproß.....
[Bedeckt] (?) mit Haar war sein großer Körper.....
Er wußte nichts von Land und Leuten;
Mit Kleidung war er bekleidet....
Mit den Gazellen ißt er Kräuter,
Mit dem Vieh versorgt er sich an der Tränke,
Mit dem Gewimmel des Wassers ist wohlgemut sein Herz.
Einem Jäger ... stellte er sich entgegen .....
[Es s]ah ihn der Jäger, da ward sein Antlitz verstört .... er schrie:
"[Mein] Vater, [ein] Mann, der gekommen [ist vom Gebirge],
[Im Lande] ist stark [seine] Kraft ......
Er geht einher auf dem Gebirge b[eständig (?)]....."
Schuf sie in ihrem Herzen ein Ebenbild (?) Anu's;....
Lehm kniff sie ab, spie (?) darauf ....
Schuf einen Helden, einen erhabenen Sproß.....
[Bedeckt] (?) mit Haar war sein großer Körper.....
Er wußte nichts von Land und Leuten;
Mit Kleidung war er bekleidet....
Mit den Gazellen ißt er Kräuter,
Mit dem Vieh versorgt er sich an der Tränke,
Mit dem Gewimmel des Wassers ist wohlgemut sein Herz.
Einem Jäger ... stellte er sich entgegen .....
[Es s]ah ihn der Jäger, da ward sein Antlitz verstört .... er schrie:
"[Mein] Vater, [ein] Mann, der gekommen [ist vom Gebirge],
[Im Lande] ist stark [seine] Kraft ......
Er geht einher auf dem Gebirge b[eständig (?)]....."
Es sind uns jetzt aus den
dürtigen Anhaltspunkten, welche sich aus
den mit naturhistorischen Tatsachen und Möglichkeiten verglichenen
Sagen gewinnen lassen und die sich wohl für den Sagen kenner noch
treffender belegen oder vermehren und in ein besseres Licht rücken
lassen, als wir es dürftig können - es sind uns jetzt zwei
Hauptmenschenstämme nahegerückt, von denen wir den
noachitischen als den des Säugetierzeitalters, also wesentlich der
spätmesozoischen und Tertiärzeit ansprechen, weil ihm die
alten Eigenschaften des Scheitelauges fehlt und seine Hand unverwachsen
ist. Er dürfte in zurückgedrängter Stellung und
Zahl schon seit der Permzeit und im frühmesozoischen Zeitalter
existiert haben; vielleicht, wie vermutlich alle anfänglichen
Säugetiere, noch mit einem kleinen Stirnauge begabt gewesen sein
und wohl, wie die mesozoische höhere Tierwelt überhaupt,
zunächst noch keinen vollständig aufrechten Gang gehabt,
sondern diesen vom vierfüßig kriechenden oder gehenden
Zustand her erst während des Mesozoikums erworben haben. Der
andere Menschenstamm ist der vornoachitische gewesen, mit Scheitelauge
und verwachsener Hand, den wir mangels eines treffenden Personennamens
den nachadamitischen Menschentypus oder den vornoachitischen nennen
wollten und dessen Lebenszeit wesentlich mit dem permisch-mesozoischen
Zeitabschnitt zusammenfallen wird, besonders mit dem ganz früh-
und mittelmesozoischen, wo, wie gezeigt, jene hervorstechenden
Körpermerkmale vollendet als Zeitsignatur noch im Tierreich
bestanden haben. Er muß entsprechend der Entfaltung seines
Parietalauges bis in die Oberpermzeit mindestens zurückgehen, und
dort dürfen wir hoffen, Anhaltspunkte für den "adamitischen", d. h. den ersten,
frühesten, fremdartigsten Menschentypus zu finden.
Wie müßte dieser
aussehen, wenn wir ohne Nachricht durch die
Sagen versuchen, ihn uns aus der Anatomie des Spätmenschen
einerseits und aus der Zeitsignatur jener Epoche bei den Tieren
andererseits abzuleiten? Er wird noch stark amphibienhafte
Merkmale besessen haben; seine Hand wird verwachsen fünf- bis
siebenfingerig ohne opponierbaren Daumen, vielleicht sogar zum
Schwimmrudern im Wasser geeignet, sein Stirnauge klein oder doppelt,
seine Körperhaut geschuppt, teils gepanzert gewesen sein; denn
gerade das ist der Zeitcharakter der ältesten Landbewohner.
Wir finden in den Sagen wenig, was auf jenen Urzustand des Menschenwesens deutet; aber ganz vereinzelt klingt doch einiges an. So heißt es in einer bekannten, öfters abgebildeten indianischen Bilderschrift, wo auch die Sintflut beschrieben ist, von dem Großvater der Menschen und Tiere, daß er kriechend geboren war und sich auf dem aus dem Meer auftauchenden Schildkröteneiland bewegen kann (17). Ferner heißt es in einer vom Babylonier Oannes übermittelten Sage: Im ersten Jahre nach der Schöpfung sei aus dem erythräischen Meer ein vernunftbegabtes Wesen erschienen mit einem vollständigen Fischleib. Unter dem Fischkopf aber war ein menschlicher Kopf hervorgewachsen und Menschenfüße aus seinem Hinterende oder Schwanz; es hatte auch eine menschliche Stimme, und sein Bild wird bis jetzt aufbewahrt. Dieses Wesen verkehrte den Tag über mit den Menschen, ohne Speise zu sich zu nehmen, gab ihnen die Kenntnis der Schriftzeichen und Wissenschaften, lehrte sie Städte und Tempel bauen, Land vermessen, Früchte bauen. Seit jener Zeit habe man nichts anderes darüber Hinausgehendes erfunden. Mit Sonnenuntergang sei dieses Wesen wieder in das Meer hinabgetaucht, habe die Nächte in der See verbracht, denn es sei amphibienartig gewesen. Später seien noch andere ähnliche Wesen erschienen. Ein solches mit Fischleib, jedoch mit Armen und Füßen des Menschen, habe die Sternkunde gelehrt (18).
Wenn man einen Widerspruch darin sehen will, daß dieses älteste amphibische Menschenwesen zu den Menschen gekommen sei, daß es mithin schon Menschen gegeben habe, jenes also auch keine stammesgeschichtliche Anfangsform gewesen sein könne, so ist demgegenüber erstens denkbar, daß nur die sinnbildliche Ausdrucksweise der Erzählung den Widerspruch mit sich bringt. Denn daß das amphibische Menschenwesen zu den Menschen kommt, braucht ja nichts anderes zu heißen, als daß es selbst zum Menschen wurde. Ein solches, erst menschenwerdendes Wesen mußte ja, sobald seine Menschenhaftigkeit einsetzte, auch der Umwelt mit Bewußtsein oder instinktiv hellsichtig gewahr werden; und da zu den ältesten überwältigendsten Eindrücken auf die Menschenseele der ungreifbare funkelnde Nachthimmel gehört, so begann alsbald in seiner Seele, in seinem Bewußtsein das zu erwachen, was in den ältesten mythischen Zeiten des Menschendaseins mit dem Schauen und dem natursichtigen Durchfühlen der Sternenwelt und ihres Zusammenhanges mit der irdischen Natur verbunden war; denn der Sinn des Wortes Sternkunde oder gar Astronomie ist hier spätzeitlich. Andererseits kann man, wie es meiner Auffassung weit mehr entspricht, bei dem wörtlicheren Inhalt der Sage bleiben und muß dann, wie oben schon angedeutet, folgern, daß neben einem amphibischen Urtypus des Menschenwesens bereits ein terrestrischer bestand, der sich auf einer anderen Stammbahn entwickelt hatte und daß daher beide in ihrer verschiedenen Entwicklungsart genetisch nicht unmittelbar zusammenhingen. Denn es ist wahrscheinlich und würde der Entwicklung der übrigen Tierwelt entsprechen, daß selbst einander sehr nahestehende Typen vielstämmigen Ursprungs sind, so daß auch einzelne Typenkreise innerhalb des Gesamtmenschenstammes verschiedenartig entstanden und organisiert und an verschiedene Lebensbedingungen angepaßt waren. Auch dafür gibt es in der Überlieferung einige Anhaltspunkte. So lesen wir bei Moses, daß die Adamssöhne in ein anderes Land gingen und dort der Menschen Töchter freiten; wir vernehmen dort und sonstwo in den Sagen, daß es gewöhnliche Menschen gegeben habe und vom Himmel gekommene Engel und Kinder Gottes, die an der Menschen Töchter Gefallen fanden und sich mit ihnen zusammentaten.
Wir finden in den Sagen wenig, was auf jenen Urzustand des Menschenwesens deutet; aber ganz vereinzelt klingt doch einiges an. So heißt es in einer bekannten, öfters abgebildeten indianischen Bilderschrift, wo auch die Sintflut beschrieben ist, von dem Großvater der Menschen und Tiere, daß er kriechend geboren war und sich auf dem aus dem Meer auftauchenden Schildkröteneiland bewegen kann (17). Ferner heißt es in einer vom Babylonier Oannes übermittelten Sage: Im ersten Jahre nach der Schöpfung sei aus dem erythräischen Meer ein vernunftbegabtes Wesen erschienen mit einem vollständigen Fischleib. Unter dem Fischkopf aber war ein menschlicher Kopf hervorgewachsen und Menschenfüße aus seinem Hinterende oder Schwanz; es hatte auch eine menschliche Stimme, und sein Bild wird bis jetzt aufbewahrt. Dieses Wesen verkehrte den Tag über mit den Menschen, ohne Speise zu sich zu nehmen, gab ihnen die Kenntnis der Schriftzeichen und Wissenschaften, lehrte sie Städte und Tempel bauen, Land vermessen, Früchte bauen. Seit jener Zeit habe man nichts anderes darüber Hinausgehendes erfunden. Mit Sonnenuntergang sei dieses Wesen wieder in das Meer hinabgetaucht, habe die Nächte in der See verbracht, denn es sei amphibienartig gewesen. Später seien noch andere ähnliche Wesen erschienen. Ein solches mit Fischleib, jedoch mit Armen und Füßen des Menschen, habe die Sternkunde gelehrt (18).
Wenn man einen Widerspruch darin sehen will, daß dieses älteste amphibische Menschenwesen zu den Menschen gekommen sei, daß es mithin schon Menschen gegeben habe, jenes also auch keine stammesgeschichtliche Anfangsform gewesen sein könne, so ist demgegenüber erstens denkbar, daß nur die sinnbildliche Ausdrucksweise der Erzählung den Widerspruch mit sich bringt. Denn daß das amphibische Menschenwesen zu den Menschen kommt, braucht ja nichts anderes zu heißen, als daß es selbst zum Menschen wurde. Ein solches, erst menschenwerdendes Wesen mußte ja, sobald seine Menschenhaftigkeit einsetzte, auch der Umwelt mit Bewußtsein oder instinktiv hellsichtig gewahr werden; und da zu den ältesten überwältigendsten Eindrücken auf die Menschenseele der ungreifbare funkelnde Nachthimmel gehört, so begann alsbald in seiner Seele, in seinem Bewußtsein das zu erwachen, was in den ältesten mythischen Zeiten des Menschendaseins mit dem Schauen und dem natursichtigen Durchfühlen der Sternenwelt und ihres Zusammenhanges mit der irdischen Natur verbunden war; denn der Sinn des Wortes Sternkunde oder gar Astronomie ist hier spätzeitlich. Andererseits kann man, wie es meiner Auffassung weit mehr entspricht, bei dem wörtlicheren Inhalt der Sage bleiben und muß dann, wie oben schon angedeutet, folgern, daß neben einem amphibischen Urtypus des Menschenwesens bereits ein terrestrischer bestand, der sich auf einer anderen Stammbahn entwickelt hatte und daß daher beide in ihrer verschiedenen Entwicklungsart genetisch nicht unmittelbar zusammenhingen. Denn es ist wahrscheinlich und würde der Entwicklung der übrigen Tierwelt entsprechen, daß selbst einander sehr nahestehende Typen vielstämmigen Ursprungs sind, so daß auch einzelne Typenkreise innerhalb des Gesamtmenschenstammes verschiedenartig entstanden und organisiert und an verschiedene Lebensbedingungen angepaßt waren. Auch dafür gibt es in der Überlieferung einige Anhaltspunkte. So lesen wir bei Moses, daß die Adamssöhne in ein anderes Land gingen und dort der Menschen Töchter freiten; wir vernehmen dort und sonstwo in den Sagen, daß es gewöhnliche Menschen gegeben habe und vom Himmel gekommene Engel und Kinder Gottes, die an der Menschen Töchter Gefallen fanden und sich mit ihnen zusammentaten.
Nach den schon erwähnten
Entdeckungen Westenhöfers (siehe vorigen
Artikel) an einigen inneren Organen des Menschen hat
vielleicht in vortertiärer Zeit auch ein an das Wasserleben
angepaßter Typ des Menschenstammes existiert. Dieser
Forscher, der von unserem Gedankengang nichts wußte, schreibt: "Solche Wasserzeiten für den Menschen
könnten ganz gut zur Kreidezeit und noch früher bestanden
haben. Die menschliche Tradition reicht außerordentlich
weit zurück, und sicher ist, daß der Mensch nichts erfinden
kann, was nicht wirklich existiert.... So ist z. B. für mich
die Sage von Beowulfs Kampf mit dem Drachen unter dem Wasser ein
Hinweis, daß der Mensch im Wasser mit solchen Drachen lebte und
kämpfte." Nun ist eine der hervorstechendsten
Zeitsignaturen der mesozoischen Epoche die damals einsetzende und sich
vollendende Anpassung vieler Landtierstämme an das
Wasserleben. Es sind meistens Reptilien; aber auch die erst im
Tertiärzeitalter erscheinenden Wassersäugetiere deuten alle
schon auf eine mesozoische Herausbildung ihrer Form hin. Es
könnte also auch der Menschenstamm selbst damals eine an das
Wasser angepaßte Gestalt nebenher entwickelt haben. Auch
diese Deutung läßt sich auf die babylonische Sage, daß
jenes Fischwesen schon zu fertigen Landmenschen gekommen sei, anwenden.
Außer jener babylonischen Urmenschensage haben wir noch Überlieferungen, die noch einen echten adamitischen Menschentypus schildern; sie behandeln das Aussehen von Adam und Eva bei ihrer Vertreibung aus dem Paradies. Nach der einen Version waren sie behaart wie der Wildmensch Engidu im Gilgameschepos; das Haar fiel ab und sie wurden nackt. Nach der anderen Lesart aber hatten sie einen Hornpanzer wie Krebs und Skorpion. "Die Haut war ähnlich unseren Nägeln", heißt es in der mohammedanischen Überlieferung. Es war ein hornartig weicher glänzender roter Panzer, der nun allmählich abging; nur die Zehen- und Fingernägel sind noch Überbleibsel davon (19).
Ob der von Berossus überlieferte Fischmensch als ältester Typus des Menschenstammes und ob der auch im Gilgameschepos seine Rolle spielende Skorpionmensch der alten Sage, wo er als Schreckgestalt, aber doch als menschlich umgängliches Wesen erscheint, an jenen geschuppten und gepanzerten Urmenschenkörper des Adamiten anknüpft, ob er nur eine Verzerrung oder eine Parallelgestalt zu ihm ist und irgendwie mit dem erdgeschichtlich ältesten Adamiten zu tun hat, ist nicht recht ersichtlich. Jedenfalls ist eines geeignet, ein Licht auf die Sache zu werfen. Fragt man sich, was im körperlichen Sinn Skorpionmensch bedeuten kann, so ist es eben jenes Wesen mit gepanzerter und wahrscheinlich stacheliger oder knotiger Haut. Für solche gepanzerten und stacheligen Wesen ist aber die jüngere Phase des Paläozoikums bis herauf zum Ende der Permzeit jene Zeitspanne, worin solche Gestalten erscheinen: geschuppte Amphibien und Reptilien, zum Teil sogar mit Dornfortsätzen auf dem Körper, insbesondere dem Rücken und am Schädel; so daß hier immerhin Andeutungen einer allerältesten Zeitsignatur vorliegen könnten, an der auch der älteste Teil des Menschenstammes Anteil gehabt haben könnte. Wir hätten dann in jenen gepanzerten Typen der Sage den "uradamitischen" Menschentypus vor uns, dem verfeinerteren, wenn auch noch hornhäutigen Adamiten vorausgehend.
Daß Siegfried im Grund vielleicht ein solcher Adamit ist, läßt sich vermuten an folgender, ganz offenkundiger Parallele: Siegfried hat eine Hornhaut, vom Drachen. Sie fällt nach der deutschen Sage von ihm ab oder wird wertlos, als er Verrat übt und daher wieder verraten werden kann. Es ist das Motiv der Schuld, wie im Sündenfall des Adam. Und in der jüdischen Überlieferung, welche in die Volkssage der Kleinrussen übergegangen ist, heißt es: "Noch lange ehe der erste Mensch gesündigt hatte, war er auf dem ganzen Körper mit solchem Horn, wie wir es an den Nägeln haben, bedeckt. Und es verlangte ihn weder nach Kleidern, noch nach Schuhen, wie uns jetzt. Als er aber sündigte, fiel das Horn von ihm ab (20)." Ob auch in dem gepanzerten Achill noch der unverstandene Anklang an den hornhäutigen Adamiten steckt?
Außer jener babylonischen Urmenschensage haben wir noch Überlieferungen, die noch einen echten adamitischen Menschentypus schildern; sie behandeln das Aussehen von Adam und Eva bei ihrer Vertreibung aus dem Paradies. Nach der einen Version waren sie behaart wie der Wildmensch Engidu im Gilgameschepos; das Haar fiel ab und sie wurden nackt. Nach der anderen Lesart aber hatten sie einen Hornpanzer wie Krebs und Skorpion. "Die Haut war ähnlich unseren Nägeln", heißt es in der mohammedanischen Überlieferung. Es war ein hornartig weicher glänzender roter Panzer, der nun allmählich abging; nur die Zehen- und Fingernägel sind noch Überbleibsel davon (19).
Ob der von Berossus überlieferte Fischmensch als ältester Typus des Menschenstammes und ob der auch im Gilgameschepos seine Rolle spielende Skorpionmensch der alten Sage, wo er als Schreckgestalt, aber doch als menschlich umgängliches Wesen erscheint, an jenen geschuppten und gepanzerten Urmenschenkörper des Adamiten anknüpft, ob er nur eine Verzerrung oder eine Parallelgestalt zu ihm ist und irgendwie mit dem erdgeschichtlich ältesten Adamiten zu tun hat, ist nicht recht ersichtlich. Jedenfalls ist eines geeignet, ein Licht auf die Sache zu werfen. Fragt man sich, was im körperlichen Sinn Skorpionmensch bedeuten kann, so ist es eben jenes Wesen mit gepanzerter und wahrscheinlich stacheliger oder knotiger Haut. Für solche gepanzerten und stacheligen Wesen ist aber die jüngere Phase des Paläozoikums bis herauf zum Ende der Permzeit jene Zeitspanne, worin solche Gestalten erscheinen: geschuppte Amphibien und Reptilien, zum Teil sogar mit Dornfortsätzen auf dem Körper, insbesondere dem Rücken und am Schädel; so daß hier immerhin Andeutungen einer allerältesten Zeitsignatur vorliegen könnten, an der auch der älteste Teil des Menschenstammes Anteil gehabt haben könnte. Wir hätten dann in jenen gepanzerten Typen der Sage den "uradamitischen" Menschentypus vor uns, dem verfeinerteren, wenn auch noch hornhäutigen Adamiten vorausgehend.
Daß Siegfried im Grund vielleicht ein solcher Adamit ist, läßt sich vermuten an folgender, ganz offenkundiger Parallele: Siegfried hat eine Hornhaut, vom Drachen. Sie fällt nach der deutschen Sage von ihm ab oder wird wertlos, als er Verrat übt und daher wieder verraten werden kann. Es ist das Motiv der Schuld, wie im Sündenfall des Adam. Und in der jüdischen Überlieferung, welche in die Volkssage der Kleinrussen übergegangen ist, heißt es: "Noch lange ehe der erste Mensch gesündigt hatte, war er auf dem ganzen Körper mit solchem Horn, wie wir es an den Nägeln haben, bedeckt. Und es verlangte ihn weder nach Kleidern, noch nach Schuhen, wie uns jetzt. Als er aber sündigte, fiel das Horn von ihm ab (20)." Ob auch in dem gepanzerten Achill noch der unverstandene Anklang an den hornhäutigen Adamiten steckt?
Es ist eine alte, tief
wahrhaftige Anschauung, die uns in einem letzten
modernisierten und symbolisierenden Ausklang noch in Herders "Ideen zu
einer Philosophie der Geschichte der Menschheit" begegnet, daß im
Menschenwesen körperhaft und seelisch - wir würden sagen
entelechisch - alles enthalten sei, was die lebende Natur bildet, wie
auch dies, daß die lebende Natur des Menschen körperliches
und seelisches Werden widerspiegelt. Auch hier haben wir einen
Mythus voller Wirklichkeit. Wie wahr, wie tief, wie unentrinnbar
bestimmend er ist, zeigt uns ein Blick in die ihm scheinbar
ausschließend entgegenstehende naturwissenschaftliche
Abstammungslehre. Wir finden in ihr den Gedanken, daß der
Mensch im Lauf der Erdgeschichte alle Stadien vom niedrigen einzelligen
Wassertier über den Wurm, den Fisch, das Amphibium und das
Säugetier bis herauf zu seinem quartärzeitlichen
Menschendasein durchlaufen habe. Dann kam das biogenetische
Grundgesetz hinzu, wonach die embryonalen Formzustände des
menschlichen Einzelindividuums der Reihe nach, wenn auch in vielem
verschoben und verdeckt, die allgemeinen Formzustände dieser
Ahnenreihe wiederholen sollten. Zuletzt wurde diese ganze Lehre
aus dem Organisch-Physischen heraus auch auf die Entwicklung der Sinne
und des Geistes, wie der Kulturseelen, übertragen.
Macht man sich klar, was das heißt, so war es nichts anderes als dies, daß der Menschenstamm einmal eine Amöbe, ein Fisch, ein Amphibium usw war, daß also das Amöb, der Fisch, das Amphibium auch Formzustände des Menschen waren. Das ist hinwiederum gar nichts anderes als die von uns vertretene Vorstellung, daß der Mensch naturhistorisch ein uralter, auch die übrigen organischen Formzustände mit umfassender Stamm ist. Denn auch die bisherige Form der Abstammungslehre, wie sie ja fast allgemein noch gültig ist oder bis vor kurzem es wenigstens noch war, ist ja nicht der Meinung gewesen, daß irgend ein heutiges Amöb oder Amphibium der Ahne des Menschen sei, sondern daß es eben andere, geologisch ältere waren, die entweder nur auf einer Linie oder auf mehreren, durch viele sonstige tierische Zwischenstadien, zum Menschen wurden und von denen sich gelegentlich Seitenzweige ablösten und in entwicklungsgeschichtliche Sackgassen gerieten und Nichtmenschenhaftes hervorbrachten. In diesem Gedanken sind, das darf man wohl sagen, die biologischen Naturforscher wesentlich einig, wenn sie überhaupt eine Evolution zugeben (21).
So haben wir auch in Konsequenz rein naturwissenschaftlichen Zuendedenkens den Beweis, daß eine andere Vorstellung vom Kommen und Werden des Menschen gar nicht vorhanden und wahrscheinlich überhaupt nicht möglich ist als die, welche uns als älteste und festgeschlossenste Lehre in allen Mythen und Religionen entgegentritt: daß der Mensch ein eigenes Wesen, ein eigener Stamm ist, uranfänglich gewesen, was er sein und werden sollte, wenngleich mit allerlei grundlegenden Veränderungen seiner Gestalt; und daß er, körperlich und seelisch mit der Tierwelt stammesverwandt, doch als die von Uranfang an höhere Potenz die anderen aus seinem Stamm entlassen haben muß, nicht umgekehrt. Die volle Entfaltung der reinen, jetztweltlichen Menschenform trat dann ein, als zuletzt auch die in ihm latente Affenform aus ihm entlassen war, ebenso wie er durch Entlassung früherer Formpotenzen immer jetztweltmenschlicher schon geworden war - vom Faun zum Apoll. Und Apoll tötete dem Zeus seine Kyklopen und deren Söhne; so berichtet die wissende Sage (22).
Macht man sich klar, was das heißt, so war es nichts anderes als dies, daß der Menschenstamm einmal eine Amöbe, ein Fisch, ein Amphibium usw war, daß also das Amöb, der Fisch, das Amphibium auch Formzustände des Menschen waren. Das ist hinwiederum gar nichts anderes als die von uns vertretene Vorstellung, daß der Mensch naturhistorisch ein uralter, auch die übrigen organischen Formzustände mit umfassender Stamm ist. Denn auch die bisherige Form der Abstammungslehre, wie sie ja fast allgemein noch gültig ist oder bis vor kurzem es wenigstens noch war, ist ja nicht der Meinung gewesen, daß irgend ein heutiges Amöb oder Amphibium der Ahne des Menschen sei, sondern daß es eben andere, geologisch ältere waren, die entweder nur auf einer Linie oder auf mehreren, durch viele sonstige tierische Zwischenstadien, zum Menschen wurden und von denen sich gelegentlich Seitenzweige ablösten und in entwicklungsgeschichtliche Sackgassen gerieten und Nichtmenschenhaftes hervorbrachten. In diesem Gedanken sind, das darf man wohl sagen, die biologischen Naturforscher wesentlich einig, wenn sie überhaupt eine Evolution zugeben (21).
So haben wir auch in Konsequenz rein naturwissenschaftlichen Zuendedenkens den Beweis, daß eine andere Vorstellung vom Kommen und Werden des Menschen gar nicht vorhanden und wahrscheinlich überhaupt nicht möglich ist als die, welche uns als älteste und festgeschlossenste Lehre in allen Mythen und Religionen entgegentritt: daß der Mensch ein eigenes Wesen, ein eigener Stamm ist, uranfänglich gewesen, was er sein und werden sollte, wenngleich mit allerlei grundlegenden Veränderungen seiner Gestalt; und daß er, körperlich und seelisch mit der Tierwelt stammesverwandt, doch als die von Uranfang an höhere Potenz die anderen aus seinem Stamm entlassen haben muß, nicht umgekehrt. Die volle Entfaltung der reinen, jetztweltlichen Menschenform trat dann ein, als zuletzt auch die in ihm latente Affenform aus ihm entlassen war, ebenso wie er durch Entlassung früherer Formpotenzen immer jetztweltmenschlicher schon geworden war - vom Faun zum Apoll. Und Apoll tötete dem Zeus seine Kyklopen und deren Söhne; so berichtet die wissende Sage (22).
Die letzte Phase des
Menschenwerdens, die wir allein bis jetzt in der
Naturforschung als solche anerkannt sehen, hat sich damals abgespielt,
als in der Tertiärzeit in allen Stämmen Affenmerkmale und
Menschenmerkmale als Zeitsignatur ausgebildet wurden, wie im vorigen
Abschnitt schon gezeigt wurde. Damals dürften sich jene halb
tierischen, halb menschlichen Gestalten gezeigt haben, von denen viele
Sagen berichten, die sich aber darin zu widersprechen scheinen,
daß sie bald affenartige Tiere aus dem Menschen, bald Menschen
aus affenartigen Tieren hervorgehen lassen. Wenn die Tibetaner
das Letztere zu berichten wissen, die malayischen Märchen dagegen
eine Geschichte von einem bösen Menschensohn, der verflucht und
zum Affen wurde, so ist eben beides möglich und kein Widerspruch
zueinander und zu unserer Theorie. Denn in den sich bei der
Evolution überschneidenden Formenkreisen mußte in der Zeit
der anthropoiden und pithekoiden Formgestaltung sowohl im Primatenstamm
Menschenähnliches, wie im Menschenstamm Affenähnliches als
biologischer Habitus erscheinen. Und solche Konvergenzformen,
wenn sie einmal fossil gefunden würden, wären von neuem
geeignet, Verwirrung zu stiften und glauben zu lassen, der Mensch
stamme von tertiärzeitlichen Tieren her. Daß solche
Habitusannäherungen auf mehreren Linien und in mehreren
Formenkreisen möglich waren und tatsächlich vor sich gingen,
ist eine selbstverständliche Möglichkeit für den
Paläontologen, und sie wird auch in mongolisch-tibetanischer
Überlieferung festgestellt. Dort heißt es: Ein
König der Affen wurde von einem Chutuktu in die Felsenkluft des
Schneereiches gesandt, um Bußübungen auf sich zu
nehmen. Da kam ein weiblicher Manggus, ein feindseliges,
verderbliches Geisterwesen zu ihm, von scheußlichem Aussehen,
aber mit der Gabe, schön und reizend zu erscheinen, und wollte
sich mit ihm vermählen. Der Affe wies sie zurück, weil
sein Büßerstand ihm die Ehe verbiete. Aber die Manggus
führte ihm zu Gemüte, daß sie sonst mit übrig
gebliebenen Manggus zusammenkäme und daß sich dann ihr
Geschlecht zum Verderben der Bewohner des Schneereiches aufs neue
vermehren werde. In seinem Zweifel vernahm er eine Stimme vom
Himmel, er solle die Manggus zum Weibe nehmen. Mit ihr erzeugte
er sechs Junge, jedes mit einer anderen, nur ihm eigentümlichen
Gemütsbeschaffenheit. Nach ihrer Entwöhnung brachte sie
ihr Vater in einen Wald von Fruchtbäumen und überließ
sie sich selber. Als er aber nach einigen Jahren hinging, nach
ihnen zu sehen, hatten sie sich schon auf fünfhundert vermehrt und
bereits alles Obst im Walde aufgezehrt; sie liefen ihm, von Hunger
getrieben, mit kläglichem Geheul entgegen. Der Affe klagte
dem Chutuktu, wie er durch Nichtbeobachtung seines Gelübdes nun an
dem Dasein so vieler elender Wesen schuld sei und bat ihn, sich seiner
Kinder zu erbarmen. Der Gott warf ihm von der Höhe eines
Berges fünf Gattungen Getreide in Menge herab, das nicht nur zur
augenblicklichen Sättigung der verhungerten Affen ausreichte,
sondern auch wuchs und ihnen für die zukunft Lebensunterhalt
bot. Aber der Genuß des Getreides hatte merkwürdige
Folgen: die Schwänze der Affen und die Haare ihres Körpers
verkürzten sich zusehends und verschwanden endlich ganz. Sie
fingen an zu reden und wurden Menschen; sie bekleideten sich mit
Baumblättern, sobald sie ihre Menschheit bemerkten (23).
So ist also der Vater dieser später zu Menschen werdenden Affen selbst schon ein sehr "menschlicher Affe" gewesen, naturhistorisch ausgedrückt also ein Mensch mit den pithekoiden Zeitmerkmalen, wie wir es ja im Diluvialmenschen noch so stark anklingen sehen. In dieser bedingten Weise stammt hier also der Mensch vom Affen ab und wird mit der einsetzenden Bodenkultur und dem planmäßigen Getreidebau eben zum Vollmenschen.
So ist also der Vater dieser später zu Menschen werdenden Affen selbst schon ein sehr "menschlicher Affe" gewesen, naturhistorisch ausgedrückt also ein Mensch mit den pithekoiden Zeitmerkmalen, wie wir es ja im Diluvialmenschen noch so stark anklingen sehen. In dieser bedingten Weise stammt hier also der Mensch vom Affen ab und wird mit der einsetzenden Bodenkultur und dem planmäßigen Getreidebau eben zum Vollmenschen.
Wenn wir also jetzt
zusammenfassen, was wir den Überlieferungen
entnehmen konnten, so ist es in den Grundzügen dasselbe, was sich
im vorigen Abschnitt aus rein paläontologischen Erwägungen
als heuristische These über das Alter und die wechselnde
Grundgestalt des Menschenwesens ergab, was wir aber jetzt mit
anschaulicherem Leben füllen können, während es uns dort
nur skeletthaft, gewissermaßen nur fossil, entgegentrat.
Prof. Dr. Edgar Dacqué
(Auszugquelle: Buch "Urwelt, Sage und Menschheit", 8. Aufl., 1938, R. Oldenbourg)
Textanmerkungen/Spezialnachweise:
1) M. J. bin Gorion, Die Sagen der Juden. I. von der Urzeit. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1919, S. 177
2) Das Gilgamesch-Epos, Neu übersetzt v. A. Ungnad, erklärt v. H. Greßmann. Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. Heft 14. Göttingen 1911, S. 49/50.
3) Dähnhardt, Natursagen I. S. 226/227.
4) Oth. Abel, Paläontologie und Paläozoologie. In: Kultur der Gegenwart. Teil III. Organ. Naturwissenschaft. IV. Abt. Bd. 4: Abstammungslehre usw. Leipzig und Berlin 1914, S. 303ff.
-, Die vorweltlichen Tiere in Märchen, Sage und Aberglauben. ("Wissen und Wirken", Bd. 8.) Karlsruhe 1923.
5) G. Weil, Tausend und Eine Nacht. Bd. II, S. 272. 5. Abdruck. Berlin (Ohne Jahreszahl.)
6) Märchen der Weltliteratur, herausgeg. v. A. v. der Leyen. Nordische Volksmärchen I. Teil. Übers. v. Kl. Stroebe. Jena 1915, S. 137.
7) Deutsche Volksbücher. (Herausg. v. P. Jerusalem, Ebenhausen-München 1912.) "Die Historie von einer Frau, genannt Melusine" usw. S. 385/86.
8) Literatur der Zirbeldrüse (Epiphyse):
M. Flesch, Über die Deutung der Zirbel bei den Säugetieren. Anatom. Anzeiger. Bd. III. Jena 1888, S. 173.
R. Wiedersheim, Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. 7. Aufl. Jena 1909, S. 276; 320.
O. Hertwig, Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere. 9. Aufl. Jena 1910, S. 562ff.
A. Biedl, Die innere Sekretion. 3. Aufl. Berlin und Wien 1919.
8a) E. Gaupp, Zirbel, Parietalorgan und Paraphysis. Ergebnisse der Anatomie u. Entwicklungsgeschichte von Merkel u. Bonnet. Bd. VII 1897. Wiesbaden 1898, S. 208-85.
9) Auch das
individuelle Alter der frühnoachitischen Menschen wird stets sehr
hoch angegeben, wie aus dem Alten Testament bekannt ist. Noah
wurde 950 Jahre bis er starb (Gorion, Sagen der Juden. "Urzeit",
S. 236; "Erzväter", S. 146).
Ohne auf die Frage einzugehen, was man in jenen Überlieferungen unter "Jahren" zu verstehen hat, wie auch unter den "Tagen" der mosaischen Schöpfungsgeschichte, sei nur darauf hingewiesen, daß eine gesetzmäßige Beziehung zwischen der Körpergröße der Tierformen und dem individuellen Lebensalter ihrer Individuen zu bestehen scheint; es sei an das hohe Individualalter des Elefanten erinnert. Auch die Riesensaurier des mesozoischen Zeitalters mit ihrer oft unheimlichen Körpergröße konnten individuell sehr alt geworden sein und als Einzeltiere vielleicht Menschengenerationen überdauert haben, woraus sich dann wieder einzelne Sagenzüge erklären ließen. Auch der Urmensch, wenn er sehr groß war, könnte ein sehr hohes individuelles Alter erreicht haben, und es wäre dann nicht nötig, an dem Wort "Jahr" allzuviel noch herumzudeuteln.
Ohne auf die Frage einzugehen, was man in jenen Überlieferungen unter "Jahren" zu verstehen hat, wie auch unter den "Tagen" der mosaischen Schöpfungsgeschichte, sei nur darauf hingewiesen, daß eine gesetzmäßige Beziehung zwischen der Körpergröße der Tierformen und dem individuellen Lebensalter ihrer Individuen zu bestehen scheint; es sei an das hohe Individualalter des Elefanten erinnert. Auch die Riesensaurier des mesozoischen Zeitalters mit ihrer oft unheimlichen Körpergröße konnten individuell sehr alt geworden sein und als Einzeltiere vielleicht Menschengenerationen überdauert haben, woraus sich dann wieder einzelne Sagenzüge erklären ließen. Auch der Urmensch, wenn er sehr groß war, könnte ein sehr hohes individuelles Alter erreicht haben, und es wäre dann nicht nötig, an dem Wort "Jahr" allzuviel noch herumzudeuteln.
9a) Von
fachmännischer Seite wurde gelegentlich eingewendet, ein
"Stirnauge" liege auf der Stirne, ein "Scheitelauge" oben auf dem
Schädeldach; man dürfe daher beides nicht gleichsetzen. - Bei
den ein Parietalorgan tragenden Tieren liegen aber Stirne und
Schädeldach in einer Flucht; deshalb bedeutet "Stirnauge" und
"Scheitelauge" dem Sinn nach wohl dasselbe. Ich glaube kaum,
daß die Sagenüberlieferer bei der Bezeichnung "Stirnauge"
auf anatomisch-nomenklatorische Korrektheit Wert legten oder gar an die
Möglichkeit einer Unterscheidung von Parietalknochen und
Frontalknochen dachten; sonst hätten sie sich gewiß
zunftgemäß ausgedrückt! Ich lasse also für
die Gestalt des Urmenschen das Wort "Stirnauge" wechselweise mit
"Scheitelauge" stehen und verzichte auf eine so unfruchtbare, den Sinn
der Sage verfehlende Haarspalterei, zumal älteste Wirbeltiere auch
im streng anatomischen Sinn ein richtiges Stirnloch, nämlich
zwischen den Frontal-, nicht zwischen den Parietal-Knochen
hatten. Über die paläontologische Entstehung vgl.
meinen Aufsatz "Die Ursinnessphäre" in "Die Kreatur", Band II,
Heft 3. Berlin 1928.
Von der anderen Seite angesehen, ist es jedoch nicht ausgeschlossen, daß von den ältesten fischartigen Urzuständen aus sich eine Entwicklungsbahn mit richtigem Stirnauge und andererseits die bekannten Saurier mit dem Parietal- oder Scheitelauge sich abzweigten. Der hypothetische Urmenschenstamm könnte zu dem ersterem Typus gehört haben, so daß man bei ihm von einem richtigen Stirnauge im strengsten Sinn reden müßte. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, daß die Frösche (Anuren) einen richtigen Stirnfleck haben, der in den Frontal- nicht Parietalknochen sitzt und damit auf jenen vermuteten uralten und richtigen Stirnaugenzustand hinweist. Dieses periphere Stirnorgan entspricht, wie Goette nachwies, aber auch der Zirbel, und das zeigt, daß ihr Hervortreten nach außen nicht an bestimmte Schädelknochen gebunden ist. Die Frage ist vorläufig nicht zu entscheiden, und ich gebrauche daher den Ausdruck Stirn- und Scheitelauge wechselweise noch in der unverbindlichen Form. (Vgl. hierzu: J. B. Rohon, Über Parietalorgane und Paraphysen. Sitzungsber. k. böhm. Ges. Wiss. [Math. Natw. Kl.]. Prag 1899, S. 1-15).
Von der anderen Seite angesehen, ist es jedoch nicht ausgeschlossen, daß von den ältesten fischartigen Urzuständen aus sich eine Entwicklungsbahn mit richtigem Stirnauge und andererseits die bekannten Saurier mit dem Parietal- oder Scheitelauge sich abzweigten. Der hypothetische Urmenschenstamm könnte zu dem ersterem Typus gehört haben, so daß man bei ihm von einem richtigen Stirnauge im strengsten Sinn reden müßte. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, daß die Frösche (Anuren) einen richtigen Stirnfleck haben, der in den Frontal- nicht Parietalknochen sitzt und damit auf jenen vermuteten uralten und richtigen Stirnaugenzustand hinweist. Dieses periphere Stirnorgan entspricht, wie Goette nachwies, aber auch der Zirbel, und das zeigt, daß ihr Hervortreten nach außen nicht an bestimmte Schädelknochen gebunden ist. Die Frage ist vorläufig nicht zu entscheiden, und ich gebrauche daher den Ausdruck Stirn- und Scheitelauge wechselweise noch in der unverbindlichen Form. (Vgl. hierzu: J. B. Rohon, Über Parietalorgane und Paraphysen. Sitzungsber. k. böhm. Ges. Wiss. [Math. Natw. Kl.]. Prag 1899, S. 1-15).
10) Eine Woche vor
der Drucklegung, nachdem über ein halbes Jahr dieser Abschnitt
inhaltlich feststand, bekam ich noch die Abhandlung von A. Sichler:
"Die Theosophie (Anthroposophie) in psychologischer Beurteilung" (Heft
112 der Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. München
und Wiesbaden 1921) in die Hand und findet dort als Gegenstand der
Kritik u. a. eine Inhaltsangabe der Hauptgedanken einer Urgeschichte
der Menschheit nach H. P. Blavatsky, die sich in einigen Punkten und z.
T. identischen Angaben über den Urmenschen mit meinen
Schlußfolgerungen berührt.
11) Die Dresdner
Mayahandschrift (Codex Dresdenensis) ist veröffentlicht in:
"Antiquities of Mexiko" von Lord Kingsborough. 9. Bd. London
1831-48 (Bd. 3, S. 74ff). Ferner reproduziert von:
E. Förstemann, die Mayahandschrift usw. Dresden 1892. (Neudruck, Erste Ausgabe: Leipzig 1880. Die Abbildungen in F. Helmolts "Weltgeschichte", I. Aufl. Bd. 1. Leipzig und Wien 1899, S. 230/31 sind ebenbürtige Reproduktionen. Die im Text jeweils wiedergegebenen Abbildungen sind der Ausgabe von 1880 entnommen. Erläuterungen zu den Götter- bzw. Dämonengestalten gibt: P. Schellhas, Die Göttergestalten der Mayahandschrift. Dresden 1897.
E. Förstemann, die Mayahandschrift usw. Dresden 1892. (Neudruck, Erste Ausgabe: Leipzig 1880. Die Abbildungen in F. Helmolts "Weltgeschichte", I. Aufl. Bd. 1. Leipzig und Wien 1899, S. 230/31 sind ebenbürtige Reproduktionen. Die im Text jeweils wiedergegebenen Abbildungen sind der Ausgabe von 1880 entnommen. Erläuterungen zu den Götter- bzw. Dämonengestalten gibt: P. Schellhas, Die Göttergestalten der Mayahandschrift. Dresden 1897.
12) F. Bumiller, Die Bibel der Quiche-Indianer. Beilage zur Augsburger Abendzeitung, Nr. 56, 1912, S. 6.
13) Andree, Flutsagen, a. a. O., S. 59.
14) Andree, ibid., S. 84.
15) Preller-Robert, Griech. Mythologie, S. 85.
16)
Gilgameschepos, Neu übersetzt v. A. Ungnad, erklärt v. H.
Greßmann. Forschungen zur Religion und Literatur des Alten
und Neuen Testaments. Heft 14. Göttingen 1911, S. 8/9
17) Andree, Flutsagen S. 74.
Diese indianische
Bildererzählung ist wohl in jedem guten
Konversationslexikon zu finden, auch in sonstigen
gemeinverständlichen Werken oft abgebildet; ferner in R. Andree,
Flutsagen.
18) A. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. Leipzig 1904, S. 5.
19) Dähnhardt, Natursagen, Bd. I, S. 226/27.
20) Dähnhardt, ibid., S. 226.
21) Aber gerade
das ist es, von wo aus sich abermals zeigen läßt, daß
man sogar in der Zeit der extremsten Deszendenzlehre nichts anderes
denken und sich vorstellen konnte als folgende drei Fälle:
1. Der Mensch ist ein eigener persistenter Stamm, wenn auch mit allen möglichen Verwandlungen, bis zur ältesten erdgeschichtlichen Zeit zurück. Das schließt zwei verschiedene Möglichkeiten der Entwicklung ein: Entweder ist dieser selbständige Stamm im Mesozoikum ein primitives Säugetier und im Anfang des Mesozoikums oder im jüngsten Paläozoikum ein Reptil bzw. Amphibium gewesen und hat sich durch diese Stadien zu einem Menschenaffen und zuletzt zum Menschen hindurchentwickelt; oder er war seit jener ältesten Zeit auch äußerlich schon ein eigener Formtypus, wenn auch in allerlei Formverwandlungen erscheinend, also doch eben entelechisch Mensch. Im ersteren Fall hätten wir nichts wesentlich anderes als den alten grotesken Stammbaum Haeckels, worin die Haie und Reptilien unsere Ahnen waren; genau das. Aber eben das glaubt heute doch der das paläontologische Material beherrschende Forscher nicht mehr. Bleibt also nur das zweite noch: der Spätmensch stammt aus seiner eigenen Stammbahn her, nicht von Haien und Molchen.
2. Der Mensch und viele höhere Tiere gehen stammesgeschichtlich auf eine ihnen gemeinsame, sehr alte Urform zurück; der Mensch ist bloß die am weitesten emporgetriebene Spitze und jene gemeinsame Urform ist eben auch seine Urform. Die übrigen aus dieser Urform bald früher bald später abgezweigten, weniger hochentwickelten Gattungen sind dann eben einseitig differenzierte oder stehengebliebene Stadien seines ursprünglichen Werdens selbst.
3. Es stammt alles Tierleben, soweit wir es zurückverfolgen können, von ein und derselben Urform her, die mithin auch der Stammvater des späteren Menschentieres ist. Das wäre das alte Bild des auf das Linnésche System gegründeten Stammbaumes der früheren Deszendenzlehre, das zur Spitze den Menschen hatte. Somit würde sein Wesen auch dem ganzen Stamm bis in den Anfang zurück angehören - es wäre stets seine Urform gewesen, aus der alles hervorging. Er würde potentia die ganze Tierwelt in seinem Stamm mitgebracht und mitgeführt haben und stets in eben dem Maß reiner herausgetreten sein, als Tierhaftes sich aus dieser seiner Stammbahn in speziellen Formen abspaltete.
Denn es wird doch nicht mehr gut als letzter Ausweg - um eine Entwicklungslehre ohne Entelechie zu retten - behauptet werden wollen, der Mensch sei aus irgend welchen Tierformen, ohne die innere Potenz zu einem Menschen, rein zufällig geworden? Wo wäre das, was ihn ausmacht, hergekommen? Aus sich selbst? Was wäre dieses Selbst? Oder aus dem Nichts? Oder aus einem Schöpfungsakt? Oder aus dem äußeren Ungefähr? Man mag die Abstammungslehre wenden wie man will: aus den obigen Alternativen wird man nicht herauskommen und ist selbst im darwinistischsten Zeitalter nicht herausgekommen - wenn man nicht gerade den sinnlosen leeren äußeren Zufall als ein höchst mystisches Geschehen an Stelle einer gerichteten Evolution setzen will. Wie man es also auch wendet und formuliert: der Mensch bleibt als wahre Urform der Stamm aller höheren Wesen.
1. Der Mensch ist ein eigener persistenter Stamm, wenn auch mit allen möglichen Verwandlungen, bis zur ältesten erdgeschichtlichen Zeit zurück. Das schließt zwei verschiedene Möglichkeiten der Entwicklung ein: Entweder ist dieser selbständige Stamm im Mesozoikum ein primitives Säugetier und im Anfang des Mesozoikums oder im jüngsten Paläozoikum ein Reptil bzw. Amphibium gewesen und hat sich durch diese Stadien zu einem Menschenaffen und zuletzt zum Menschen hindurchentwickelt; oder er war seit jener ältesten Zeit auch äußerlich schon ein eigener Formtypus, wenn auch in allerlei Formverwandlungen erscheinend, also doch eben entelechisch Mensch. Im ersteren Fall hätten wir nichts wesentlich anderes als den alten grotesken Stammbaum Haeckels, worin die Haie und Reptilien unsere Ahnen waren; genau das. Aber eben das glaubt heute doch der das paläontologische Material beherrschende Forscher nicht mehr. Bleibt also nur das zweite noch: der Spätmensch stammt aus seiner eigenen Stammbahn her, nicht von Haien und Molchen.
2. Der Mensch und viele höhere Tiere gehen stammesgeschichtlich auf eine ihnen gemeinsame, sehr alte Urform zurück; der Mensch ist bloß die am weitesten emporgetriebene Spitze und jene gemeinsame Urform ist eben auch seine Urform. Die übrigen aus dieser Urform bald früher bald später abgezweigten, weniger hochentwickelten Gattungen sind dann eben einseitig differenzierte oder stehengebliebene Stadien seines ursprünglichen Werdens selbst.
3. Es stammt alles Tierleben, soweit wir es zurückverfolgen können, von ein und derselben Urform her, die mithin auch der Stammvater des späteren Menschentieres ist. Das wäre das alte Bild des auf das Linnésche System gegründeten Stammbaumes der früheren Deszendenzlehre, das zur Spitze den Menschen hatte. Somit würde sein Wesen auch dem ganzen Stamm bis in den Anfang zurück angehören - es wäre stets seine Urform gewesen, aus der alles hervorging. Er würde potentia die ganze Tierwelt in seinem Stamm mitgebracht und mitgeführt haben und stets in eben dem Maß reiner herausgetreten sein, als Tierhaftes sich aus dieser seiner Stammbahn in speziellen Formen abspaltete.
Denn es wird doch nicht mehr gut als letzter Ausweg - um eine Entwicklungslehre ohne Entelechie zu retten - behauptet werden wollen, der Mensch sei aus irgend welchen Tierformen, ohne die innere Potenz zu einem Menschen, rein zufällig geworden? Wo wäre das, was ihn ausmacht, hergekommen? Aus sich selbst? Was wäre dieses Selbst? Oder aus dem Nichts? Oder aus einem Schöpfungsakt? Oder aus dem äußeren Ungefähr? Man mag die Abstammungslehre wenden wie man will: aus den obigen Alternativen wird man nicht herauskommen und ist selbst im darwinistischsten Zeitalter nicht herausgekommen - wenn man nicht gerade den sinnlosen leeren äußeren Zufall als ein höchst mystisches Geschehen an Stelle einer gerichteten Evolution setzen will. Wie man es also auch wendet und formuliert: der Mensch bleibt als wahre Urform der Stamm aller höheren Wesen.
22) C. Robert, Die griechische Heldensage. Bd. I. Berlin 1920, S. 30; S. 565, Anm. 1.
23) J. J. Schmidt, Forschungen im Gebiete der Bildungsgeschichte der Völker Mittelasiens. St. Petersburg 1824, S. 210/13.