| Zurück |
Impressum
Datenschutz
Entstehung
Jupiters
Unsere Übersicht über den Entwicklungsgang der Sonnenwelt hat uns weit ausgedehnte Zonen dichter Eiskörperschwärme erkennen lassen, welche den Raum außerhalb der Marsbahn bis zum Innenrande der in "planetarischer" Ferne zu denkenden Milchstraße erfüllten. Etwa innerhalb der breitesten Querschnitte dieser Eiskörperlinse um den heliotischen Kreisel entstand aus dem Ankrystallisieren des gefrorenen Wasserdampfes an weit hinausgeschleuderte, sehr kleine und deshalb rasch gekühlte heliotische Massen, die somit den eigentlichen "Kern" bildeten, und aus dem darauf folgenden, fortwährenden, zufälligen Zusammenfinden primär geballter Eiskörper, welche überholt oder durch Anziehung gefesselt wurden, ein Subzentrum von solcher Art, daß die Resultierende aus allerlei zentrifugalen, zentripetalen und rotatorischen Kräften eben eine tangentiale wurde, groß genug, um zu einer geschlossenen Bahn zu führen.
Wahrscheinlich gruppierten sich planetoidische Massen um ein versprengtes Stück glühende Urmaterie, vielleicht aber ist der Jupiterkern auch mehr ein Konglomerat meteorischen Ursprungs oder beides. Das in günstiger Distanz umlaufende Subzentrum mußte durch anziehende Wirkung auf seine zahlreichen Nachbarn rasch und bedeutend an Masse zunehmen. Der Grund zum heutigen Jupiter war gelegt und dieser wuchs in steigendem Maße mit der Erweiterung seines Anziehungskreises. Nicht nur einschrumpfende Planetoidenbahnen und galaktische Zurücksinkungswege der Urzeit fanden im neuen Gravitationszentrum ein Ziel, auch heute noch sammelt Jupiter einen Teil derjenigen transneptunischen Planetoiden, die den drei äußersten Hauptplaneten aus Gründen ihrer Konstellation oder der großen Bahnneigung der Eindringlinge entronnen sind; was auch ihm entwischt, gibt transmartiale Planetoiden oder Kometen, deren letztes Ziel die Sonne ist.
Unsere Übersicht über den Entwicklungsgang der Sonnenwelt hat uns weit ausgedehnte Zonen dichter Eiskörperschwärme erkennen lassen, welche den Raum außerhalb der Marsbahn bis zum Innenrande der in "planetarischer" Ferne zu denkenden Milchstraße erfüllten. Etwa innerhalb der breitesten Querschnitte dieser Eiskörperlinse um den heliotischen Kreisel entstand aus dem Ankrystallisieren des gefrorenen Wasserdampfes an weit hinausgeschleuderte, sehr kleine und deshalb rasch gekühlte heliotische Massen, die somit den eigentlichen "Kern" bildeten, und aus dem darauf folgenden, fortwährenden, zufälligen Zusammenfinden primär geballter Eiskörper, welche überholt oder durch Anziehung gefesselt wurden, ein Subzentrum von solcher Art, daß die Resultierende aus allerlei zentrifugalen, zentripetalen und rotatorischen Kräften eben eine tangentiale wurde, groß genug, um zu einer geschlossenen Bahn zu führen.
Wahrscheinlich gruppierten sich planetoidische Massen um ein versprengtes Stück glühende Urmaterie, vielleicht aber ist der Jupiterkern auch mehr ein Konglomerat meteorischen Ursprungs oder beides. Das in günstiger Distanz umlaufende Subzentrum mußte durch anziehende Wirkung auf seine zahlreichen Nachbarn rasch und bedeutend an Masse zunehmen. Der Grund zum heutigen Jupiter war gelegt und dieser wuchs in steigendem Maße mit der Erweiterung seines Anziehungskreises. Nicht nur einschrumpfende Planetoidenbahnen und galaktische Zurücksinkungswege der Urzeit fanden im neuen Gravitationszentrum ein Ziel, auch heute noch sammelt Jupiter einen Teil derjenigen transneptunischen Planetoiden, die den drei äußersten Hauptplaneten aus Gründen ihrer Konstellation oder der großen Bahnneigung der Eindringlinge entronnen sind; was auch ihm entwischt, gibt transmartiale Planetoiden oder Kometen, deren letztes Ziel die Sonne ist.

(Bildquelle/text: Buch "Der Sterne Bahn und Wesen", Max Valier, 1924)
Aufbau eines Eis-Großwandelsterns wie Jupiter. 1-8 verschiedene Zustände der Entwicklung vom ursprünglichen Firnball zum heutigen Körper,
der aus Eisenschlacken E im Kern, Wasser W im Innern und einer Firneisschale F an der Oberfläche besteht.
Alle von Jupiter aufgefangene
Körper gaben ihre lebendige Kraft
fast ganz im Sinne einer Rotationsbeschleunigung ab und deren Effekt
muß in den entlegensten Epochen am größten gewesen
sein. Die plausible
Schätzung, daß damals viel zahlreichere und in
kürzeren Pausen wiederholte Einschläge erfolgten als heute,
(wo ein bedeutender Teil der Körper, soweit sie nicht über
Jupiter hinausgeschrumpft sind, bereits aufgezehrt ist) und die allgemeine Einsicht, daß
der mächtigste Planet aus einer Riesenanzahl von Eisindividuen
aufgebaut worden sei, läßt es allein verständlich
werden, daß der schwerfälligste Körper des
Sonnensystems die größte rotatorische Winkelgeschwindigkeit
erhalten hat. Alle primären und sekundären Subzentren,
die sich naturgemäß ebenso zwischen Jupiter und Saturn wie
zwischen Erde und Mars befanden, hatten das Schicksal, aus
planetarischen Körpern zu Trabanten und dann zu Bestandteilen
Jupiters zu werden; auf sie ist in erster Linie die Beschleunigung der
Rotation zurückzuführen. Heute noch hat Jupiter 7
solcher Trabanten, davon 4, die sogar als ehemalige kleine Subzentren
gegen Saturn hin gelten könnten, aber wohl auch nur
transneptunische Planetoiden waren und zwei (V und VI), die ihre
transneptunische Herkunft nicht verleugnen können, und einen
(VII), der auch nach der Ansicht astronomischer Theoretiker aus der
transmartialen Planetoidenzone stammen könnte,
nach unserer Überzeugung aber ursprünglich gleichfalls
jenseits Neptun umlief. Im ersten Falle dürfte ein sehr
exzentrischer Planetoid bei langsamer Aphelbewegung (Aphelium =
Sonnenfernpunkt) von Jupiter in Perihelstellung (Perihelium =
Sonnennahpunkt) gestört, hinter sich hergeschleppt, und weil der
Planetoid mehr Tendenz gegen Jupiter zeigte, aus der Richtung innerhalb
der Jupiterbahn her "rechtsum" abgelenkt worden sein, so daß wir ihn heute mit retrograder
Bewegung umlaufen sehen. - Daß er als extraneptunischer Planet mit starker
Neigung seiner Bahn und umgekehrter Bewegung behaftet ist macht einer
Erklärung angesichts des Winkels von 65° zwischen der
galaktischen und ekliptikalen Ebene - und die transneptunischen
Planetoiden liegen ja dazwischen - und mit Rücksicht auf die
spiralige Bahnbewegung der Neptoiden noch weniger
Schwierigkeiten. Wir haben also die Wahl.
Jupiters Monde
Das Schicksal dieser sieben
Monde ist klar. Der innerste (V)
muß in ziemlich kurzer Zeit auf Jupiter sinken. Dieser nur
etwa 160 km messende Liliputaner, der in 12 Stunden eine Bahn von 568
600 km (v = 13,2 km) beschreibt, kann angesichts seiner Kleinheit und
geringen Dichte einen Maßstab für die hemmende Wirkung des
Äthers abgeben. Wir lesen hierüber im neuesten
Newcomb-Vogel (S.391): "Die
Störungen seiner Bahn durch die ellipsoidale Gestalt des Planeten
sind so beträchtlich, daß die Apsidenlinie (Apsiden =
Großachsen) in weniger als
einem Jahre einen vollen Umlauf macht." Wir lassen hier
mit Grund auch die ellipsoidale Gestalt Jupiters gelten, weil Trabant V
nur in 1,6 Planetenradien von Jupiters Oberfläche kreist; aber wir
wissen, daß in diesem Falle die Bahnhemmung der gewichtigere Anlaß ist,
indem sie bei V etwa 25mal so groß ist als bei I. Es sei
aber hier gleich bemerkt, daß bei dem Marsmonde Phobos dessen
Umlauf bei einem Abstande von bloß 1,7 Radien von der
Marsoberfläche nur 7,66 Stunden beträgt, dieses Kriterium
versagt, denn einmal hat dieser vielleicht nur 16 km große
Trabant nur 2,1 km Geschwindigkeit und zum anderen ist seine Bahn so
nahe kreisförmig, daß ein Apsidenumlauf schwer festzustellen
wäre, und drittens ist Mars so gut wie gar nicht abgeplattet;
natürlich muß im übrigen Phobos noch rascher
einwärts schrumpfen als der
V. Jupitermond. Die beiden äußersten Jupitermonde sind theoretisch noch wenig untersucht; da sie aber sehr stark geneigte Bahnen beschreiben, so muß durchaus nicht IV der Erbe ihrer Massen sein. Sie können auch über diesen gegen III hereinschrumpfen und werden sich dann vielleicht soweit den Bahnen der größeren Trabanten anbequemt haben, daß sie von III absorbiert werden können und zwar der viel kleinere VII vor VI. Bei den altbekannten vier Monden aber, deren Größenfolge lautet II. I. IV. III, und deren Massen der Reihe nach in Millionsteln der Jupitermasse sind 16,9 und 23,2 und 88,4 und 42,5, ist zweifellos, daß der massenarme 1. Trabant zuerst auf Jupiter niedersinkt; inzwischen dürfte sich IV ins Trabantenverhältnis zu III gesetzt finden, da III die am wenigsten veränderliche Bahn beschreibt; sodann sinkt II auf Jupiter und endlich ist nach langen Zeiträumen auch für III, welcher IV bereits aufgezehrt hat, dasselbe Schicksal unausbleiblich. Jeder setzt dabei seine lebendige Kraft fast ganz in Rotationsbewegung der Jupiterkugel um.
V. Jupitermond. Die beiden äußersten Jupitermonde sind theoretisch noch wenig untersucht; da sie aber sehr stark geneigte Bahnen beschreiben, so muß durchaus nicht IV der Erbe ihrer Massen sein. Sie können auch über diesen gegen III hereinschrumpfen und werden sich dann vielleicht soweit den Bahnen der größeren Trabanten anbequemt haben, daß sie von III absorbiert werden können und zwar der viel kleinere VII vor VI. Bei den altbekannten vier Monden aber, deren Größenfolge lautet II. I. IV. III, und deren Massen der Reihe nach in Millionsteln der Jupitermasse sind 16,9 und 23,2 und 88,4 und 42,5, ist zweifellos, daß der massenarme 1. Trabant zuerst auf Jupiter niedersinkt; inzwischen dürfte sich IV ins Trabantenverhältnis zu III gesetzt finden, da III die am wenigsten veränderliche Bahn beschreibt; sodann sinkt II auf Jupiter und endlich ist nach langen Zeiträumen auch für III, welcher IV bereits aufgezehrt hat, dasselbe Schicksal unausbleiblich. Jeder setzt dabei seine lebendige Kraft fast ganz in Rotationsbewegung der Jupiterkugel um.
Jupiters Rhythmus
Jupiters Bahn liegt schon weit
genug vom System-Mittelpunkt ab, um ihn
weit hinaus in diejenigen Fernen wirken zu lassen, aus denen die
Eisschleierfetzen aus dem galaktischen Ringe gegen den umlaufenden Teil
des Systems, die Planetenwelt, hereinsinken. Er hat allein 2,5mal
soviel Masse und Anziehungskraft als sämtliche übrigen
Planeten zusammengenommen. Wenn er also den apexseitigen (Apex =
Flugzielpunkt) Quadranten seiner Bahn durchzieht, so kann er besonders
in jenen Längen, welche den Erdorten im Juli-August und
Oktober-November entsprechen, aus den dortigen Knoten der
Apexströme mit der Ekliptik (hier Jupiterbahn) gewaltige Mengen
galaktischen Eises zu sich und in den planetarischen Wirbel ziehen und
das jedesmal im Jupiterjahre mehr als drei Jahre lang.
In derjenigen Länge, welche dem Erdorte etwa in der Mitte des September entspricht, zieht Jupiter "tief unter" dem galaktischen Eiskonus hinweg und kann somit höchstens Eisboliden in den Planetenkreisel "herunterlenken", ohne sie so unmittelbar und zweifellos zu fesseln wie rund um ein Jahr vorher und nachher.
Natürlich entspricht auch der Antiapexstellung (Antiapex = Flugzielgegenpunkt) des Planeten ein Maximum der Wirkung, das aber wiederum untergeordneter Art ist, weil er dann "hoch über" dem Zentrum hinwegzieht. Die äußersten Planeten bleiben allzulange aus den bezeichneten Regionen stärkster und starker Stromdichte und Anziehungseinflüsse abwesend, um ähnlich starke Wirkungen wie Jupiter zu erzielen; aber sie wirken wieder in anderer Weise mit, so vornehmlich der langsam wandelnde Neptun, der als entferntester durch Dauerwirkung in 165jährigen Pausen seinen anziehenden Einfluß weit hinaus trägt.
So können galaktische Massen, die vielleicht schon durch die äußeren Planeten aus der Ebene ihrer schräg zur Ekliptik stehend angeordneten Zurücksinkungsbahnen angelockt worden sind, auf Jupiters spezielle, alle 12 Jahre wiederholte, immer dringlichere Einladung hin heranschweben. Sie werden sich wohl nur unwesentlich zur Ekliptik niedergewöhnt haben, wenn sie endlich in seinen Machtbereich gelangen und ihn als Eisstrom umarmen, aber er wird aus dem langen, breiten und dicken Zuge des Schwarmes nähere, kleinere Körper herausfangen und der Ätherwiderstand wird sie aussortieren, so daß sie in verschieden steilen und langgezogenen Spiralen zu ihm gravitieren - die letzten in der Nähe des Äquators aber nicht an ihm selbst. Einen Vorrat von langsam zusinkenden Eiskörpern wird er auf einem Umlaufe um die Sonne zweimal in stärkerer Form vor und hinter seinem Apexpunkte und je einmal in schwächerer Form in seinem Apex- und Antiapexpunkte mitnehmen und 12 Jahre lang an ihrer Verarbeitung zehren, bis er nach dieser Frist neue Nahrung bekommt.
Da aber auch Saturn in 30jähriger Periode und die äußersten Nachbarplaneten in 84- und 165jährigen Fristen und auch in ähnlichen Abstufungen wie Jupiter den Eiszufluß fördern, dessen Menge von Fall zu Fall ebenso wie seine Einfallrichtung verschieden ist, so kann auf dem Planeten Jupiter selber die Periode seiner eigenen oberflächigen Änderungen nicht so deutlich zum Ausdrucke kommen als etwa diejenige auf der Sonne, der er alle 12 Jahre zwei verschiedene, große Sendungen galaktischen Materials zuschickt.
In derjenigen Länge, welche dem Erdorte etwa in der Mitte des September entspricht, zieht Jupiter "tief unter" dem galaktischen Eiskonus hinweg und kann somit höchstens Eisboliden in den Planetenkreisel "herunterlenken", ohne sie so unmittelbar und zweifellos zu fesseln wie rund um ein Jahr vorher und nachher.
Natürlich entspricht auch der Antiapexstellung (Antiapex = Flugzielgegenpunkt) des Planeten ein Maximum der Wirkung, das aber wiederum untergeordneter Art ist, weil er dann "hoch über" dem Zentrum hinwegzieht. Die äußersten Planeten bleiben allzulange aus den bezeichneten Regionen stärkster und starker Stromdichte und Anziehungseinflüsse abwesend, um ähnlich starke Wirkungen wie Jupiter zu erzielen; aber sie wirken wieder in anderer Weise mit, so vornehmlich der langsam wandelnde Neptun, der als entferntester durch Dauerwirkung in 165jährigen Pausen seinen anziehenden Einfluß weit hinaus trägt.
So können galaktische Massen, die vielleicht schon durch die äußeren Planeten aus der Ebene ihrer schräg zur Ekliptik stehend angeordneten Zurücksinkungsbahnen angelockt worden sind, auf Jupiters spezielle, alle 12 Jahre wiederholte, immer dringlichere Einladung hin heranschweben. Sie werden sich wohl nur unwesentlich zur Ekliptik niedergewöhnt haben, wenn sie endlich in seinen Machtbereich gelangen und ihn als Eisstrom umarmen, aber er wird aus dem langen, breiten und dicken Zuge des Schwarmes nähere, kleinere Körper herausfangen und der Ätherwiderstand wird sie aussortieren, so daß sie in verschieden steilen und langgezogenen Spiralen zu ihm gravitieren - die letzten in der Nähe des Äquators aber nicht an ihm selbst. Einen Vorrat von langsam zusinkenden Eiskörpern wird er auf einem Umlaufe um die Sonne zweimal in stärkerer Form vor und hinter seinem Apexpunkte und je einmal in schwächerer Form in seinem Apex- und Antiapexpunkte mitnehmen und 12 Jahre lang an ihrer Verarbeitung zehren, bis er nach dieser Frist neue Nahrung bekommt.
Da aber auch Saturn in 30jähriger Periode und die äußersten Nachbarplaneten in 84- und 165jährigen Fristen und auch in ähnlichen Abstufungen wie Jupiter den Eiszufluß fördern, dessen Menge von Fall zu Fall ebenso wie seine Einfallrichtung verschieden ist, so kann auf dem Planeten Jupiter selber die Periode seiner eigenen oberflächigen Änderungen nicht so deutlich zum Ausdrucke kommen als etwa diejenige auf der Sonne, der er alle 12 Jahre zwei verschiedene, große Sendungen galaktischen Materials zuschickt.
Indem sich Jupiter aus den
Eisschleierfetzen, welche er, Saturn, Uranus
und Neptun von Fall zu Fall heranlocken, selber Material
herausfängt und von jeher geholt hat, so wächst er selbst an
Masse, wie an weitreichendem Einflusse. Dadurch gewinnt er auch
fortgesetzt größeres Vermögen, den Ätherhemmungen
gegenüber seine Bahn zu behaupten, und das ist der Grund, weshalb
er länger bestehen bleibt als seine Nachbarn, die ihm in oben
geschilderter Weise und Folge zum Opfer fallen. Er ist dann der
einzige Übrige, dem es zukommt, den galaktischen Rest genau in den
Perioden seines zukünftigen Umlaufes zur Sonne zu lenken, soweit
der nicht vorbei- und zurücksinkt und soweit er ihn nicht selbst
auf sich sammelt. Die Periode der Sonnenflecken wird in jener
fernen Epoche genau das kürzer gewordene Jupiterjahr widerspiegeln
und seine Oberflächenteilung wird nie eine wesentliche
Umgestaltung erfahren, solange Zufluß von außen und
vielleicht eine späterhin merkliche Sonnenflut wirksam sind, die
alten Wunden aufs Neue aufbrechen zu lassen. Jupiter geht seinem
Ende entgegen mit wahrscheinlich noch weiter verkürzter
Rotationsdauer, zumal er auch Saturn, Uranus und Neptun aufgenommen
hat, und muß nur gegen den Schluß seiner Existenz, wenn er
sehr nahe der Sonne umrast, starke physikalische Veränderungen
seiner Oberfläche durchmachen, umso mehr, als die Sonne eine
erhöhte Gasnatur und Weißglühhitze besitzen wird.
Der Planet kann es erleben, daß die Sonne auf ihrem Wege mit
einem Fixsterne, der aus beliebiger Richtung kommt, ein
Doppelsternsystem bildet, darin er der dritte Körper ist.
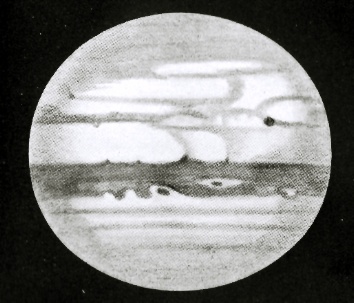
(Bildquelle: Buch "Der
Sterne Bahn und Wesen" von Max
Valier, 1924)
Jupiter nach Zeichnung am großen Fernrohr
Jupiter nach Zeichnung am großen Fernrohr
Betrachtung Jupiters
Es ist zweckmäßig,
den größten Neptoiden einer
eigenen Betrachtung zu unterziehen. Sein Äußeres ist
von allen Planeten am leichtesten zu studieren und daher mit
Rücksicht auf seine große Entfernung nach demjenigen des
Mars am besten bekannt. Dennoch hat es besondere Umstände
bedurft, um zu wesentlichen Fortschritten zu gelangen. Das
achromatische Fernrohr tat es nicht allein; es mußten sich
Spezialisten an einzelnen Observatorien finden, denen Feinarbeiten der
einschlägigen Art gelangen, und es mußte das Phänomen
des "großen roten Flecks" im Jahre 1878 einen Anlaß zu
reizvollen Überwachungen geben; vom Jahre 1889 an hatte der
36-Zöller der Licksternwarte neue Details der Planetenscheibe
kennen gelernt und von 1895 an haben die Observatorien zu Lussin und
Landstuhl das Beispiel einiger Engländer übertreffend
besonders eingehend deren Bestand verfolgt.
Durch schwierige und
langwierige Untersuchungen ist man so zu der
Erkenntnis gelangt, daß Jupiter nur parallel zu seinem
Äquator liegende Streifen und Zonen besitzt, daß
Schrägstellungen, wie sie früher des öfteren gezeichnet
wurden (1860, 1870/71), optische Täuschungen sind und daß
eine deutliche fleischrote bis rotgelbe und sogar violette Färbung
innerhalb der dunklen Streifen vorherrscht, wie neuerdings 1907 wieder
in augenfälliger Deutlichkeit. Diese sind vornehmlich in
niederen Breiten als zwei mächtige Äquatorbänder mit
jedem kleinen Instrumente erreichbar; in höheren Breiten gibt es
nur schmale Streifchen und ebensolche hellere Zonen, so daß
eigentlich der ganze Planet von zum Äquator parallelen
Ringflächen umgeben ist.
Dieser selbst wird von einer stabilen und hervorstechenden Zone eingenommen, deren Farbe etwas blaßcréme ist, wogegen die zwei gemäßigten Zonen ziemlich weiß genannt werden können. Der südliche, benachbarte Gürtel ist gewöhnlich recht dunkel (rot nach violett, bräunlich und gelb hin) und seit Jahrzehnten unverändert; sein nördliches Gegenstück aber macht allerlei Phasen durch und ist bald so schmal, daß es kaum gesehen wird (1905/06), bald ist es breiter, dunkler und im innern veränderlicher als der Südgürtel (1902, 1906/07). Innerhalb beider kommen vornehmlich an den Rändern wolkige, dunkle Verdichtungen reihenweise und einzeln bis zu großer Ausdehnung vor, innerhalb der hellen, besonders der Äquatorzonen ebensolche Ketten von hellen bis weißlichen Flecken.
Alle besitzen eine eigentümliche und im Sinne der Rotation vorausgerichtete Bewegung, die vom Äquator nach höheren Breiten hin abnimmt. Polwärts werden naturgemäß auch Färbung und Begrenzung der Zonen matter und scheinen jenseits etwa +- 60° undefinierbar zu werden, was gewiß zum Teil der schrägen Projektion zur Last fällt.
Nahe der Scheibenmitte ist das lebendige Pulsieren der Vorgänge oft ganz leicht zu erkennen. Details ähnlicher Art kommen zwar auch bis in hohe Breiten - 50° und mehr - vor, aber sie sind wohl physisch wie optisch nicht bestimmt genug begrenzt, um mit ähnlicher Genauigkeit überwacht zu werden wie die subtropischen Fleckchen. Von dem riesigen Umfange solcher Vorgänge mag man sich aus der Angabe einen Begriff machen, daß das kleinste noch verfolgbare Fleckchen mindestens 2000 km Durchmesser, das feinste erkennbare Streifchen wenigstens 1000 km Breite haben muß; es kommen aber Flecken von 5-10 fachem Maße vor, wiewohl nicht zu leugnen ist, daß sie zumteil wohl nur flockige Ansammlungen kleinerer Fleckchen sind.
Dieser selbst wird von einer stabilen und hervorstechenden Zone eingenommen, deren Farbe etwas blaßcréme ist, wogegen die zwei gemäßigten Zonen ziemlich weiß genannt werden können. Der südliche, benachbarte Gürtel ist gewöhnlich recht dunkel (rot nach violett, bräunlich und gelb hin) und seit Jahrzehnten unverändert; sein nördliches Gegenstück aber macht allerlei Phasen durch und ist bald so schmal, daß es kaum gesehen wird (1905/06), bald ist es breiter, dunkler und im innern veränderlicher als der Südgürtel (1902, 1906/07). Innerhalb beider kommen vornehmlich an den Rändern wolkige, dunkle Verdichtungen reihenweise und einzeln bis zu großer Ausdehnung vor, innerhalb der hellen, besonders der Äquatorzonen ebensolche Ketten von hellen bis weißlichen Flecken.
Alle besitzen eine eigentümliche und im Sinne der Rotation vorausgerichtete Bewegung, die vom Äquator nach höheren Breiten hin abnimmt. Polwärts werden naturgemäß auch Färbung und Begrenzung der Zonen matter und scheinen jenseits etwa +- 60° undefinierbar zu werden, was gewiß zum Teil der schrägen Projektion zur Last fällt.
Nahe der Scheibenmitte ist das lebendige Pulsieren der Vorgänge oft ganz leicht zu erkennen. Details ähnlicher Art kommen zwar auch bis in hohe Breiten - 50° und mehr - vor, aber sie sind wohl physisch wie optisch nicht bestimmt genug begrenzt, um mit ähnlicher Genauigkeit überwacht zu werden wie die subtropischen Fleckchen. Von dem riesigen Umfange solcher Vorgänge mag man sich aus der Angabe einen Begriff machen, daß das kleinste noch verfolgbare Fleckchen mindestens 2000 km Durchmesser, das feinste erkennbare Streifchen wenigstens 1000 km Breite haben muß; es kommen aber Flecken von 5-10 fachem Maße vor, wiewohl nicht zu leugnen ist, daß sie zumteil wohl nur flockige Ansammlungen kleinerer Fleckchen sind.
Wichtig für die
Beurteilung der Bewegungen auf Jupiter ist der
krasse Unterschied zwischen der Nord- und der Südhalbkugel: Dort
wesentlicher und häufiger Wechsel in der Breite und Tönung
der Bänder, hier große Stabilität in der Breite und
Lage, und Gleichförmigkeit im regelmäßigen
Geschehen. Die Bänder der Nordsphäre, besonders die dem
breiteren Gürtel benachbarten, werden oft fadendünn und
verschwinden ganz; oft erscheinen sie in eine lose oder reicher
besetzte Reihe von länglichen Flecken aufgelöst, entweder um
allmählich völlig zu verblassen, oder um in rascher Folge von Tagen und Wochen einen
mächtigen Reifen um den Planeten zu legen, dessen Breite oft 6000
km beträgt bei einer Gesamtlänge von 450 000 km.
Ist so die ungeheure Ausdehnung der betroffenen Region in anbetracht der kurzen Zeit des Vorganges ein schwerwiegender Gesichtspunkt bei der Deutung des Geschehens, so ist die fast ausschließlich vorwärts (rechtsläufig) gerichtete Tendenz der Eigenbewegung der andere, ebenso gewichtige Gesichtspunkt; beide mit dem Wechsel von hellen (bis weißlichen) und dunklen (bis schwärzlichen) Flecken so zu vereinigen, daß die ungeheure Größe der Planetenkugel, ihre zebraähnliche Zeichnung, ihre Gesamtdichte, ihre Abplattung und ihre überraschend kurze Rotationsperiode zugleich aus
einheitlichem Gesichtspunkte aufgeklärt werden, ist die Aufgabe einer Kosmologie Jupiters.
Innerhalb derselben ist die Erscheinung des ehemals sogenannten "Gr. R. Fleckes" nur ein Programmpunkt, dessen Färbung, wie überhaupt die Färbung der dunklen Gürtel ein anderer. Dieses Objekt, welches im Jahre 1878 wohl 45000 km lang war (1907 noch 36000 km), ein elliptisches Gebilde, dessen große Achse etwa so lang ist wie der Erdäquator, griff mit so nachhaltigem Erfolge in die Anordnung der Gürtel der Südsphäre ein, daß heute (1907) noch die große Bucht, welche die Breite des Südäquatorbandes auf weniger als die Hälfte verringerte, in unveränderter Form vorhanden ist. War auch die Färbung vor 29 Jahren nicht gerade ziegelrot, wie gewisse Zeichnungen sie darstellen, so ist doch kein Zweifel, daß sie im stärksten Maße abgenommen hat, denn heute (1907) ist das Objekt so abgebleicht, daß nur noch ein leicht rauchgrauer Umriß sein Dasein verrät. Es ist interessant, diesen Farbenwechsel, dessen Endstadium heute ein Bleichen ist, mit ähnlichen Vorgängen auf dem Monde zu vergleichen.
Wenn der (neueste) Newcomb-Vogel sagt: "Im allgemeinen ist die südliche Hemisphäre des Jupiter größeren Veränderungen unterworfen als die nördliche", so ist damit wohl auf den großen Fleck bezuggenommen; außerdem gibt es nämlich nur noch in der benachbarten gemäßigten Zone seit einigen Jahren eine Gruppe von dunklen Flecken mit bestimmter Bewegung, während die andere Halbkugel ununterbrochen viel weitergehende Änderungen erleidet.
Sie allein treten periodisch auf und diejenigen der Südhemisphäre nicht; es wirken die Ursachen hier stetig und fortwährend, so daß eben das Aussehen der Südgürtel sozusagen unverändert bleibt.
Ist so die ungeheure Ausdehnung der betroffenen Region in anbetracht der kurzen Zeit des Vorganges ein schwerwiegender Gesichtspunkt bei der Deutung des Geschehens, so ist die fast ausschließlich vorwärts (rechtsläufig) gerichtete Tendenz der Eigenbewegung der andere, ebenso gewichtige Gesichtspunkt; beide mit dem Wechsel von hellen (bis weißlichen) und dunklen (bis schwärzlichen) Flecken so zu vereinigen, daß die ungeheure Größe der Planetenkugel, ihre zebraähnliche Zeichnung, ihre Gesamtdichte, ihre Abplattung und ihre überraschend kurze Rotationsperiode zugleich aus
einheitlichem Gesichtspunkte aufgeklärt werden, ist die Aufgabe einer Kosmologie Jupiters.
Innerhalb derselben ist die Erscheinung des ehemals sogenannten "Gr. R. Fleckes" nur ein Programmpunkt, dessen Färbung, wie überhaupt die Färbung der dunklen Gürtel ein anderer. Dieses Objekt, welches im Jahre 1878 wohl 45000 km lang war (1907 noch 36000 km), ein elliptisches Gebilde, dessen große Achse etwa so lang ist wie der Erdäquator, griff mit so nachhaltigem Erfolge in die Anordnung der Gürtel der Südsphäre ein, daß heute (1907) noch die große Bucht, welche die Breite des Südäquatorbandes auf weniger als die Hälfte verringerte, in unveränderter Form vorhanden ist. War auch die Färbung vor 29 Jahren nicht gerade ziegelrot, wie gewisse Zeichnungen sie darstellen, so ist doch kein Zweifel, daß sie im stärksten Maße abgenommen hat, denn heute (1907) ist das Objekt so abgebleicht, daß nur noch ein leicht rauchgrauer Umriß sein Dasein verrät. Es ist interessant, diesen Farbenwechsel, dessen Endstadium heute ein Bleichen ist, mit ähnlichen Vorgängen auf dem Monde zu vergleichen.
Wenn der (neueste) Newcomb-Vogel sagt: "Im allgemeinen ist die südliche Hemisphäre des Jupiter größeren Veränderungen unterworfen als die nördliche", so ist damit wohl auf den großen Fleck bezuggenommen; außerdem gibt es nämlich nur noch in der benachbarten gemäßigten Zone seit einigen Jahren eine Gruppe von dunklen Flecken mit bestimmter Bewegung, während die andere Halbkugel ununterbrochen viel weitergehende Änderungen erleidet.
Sie allein treten periodisch auf und diejenigen der Südhemisphäre nicht; es wirken die Ursachen hier stetig und fortwährend, so daß eben das Aussehen der Südgürtel sozusagen unverändert bleibt.
Wir sahen von Schwärmen
galaktischen Eises, das in 12
jährigen Intervallen heranschwebt, einen Impuls auf die
Jupiterkugel ausgeübt, der um so häufiger und mit um so mehr
Effekt fühlbar werden mußte, zu je größeren
Dimensionen der Planet anwuchs. Seine Anziehung holte mehr
Eismassen herbei und an einem längeren Radius konnten diese umso
leichter ihre kinetische Energie des Falles in Rotationsenergie
umwandeln. Heute (1907) beträgt die Dauer der Umdrehung nur
9,92 Stunden, so daß ein Punkt des Jupiteräquators eine
Geschwindigkeit von 12000 m besitzt und damit eine bedeutende
Gegenwirkung zur Schwere erzielt wird. Auch wenn der Planet eine
atmosphärische Umhüllung besäße, wäre wohl
die Wirkung der Sonne zu matt, als daß sie Eis auf ihm schmelzen
könnte; 5,2 fache Entfernung gibt 27 mal weniger Erleuchtung und
ähnliche Wärmeminderung. Aber aus früher
angegebenen Gründen kann Jupiter gar keine Atmosphäre
gebildet haben und ist somit fast schutzlos der niedrigen
Weltraumtemperatur ausgesetzt. Eine auf unserem
Atmosphärendiagramme (hier nicht aufgeführt - WFG)
gekennzeichnete und wesentliche Wasserstoffhülle besitzt Jupiter
trotzdem; nur ist sie in keinem Stücke mit der irdischen
Lufthülle zu vergleichen.
Die vielfach gehegte Annahme einer dichten Wolkenhülle um einen noch etwas rotglühenden Kern ist auf wenig stichhaltige Voraussetzungen zurückzuführen. Muß die Veränderlichkeit der Zeichnung etwa auf Wolken und die rote Farbe des großen Flecks auf Glut zurückgeführt werden?
Aus welchem Grunde sollte sich "etwas den Wolken- und Regenzonen unserer Erde Analoges" so haarscharf in 30 und mehr Ringzonen scheiden?
Es ist richtig, daß die äußerliche "physische Beschaffenheit des Planeten eine gewisse Ähnlichkeit mit der Sonne zu haben scheint"; aber muß deshalb auch Jupiter eine Glutmasse sein? Diese Analogien sind aus Verlegenheitsgründen erfunden und verdienen nur vorübergehende Erwähnung, weil sie nicht einmal auf konsequenter Durchführung eines aus einer Reihe von Beobachtungstatsachen gewonnenen Gedankens beruhen.
Die vielfach gehegte Annahme einer dichten Wolkenhülle um einen noch etwas rotglühenden Kern ist auf wenig stichhaltige Voraussetzungen zurückzuführen. Muß die Veränderlichkeit der Zeichnung etwa auf Wolken und die rote Farbe des großen Flecks auf Glut zurückgeführt werden?
Aus welchem Grunde sollte sich "etwas den Wolken- und Regenzonen unserer Erde Analoges" so haarscharf in 30 und mehr Ringzonen scheiden?
Es ist richtig, daß die äußerliche "physische Beschaffenheit des Planeten eine gewisse Ähnlichkeit mit der Sonne zu haben scheint"; aber muß deshalb auch Jupiter eine Glutmasse sein? Diese Analogien sind aus Verlegenheitsgründen erfunden und verdienen nur vorübergehende Erwähnung, weil sie nicht einmal auf konsequenter Durchführung eines aus einer Reihe von Beobachtungstatsachen gewonnenen Gedankens beruhen.
Über die ungeheuren
Wasserkugel Jupiters wölbt sich eine
mächtige Eiskruste, die den eigenartigen Verhältnissen der
Schwere, der Trabanten- und Sonnenanziehung und der Störungen
durch Eiszufluß entsprechend vielfach geborsten ist. Die
aus allen genannten Gründen notwendig parallel dem Äquator
liegenden Bruchlinien oder Richtungen
beständiger Störungen konnten nie zufrieren und
blieben die am leichtesten verwundbaren Stellen des Planeten. Ist
die Eisschale noch so dich geworden, so muß an den "Rissen" oder
in den Breiten, wo ihre äußerste Schichte in
größerer Ausdehnung zertrümmert erscheint, immer wieder
Gelegenheit zu Wasseraustritten aus nur leicht überfrorenen
Gürteln gegeben sein. Je näher zum Äquator, desto
weniger Ruhe und Bestand zeigt die Kruste. Sahen wir schon die
kleine Erde befähigt, eine große Menge galaktischer und
meteorischer Körper auf sich zu lenken, obwohl so nahe der Sonne
die Schnelligkeit ihres "Vorüberfallens" sehr bedeutend ist, so
muß der 300mal so massenreiche Jupiter, zumal in fast
störungsfreiem Sonnenabstande ganz
unverhältnismäßig viel mehr Fremdlinge
aufsammeln. Sein Trabantenreich, das 5 mal, und wenn man den in
diesem Falle durchaus nicht nebensächlichen Kleinmond VI
berücksichtigt, sogar gut 27 mal so weit hinausreicht als der Mond
von der Erde absteht, hilft die aus zahlreichen Gegenden des
Himmelsraumes herankommenden Boliden in die Ebene der eigenen Bahnen
hinanziehen, soweit dazu
Zeit bleibt. Naturgemäß muß die Mehrzahl
derselben in mittleren oder gar niederen Breiten anlangen und ihren
Rest von Tangentialbewegung in Rotationsantrieb verwandeln. Die
Kleinheit der Körper verbürgt aber ihre Kurzlebigkeit, so
daß höchst selten einer in die Äquatorzone gelangen
wird. Eine gewisse
Durchschnittsgröße muß aber wohl angesichts der bestimmten in der heutigen
Trabantenschar vorhandenen Anbequemungskraft und ebenso bei dem Mangel
einer primären Eigengeschwindigkeit
der galaktischen Körper auch eine gewisse
mittlere Angewöhnung
an die Ebene der Trabanten und daraus folgend, eine gewisse jovigraphische
Breite des schließlichen Einschlags bevorzugen, wobei sich
allerdings periodische Verschiebungen dieses Gürtels einstellen
können. Wir sehen somit zumeist zwei in niederen Breiten
gelegene breite Gürtel maximaler Unruhe, die sich gelegentlich
zusammenziehen und wieder trennen. Kommen aus dem galaktischen
Eisschleier (Eismilchstraße) eine längere Zeit hindurch
größere Eisboliden, so werden sich beide Gürtel
näher rücken, bei längerem Niedergehen von
durchschnittlich kleineren Massen werden sie sich nach höheren
Breiten verschieben und damit allerdings ein Bild der
Veränderungen geben, wie es dem Sinne nach ganz genau auch die
Sonnenoberfläche darbietet.
Ein permanenter Eishagel auf
Jupiter würde gleichwohl kaum
verhindern, daß der Planet eine gleichmäßige Kruste
bekäme. Die alt über kommenen Wunden offen zu halten
wirken aber noch mehrere Umstände. Es kann hier und da auch
einmal ein wuchtiger Einschlag erfolgen, den wir gleichwohl nicht mit
Augen sehen würden, weil dazu offenbar der kleine Trabant allzu
klein wäre; wir sahen aber, daß die lebendige Kraft eines
mit im Kosmos möglicher Geschwindigkeit ankommenden Körpers
riesig ist im Vergleich zu seinem bescheidenen Aussehen. Zumal
wenn gar ein Weltkörper von den Dimensionen eines der uns
bekannten Trabanten seinen Lauf vollendete, müßte die
zerstörende Wirkung auf der Oberfläche Jupiter tiefgehende
Folgen ausüben, so daß derartige "Katastrophen" sehr selten
und doch sehr nachhaltig in ihrem Effekte sein können.
Daß die immerhin großen Monde I, II, III und IV eine gerade
bei dem Wasserplaneten fühlbare Flut erzeugen werden, die im
Vereine mit der Sonnenflut eine beständige leise Bewegung des
leicht beweglichen Wassers erhalten werden, sei nur kurz
erwähnt. Aus welchem Grunde aber die Torsionen,
Beschleunigungen und Beunruhigungen entspringen mögen, immerhin
können sie eine Aufteilung des Planetenäußeren in genau
parallele Zonen zuwegebringen, was aus einer Art Passatströmung
niemals folgen könnte.
Sind also die
"Königszonen" Jupiters statistisch noch so nahe an
diejenigen der Sonne heranzubringen, ja, haben wir sogar dieselbe Quelle für
beide Endwirkungen herangezogen, so braucht deshalb Jupiter der Sonne noch nicht
wesensgleich zu sein. Dieselbe Halbheit der Folgerung, wie
wir sie hier rügen, bestand auch, als probeweise das Jupiterjahr
für die Sonnenfleckenperiode in Anspruch genommen und wieder
fallen gelassen wurde; auch wir machen Jupiter für die Länge
jener einfachen Periode verantwortlich, nur lassen wir ihn keine Fluten
erzeugen, sondern wir ordnen beide Körper in der einem jedem
zukommenden Weise dem großartigen Ausflusse jener
Gesetzmäßigkeit unter, die wir im ganzen Weltall und
für uns am interessantesten auch im Sonnenreiche die Materie
dirigieren sehen.
Wie dort die "Vernunft", die theoretisch in der Betrachtung steckte, zum "Unsinn" ward, weil die Praxis auf Nichtigkeiten der x-ten Dezimalstelle bei sehr endlichen Werten nichts gibt, so wird hier der Unsinn, den jemand in der Grundlinie der glacialkosmogonischen Betrachtung erkennen wollte, zur Vernunft, weil wir zeigen konnten, wie, wie stark und mit welchen Folgen das Größere und Allgemeinere, das Gesetz, über das Beschränktere, den Stoff, Gewalt ausübt.
Die kosmische Zeit, die nie Eile hat, klärt erst die intimsten Vorgänge auf; möge der ernste Wahrheitssucher sich die geringe Zeit nicht gereuen lassen, die nötig ist, um vom unbeirrten Walten dieser Gesetzmäßigkeit die Wahrheit zu lernen.
Wie dort die "Vernunft", die theoretisch in der Betrachtung steckte, zum "Unsinn" ward, weil die Praxis auf Nichtigkeiten der x-ten Dezimalstelle bei sehr endlichen Werten nichts gibt, so wird hier der Unsinn, den jemand in der Grundlinie der glacialkosmogonischen Betrachtung erkennen wollte, zur Vernunft, weil wir zeigen konnten, wie, wie stark und mit welchen Folgen das Größere und Allgemeinere, das Gesetz, über das Beschränktere, den Stoff, Gewalt ausübt.
Die kosmische Zeit, die nie Eile hat, klärt erst die intimsten Vorgänge auf; möge der ernste Wahrheitssucher sich die geringe Zeit nicht gereuen lassen, die nötig ist, um vom unbeirrten Walten dieser Gesetzmäßigkeit die Wahrheit zu lernen.
Es wäre nun naheliegend,
auch die Periode der Änderungen auf
Jupiters Oberfläche schlankweg als das Jupiterjahr zu bezeichnen;
das ist nicht einmal neu und auch die versuchten Nachweise aus dem
zeichnerisch vorliegenden Beobachtungensmaterial sind nicht neu und
blieben nicht einmal ganz erfolglos.
Prof. F. Zöllner hat schon vor mehr als dreißig Jahren (ca. 1877) vermutet, "daß es bei den heftigen Bewegungen und den mannigfach wechselnden Gestaltungen auf der Oberfläche Jupiters zu erwarten sein würde, auch in diesen Veränderungen eine mit der Häufigkeit der Sonnenflecke zusammenhängende Periode wiederzufinden." Ranyard stellte sodann nach Dr. Hahn "geradezu die Behauptung auf, daß verschiedene eigentümliche Erscheinungen und Gebilde auf dem Jupiter nur in den Zeiten der Fleckenmaxima aufträten, in den Minimalzeiten aber fehlten." Er meinte besondere Verdunkelung der Streifen, eigentümliche rotbraune Färbung der Äquatorgürtel und das Vorkommen eiförmiger, weißer Wolken in der Äquatorzone.
Prof. Lohse endlich hat den Wechsel durch eine ganze Reihe von Fleckenperioden hindurch verfolgt und bestätigt gefunden, soweit ihn das dürftige zeichnerische Material bestätigen ließ. Aber wenn auch diejenigen Jupiterzeichnungen, welche vor den letzten 20-30 Jahren liegen, nicht gar so dürftig in ihrem Inhalte und gar so unzweckmäßig in der Darstellung wären, so hätte die Periode doch verschleiert werden müssen, und uns liegt nun daran, zu sagen, warum der Vermutung einer einfach 12jährigen Periode der Streifenbildung immer wieder ein Zweifel anhaften blieb. Wo anders als in der Sonne könnte nach der üblichen Vorstellung die Quelle der variablen Zustände liegen? Man verließ aber auch diesen quantitativ nicht ausreichenden Einfall und sagte - genau wie inbezug auf die Königszonen der Sonne - es müßten wohl Strömungen vom Innern des Planeten heraus schuld sein - wieder nichts als eine bloße Vermutung.
Prof. F. Zöllner hat schon vor mehr als dreißig Jahren (ca. 1877) vermutet, "daß es bei den heftigen Bewegungen und den mannigfach wechselnden Gestaltungen auf der Oberfläche Jupiters zu erwarten sein würde, auch in diesen Veränderungen eine mit der Häufigkeit der Sonnenflecke zusammenhängende Periode wiederzufinden." Ranyard stellte sodann nach Dr. Hahn "geradezu die Behauptung auf, daß verschiedene eigentümliche Erscheinungen und Gebilde auf dem Jupiter nur in den Zeiten der Fleckenmaxima aufträten, in den Minimalzeiten aber fehlten." Er meinte besondere Verdunkelung der Streifen, eigentümliche rotbraune Färbung der Äquatorgürtel und das Vorkommen eiförmiger, weißer Wolken in der Äquatorzone.
Prof. Lohse endlich hat den Wechsel durch eine ganze Reihe von Fleckenperioden hindurch verfolgt und bestätigt gefunden, soweit ihn das dürftige zeichnerische Material bestätigen ließ. Aber wenn auch diejenigen Jupiterzeichnungen, welche vor den letzten 20-30 Jahren liegen, nicht gar so dürftig in ihrem Inhalte und gar so unzweckmäßig in der Darstellung wären, so hätte die Periode doch verschleiert werden müssen, und uns liegt nun daran, zu sagen, warum der Vermutung einer einfach 12jährigen Periode der Streifenbildung immer wieder ein Zweifel anhaften blieb. Wo anders als in der Sonne könnte nach der üblichen Vorstellung die Quelle der variablen Zustände liegen? Man verließ aber auch diesen quantitativ nicht ausreichenden Einfall und sagte - genau wie inbezug auf die Königszonen der Sonne - es müßten wohl Strömungen vom Innern des Planeten heraus schuld sein - wieder nichts als eine bloße Vermutung.
Wir wollen die einfach
Aufklärung glacialkosmogonisch geben: Wenn
der Niederschlag galaktischer Eismassen die Züge auf Jupiter
zeichnet, so müssen sich auch die Phasen des Hereinschwebens
dieser Massen auf dem Planeten bemerklich machen. Diese sind aber
bedingt durch den jeweiligen und wechselnden, sich in der
verschiedensten Weise kombinierenden und in verschiedenem Grade
unterstützenden Einfluß der Planeten Neptun, Saturn und
Uranus, welche intermittierend und in wechselnder Richtung das
Eismaterial schubweise heran- und in den allgemeinen Planetenwirbel
hereinziehen. Diesen verwischenden Einfluß zu klären
wäre eher möglich, wenn man die Zeit wüßte, die
ein Eisschleierfetzen braucht, um in planetarischer Nähe zu kommen
und welche Zeit für ihn nötig ist, um von da in Spiralbahnen
zu den Massenansammlungen, hier zu Jupiter zu gravitieren.
Vorläufig aber kann die 12jährige Periode nur in stark
verschleierter Form zum Ausdrucke kommen.
Wonaszek hat im Jahre 1901 eine Periode von 11,76 Jahren befürwortet und einen derartigen Gang der maximalen (1856, 1867,9, 1879,7, 1891,7, 1903) und minimalen (1861, 1873,3, 1884,1, 1896,4) Streifenentwicklung namhaft gemacht, daß zwischen Minimum und Maximum 6,9 Jahre liegen und zwischen Maximum und Minimum 4,9 Jahre. Wörtlich genommen ist das das Gegenteil des Verlaufes auf der Sonne; es liegt daher nahe, ähnliche Endwirkungen ähnlich zu bezeichnen und die Zusammenziehung der dunklen Bänder auf die Äquatorgegend als Maximum zu bezeichnen. Dann sieht man auch auf Jupiter das Maximum rasch ansteigen und langsam sich verflachen. Aus den von Wonaszek angegebenen Bahnorten Jupiters im Krebs und mitten im Wassermann zu den Zeiten des Minimums und Maximums wäre beiläufig zu entnehmen, daß der apexseitig aufgefangene Eisstrom in seinen kleinen Partikeln ca. 6 1/2 Jahre, in seinen größeren ca. 7 1/2 - 8 Jahre mehr (14 - 14 1/2 Jahre) benötigte, um die Nahrung aufzuzehren, wobei wie im Falle der Sonne die letzten und neuerdings wieder ersten Einschläge sich überlagern. - In ähnlicher Weise hat 1905 T. Köhl aus der wechselnden Intensität des Süd- (1871, 1882, 1893/96, 1904/05) und Nordbandes (1879, 1899, 1886/91) - beide etwa gleich abgeleitet, das das erstere zur Zeit der Sonnenfleckenmaxima deutlicher hervortritt; also auf einem kleinen Umwege das gleiche Resultat.
Sehen wir etwas genauer zu, so muß gleichwohl die nahezu 12jährige Voll-Periode wesentlich kompliziert sein. Wenn man nichts weiter inbetracht zieht, als die Beziehung der Lage der Ekliptik zur Apexrichtung der Sonnenbewegung und damit zugleich zur Ebene der Milchstraße, so erscheinen die von dorther kommenden Einflüsse noch einfach. Wenn Jupiter im Schützen unter dem Sonnenapexorte vorbeizieht und dabei die Milchstraßenebene durchquert, so wird er mehr einen Teil des direkten Zuflusses des galaktischen Grobeises zu sich herablenken; und wenn er beim Eintritt in die Zwillinge in die Richtung des Antiapex gerät, so muß er den dichteren Kegelmantel des von Süden und von rückwärts her ein wenig heraufgebogenen Eisstromes passieren, also eine Menge galaktisches Feineis "herauflenkend" gewinnen. In jenem Falle dauert der spiralige Niedergang - obwohl "6" Jahre früher eingeleitet -, durchschnittlich viel länger, in diesem Falle relativ kurze Zeit, wie es nach den Gesichtspunkten des Ätherwiderstandes erforderlich ist. In jedem Falle aber kann eine deutlich ausgeprägte Halb-Periode noch weniger klar auftreten als die Voll-Periode, weil zu den aus Einflüssen der drei äußeren Neptoiden (Saturn, Uranus, Neptun) entstehenden Verschwommenheiten der Intensitätskurve auch noch die verschiedene Stromdichte gegen Apex und Antiapex hin kommt und der Zustrom auf Jupiter in verschiedenem Grade verzögert wird. Indem nun der antiapexseitige Zustrom geometrisch-räumlich an sich dichter gedrängt ist und zugleich aus naturgemäß zahlreicheren Individuen besteht, so muß aus ähnlichem Grunde wie bei der Sonne auch Jupiter auf seiner Südseite von einem dichteren, feineren und andauernden Eishagel getroffen werden, woraus sich die Permanenz des dominierenden Südgürtels im allgemeinen erklärt.
Wonaszek hat im Jahre 1901 eine Periode von 11,76 Jahren befürwortet und einen derartigen Gang der maximalen (1856, 1867,9, 1879,7, 1891,7, 1903) und minimalen (1861, 1873,3, 1884,1, 1896,4) Streifenentwicklung namhaft gemacht, daß zwischen Minimum und Maximum 6,9 Jahre liegen und zwischen Maximum und Minimum 4,9 Jahre. Wörtlich genommen ist das das Gegenteil des Verlaufes auf der Sonne; es liegt daher nahe, ähnliche Endwirkungen ähnlich zu bezeichnen und die Zusammenziehung der dunklen Bänder auf die Äquatorgegend als Maximum zu bezeichnen. Dann sieht man auch auf Jupiter das Maximum rasch ansteigen und langsam sich verflachen. Aus den von Wonaszek angegebenen Bahnorten Jupiters im Krebs und mitten im Wassermann zu den Zeiten des Minimums und Maximums wäre beiläufig zu entnehmen, daß der apexseitig aufgefangene Eisstrom in seinen kleinen Partikeln ca. 6 1/2 Jahre, in seinen größeren ca. 7 1/2 - 8 Jahre mehr (14 - 14 1/2 Jahre) benötigte, um die Nahrung aufzuzehren, wobei wie im Falle der Sonne die letzten und neuerdings wieder ersten Einschläge sich überlagern. - In ähnlicher Weise hat 1905 T. Köhl aus der wechselnden Intensität des Süd- (1871, 1882, 1893/96, 1904/05) und Nordbandes (1879, 1899, 1886/91) - beide etwa gleich abgeleitet, das das erstere zur Zeit der Sonnenfleckenmaxima deutlicher hervortritt; also auf einem kleinen Umwege das gleiche Resultat.
Sehen wir etwas genauer zu, so muß gleichwohl die nahezu 12jährige Voll-Periode wesentlich kompliziert sein. Wenn man nichts weiter inbetracht zieht, als die Beziehung der Lage der Ekliptik zur Apexrichtung der Sonnenbewegung und damit zugleich zur Ebene der Milchstraße, so erscheinen die von dorther kommenden Einflüsse noch einfach. Wenn Jupiter im Schützen unter dem Sonnenapexorte vorbeizieht und dabei die Milchstraßenebene durchquert, so wird er mehr einen Teil des direkten Zuflusses des galaktischen Grobeises zu sich herablenken; und wenn er beim Eintritt in die Zwillinge in die Richtung des Antiapex gerät, so muß er den dichteren Kegelmantel des von Süden und von rückwärts her ein wenig heraufgebogenen Eisstromes passieren, also eine Menge galaktisches Feineis "herauflenkend" gewinnen. In jenem Falle dauert der spiralige Niedergang - obwohl "6" Jahre früher eingeleitet -, durchschnittlich viel länger, in diesem Falle relativ kurze Zeit, wie es nach den Gesichtspunkten des Ätherwiderstandes erforderlich ist. In jedem Falle aber kann eine deutlich ausgeprägte Halb-Periode noch weniger klar auftreten als die Voll-Periode, weil zu den aus Einflüssen der drei äußeren Neptoiden (Saturn, Uranus, Neptun) entstehenden Verschwommenheiten der Intensitätskurve auch noch die verschiedene Stromdichte gegen Apex und Antiapex hin kommt und der Zustrom auf Jupiter in verschiedenem Grade verzögert wird. Indem nun der antiapexseitige Zustrom geometrisch-räumlich an sich dichter gedrängt ist und zugleich aus naturgemäß zahlreicheren Individuen besteht, so muß aus ähnlichem Grunde wie bei der Sonne auch Jupiter auf seiner Südseite von einem dichteren, feineren und andauernden Eishagel getroffen werden, woraus sich die Permanenz des dominierenden Südgürtels im allgemeinen erklärt.
So einfach kann man die
Sachlage aber gar nicht einmal auffassen,
nachdem die fast quer zur Flugrichtung aufgestellte Ebene der Ekliptik,
deren Massenschwerpunkt, die Sonne, überdies nördlich bereits
aus der galaktischen Ebene herausgetreten ist, den Eisschleierkonus so
zusammenzieht, daß das ungemein flach "aufwärts"
(nordwärts) gebogene Ende des Kegelraumes der galaktischen Massen
"von unten her" gegen die Sonne gerichtet ist. Die Knotenlinie
der Ekliptik mit diesem Konus ist geknickt und Jupiter durchfährt
den Mantel seines Raumes nicht in einem Bogen von 180°, sondern
etwa nur in der Länge eines Quadranten.
Indem nun der Reichtum des Zustromes nach Ausweis der Figuren und ihrer
Erläuterungen auf eine gewisse Breite ausgedehnt ist, kommen
hauptsächlich zwei um gut 3 Jahre auseinanderliegende, qualitativ
und quantitativ unterscheidbare physische Konjunktionen Jupiters mit
galaktischen Massen inbetracht, wenn er nämlich 2mal den
Kegelmantel ihres Strömungsbereiches durchquert.
Gegenüber dem, was der Planet inmitten beider Tangierungen durch
Gravitationswirkung gegen sich "herablenkt", wie er denn auch 6 Jahre
später einen Strom "herauslenkt", ist dasjenige, was er in unmittelbarer Nachbarschaft des
Eisschleiermantels zweimal erwirbt und verarbeitet, völlig
überwiegend.
Genau besehen existieren also inbezug auf die Beeinflussung der Veränderlichkeit der Jupiteroberfläche vier Umstände, nämlich die Passage der Apex- und Antiapexseite des Sonnenfluges und die beiden Berührungen des Eisschleiermantels vor und nach der Apexpassage. Die letzteren geben der "Jupitertätigkeit" das Gepräge und es ist begreiflich, daß deren Periode nicht so klar aus den Streifen des Planeten abzulesen ist, wie die Sonnenperiode aus Zahl und Zug der Flecken.
Genau besehen existieren also inbezug auf die Beeinflussung der Veränderlichkeit der Jupiteroberfläche vier Umstände, nämlich die Passage der Apex- und Antiapexseite des Sonnenfluges und die beiden Berührungen des Eisschleiermantels vor und nach der Apexpassage. Die letzteren geben der "Jupitertätigkeit" das Gepräge und es ist begreiflich, daß deren Periode nicht so klar aus den Streifen des Planeten abzulesen ist, wie die Sonnenperiode aus Zahl und Zug der Flecken.
Nun findet sich in der
südlich gemäßigten Zone das
riesige Gebilde des ehemals roten Flecks, das einerseits von dem
Einschuß eines sehr bedeutenden transneptunischen Planetoiden
herrühren dürfte, andererseits aber in einer relativ hohen
Breite liegt. Wir weisen aber darauf hin, daß hier als
primäre Ursache eine starke Bahnneigung vorgelegen haben kann und
als sekundäre Ursache eine besondere Störung der Bahn, so
daß der Planetoid vielleicht durch besonderes Zusammentreffen von
Umständen die Oberfläche nicht in niedrigster Breite
berührte. Eine Ausnahme von der Regel kann den Hergang als
solchen nicht alterieren; es kann ja auch irgend eine Körper
retrograd in das Jupitergebiet eintreten, wie wir am VII. Trabanten
sehen, und wird beim Niedergang einen retrograd bewegten Fleck, zum
mindesten aber eine Art Stauung der oberflächigen Bewegung
hervorbringen. - Die Färbung des Flecks kann uns nicht in
Verlegenheit bringen. Wir erkannten, daß "heliotischer
Staub" aus der Chaoswolke (Entstehung
unseres Sonnenreiches) radial hinausgeblasen, d.h. mitgerissen
wurde und daß sich um solche Kleinkerne von beliebiger
mäßiger Größe Eismassen krystallisierten und
ansammelten. Die allerletzte Phase der Einverleibung eines
eisumkrusteten Weltkörpers wirkt zerstörend und
auflösend; somit ist erklärlich, daß das
Auflösungsprodukt den vorwiegend aus metall-, also auch
eisenhaltigen Massen bestehenden Kern zu einem rotgefärbten Brei
aufgelöst enthalten kann. Jedenfalls hat die Rötung mit
Glut nichts zu tun, sondern ist näher mit den rötlichen
Massen "kosmischen Staubes" auf unseren Schnee- und Eisfeldern und mit
dem roten Tiefseeschlamm verwandt.
Jupiters Scheibe erscheint am
Rande weniger hell als inmitten was man
der Absorption des Lichtes durch eine Gashülle glaubte zuschreiben
zu müssen. Ach neueste Spektrogramme des Planeten (Meudon
1904) weisen 5 Absorptionsbänder auf, sowie eine
Verstärkung der dem Spektrum des Wasserdampfes
entsprechenden Streifen; alle Streifen waren intensiver in dem Teile
des Spektrums, der von dem südlichen, damals stärksten
Äquatorgürtel herrührt. Unsere Angaben decken sich
also, wenn auch die übliche Auslegung abweicht. Es ist nicht
zu beweisen, daß eine Atmosphäre existiert; aber eine der
großen Jupitermasse entsprechende Hülle von Wasserstoffgas
muß vorhanden sein, wenn sie auch nur dünn ist; sie wird
wegen Temperatur und Oberflächenschwere etwa 1/15 - 1/5 des
Druckes der irdischen Atmosphäre ausüben, also etwa der
Dünnheit der Luft aus unseren höchsten Bergspitzen
entsprechen. Daß sie an der Kugeloberfläche relativ
"dicht" sei, ist eine natürliche Folge; daß sie im Vereine
mit einem wenn auch noch so feinen Eisdunstschleier rings um den
Planeten eine merkliche Absorption ausüben könne, ist
mindestens sehr wahrscheinlich, weil ja sogar von offenem Wasser auf
Jupiter geredet werden durfte und wir inbezug auf das Verhalten der
H-Hülle unter so niedriger Temperatur und unter so eigenartigen
Umständen nicht imstande sind, Gründe für das Gegenteil
anzugeben. Wie bei den glänzenden Mondkratern fällt
auch bei Jupiter die hohe Albedo (0,6 oder gar nach Witt 0,72!!) auf
und weist aus gleichem Effekte auf gleiche Ursache, die aber in unserem
Rückschlusse logisch begründet ist.
Die hochbedeutsame Stellung
Jupiters innerhalb der Reihe der Planten
ist offensichtlich. Der Riesenplanet vermag nicht bloß
einen großen Anteil am galaktischen Zufluß in das
Sonnensystem zu übernehmen und seine eigene Masse in einem hohen
Grade zu bereichern, sondern reguliert auch diesen Zufluß zur
Sonne hin.
Ebenso ist seine Bahnebene gleichsam die Ruhelage jener Pendelausschläge geworden, als welche man die schwankende Tendenz der übrigen Planetenbahnen, sich zum Sonnenfluge senkrecht aufzustellen, auffassen könnte; er allein reguliert durch seine überwiegende Masse und daraus folgende, genau begrenzte Tendenz einer bestimmten Neigung zu Veränderungen das stärkere Bestreben der anderen Bahnen, im gegebenen Zustande zu verharren oder leichter dem Ätherdrucke nachzugeben. Seine Nachgiebigkeit diesbezüglich ist der Maßstab für den heute (1907) bestehenden Grad des Wankens der Ekliptikebene. Er ist es fernerhin, der transneptunische Planetoiden, welche über die äußeren Grenzen des Sonnenreiches hereingeschrumpft sind, in neue Bahnen zwingt und, wenn sie ihm nicht ganz entkommen, zunächst zu Gliedern der inneren Planetoidenzone macht, aus welchem Range er einzelne wieder zu dem der periodischen Kometen befördern kann. Aber die Gruppe der sogen. "Kometenfamilie Jupiters" mußten wir aus klar gelegten Gründen als dem Mars verpflichtet ansehen, weil sie sich um dessen Apsidenlinie gruppieren.
Ebenso ist seine Bahnebene gleichsam die Ruhelage jener Pendelausschläge geworden, als welche man die schwankende Tendenz der übrigen Planetenbahnen, sich zum Sonnenfluge senkrecht aufzustellen, auffassen könnte; er allein reguliert durch seine überwiegende Masse und daraus folgende, genau begrenzte Tendenz einer bestimmten Neigung zu Veränderungen das stärkere Bestreben der anderen Bahnen, im gegebenen Zustande zu verharren oder leichter dem Ätherdrucke nachzugeben. Seine Nachgiebigkeit diesbezüglich ist der Maßstab für den heute (1907) bestehenden Grad des Wankens der Ekliptikebene. Er ist es fernerhin, der transneptunische Planetoiden, welche über die äußeren Grenzen des Sonnenreiches hereingeschrumpft sind, in neue Bahnen zwingt und, wenn sie ihm nicht ganz entkommen, zunächst zu Gliedern der inneren Planetoidenzone macht, aus welchem Range er einzelne wieder zu dem der periodischen Kometen befördern kann. Aber die Gruppe der sogen. "Kometenfamilie Jupiters" mußten wir aus klar gelegten Gründen als dem Mars verpflichtet ansehen, weil sie sich um dessen Apsidenlinie gruppieren.
Hörbiger/Fauth
(Quellenschriftauszug aus dem Buch "Glazial-Kosmogonie" von Hörbiger/Fauth, 1925, R. Voigtländer Verlag, Leipzig)
Zusatzbemerkung:
Bis heute wird in der
offiziellen Schulwissenschaft daran festgehalten, daß Jupiter ein
Gasriese zu sein habe.
Erwähnenswert ist, daß in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts diese Gas-Theorie etwas in den Hintergrund geraten war und die offizielle Fachwissenschaft bereits über einen mächtigen Eispanzer diskutierte, der sich auf Jupiter befinden könnte. So konnte man am 4. Dezember 1939 in den "Wiener Neuesten Nachrichten" anläßlich der größten Erdnähe des Planeten Jupiter u.a. lesen:
"Man ist aber hinsichtlich der Temperatur, die auf der Jupiteroberfläche herrscht, seit kurzem zu ganz anderen Schlüssen gekommen, und zwar zu Resultaten, die das größte Erstaunen der Gelehrtenwelt auslösten.
Durch die Einrichtung eines sehr feinfühligen Meßgerätes ist es uns möglich geworden, die physikalische Beschaffenheit der Sterne und Nachbarplaneten, die Strahlungsstärke und ihre Oberflächentemperatur ziemlich genau festzustellen. Diese neue Meßmethode hat uns bei dem Riesenplaneten Jupiter vor ganz neue Rätsel gestellt, denn man kam zu dem ganz unerwarteten Resultat, daß die Temperatur dieses vermeintlich noch in Rotglut befindlichen Planeten mindestens 160° unter dem Gefrierpunkt liegt, und daß seine Wolken nicht aus Wasserdunst gebildet werden, sondern aus Gas bestehen.
Zusammenfassend ist man über die Beschaffenheit des Jupiter heute zu folgender Ansicht gelangt: Der Jupiter besitzt einen festen Kern, wie die Erde.
Der Durchmesser dieses Kernes, dessen Stoffe dreimal schwerer als Wasser sind, beträgt ca. 90 000 km. Seine Oberfläche ist von einem gewaltigen Ozean überflutet, dessen Tiefe auf 10 000 km geschätzt wird! Es wird als sehr wahrscheinlich angenommen, daß dieser gewaltige Wassergürtel ständig zugefroren ist und von einer eisigen Atmosphäre von 5000 bis 6000 km Lufthöhe umlagert wird. Wir erblicken also in Jupiter keine glühende Kugel, sondern einen eisumpanzerten Koloß."
Soweit der Zeitungsbericht, dem auch entnommen werden konnte, daß diese Messungen von dem amerikanischen Astronom Russel vorgenommen und von seinem englischen Berufskollegen Jeffries bestätigt wurden. Daß es sich hier um keine Zeitungsente handeln könne, wird in dem Buch "Sterne, Welten und Atome" bestätigt, denn hier hat der amerikanische Gelehrte Sir James Jeans schon im Jahre 1931 derartige Behauptungen veröffentlicht.
Das geschah also 1931, im Sterbejahr des Schöpfers der Welteislehre, der dieselben Behauptungen schon neunzehn Jahre vorher veröffentlichte.
Aber damals, 1912, wurden solche Gedanken noch als indiskutable Absurditäten angesehen.
Und welchen Wissensstand besitzen wird heute, im Jahr 2009?
Wie sagte doch ein Professor aus heutiger Zeit: "Wir forschen heute immer noch auf dem derzeitig gründlichen Irrtum".
Erwähnenswert ist, daß in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts diese Gas-Theorie etwas in den Hintergrund geraten war und die offizielle Fachwissenschaft bereits über einen mächtigen Eispanzer diskutierte, der sich auf Jupiter befinden könnte. So konnte man am 4. Dezember 1939 in den "Wiener Neuesten Nachrichten" anläßlich der größten Erdnähe des Planeten Jupiter u.a. lesen:
"Man ist aber hinsichtlich der Temperatur, die auf der Jupiteroberfläche herrscht, seit kurzem zu ganz anderen Schlüssen gekommen, und zwar zu Resultaten, die das größte Erstaunen der Gelehrtenwelt auslösten.
Durch die Einrichtung eines sehr feinfühligen Meßgerätes ist es uns möglich geworden, die physikalische Beschaffenheit der Sterne und Nachbarplaneten, die Strahlungsstärke und ihre Oberflächentemperatur ziemlich genau festzustellen. Diese neue Meßmethode hat uns bei dem Riesenplaneten Jupiter vor ganz neue Rätsel gestellt, denn man kam zu dem ganz unerwarteten Resultat, daß die Temperatur dieses vermeintlich noch in Rotglut befindlichen Planeten mindestens 160° unter dem Gefrierpunkt liegt, und daß seine Wolken nicht aus Wasserdunst gebildet werden, sondern aus Gas bestehen.
Zusammenfassend ist man über die Beschaffenheit des Jupiter heute zu folgender Ansicht gelangt: Der Jupiter besitzt einen festen Kern, wie die Erde.
Der Durchmesser dieses Kernes, dessen Stoffe dreimal schwerer als Wasser sind, beträgt ca. 90 000 km. Seine Oberfläche ist von einem gewaltigen Ozean überflutet, dessen Tiefe auf 10 000 km geschätzt wird! Es wird als sehr wahrscheinlich angenommen, daß dieser gewaltige Wassergürtel ständig zugefroren ist und von einer eisigen Atmosphäre von 5000 bis 6000 km Lufthöhe umlagert wird. Wir erblicken also in Jupiter keine glühende Kugel, sondern einen eisumpanzerten Koloß."
Soweit der Zeitungsbericht, dem auch entnommen werden konnte, daß diese Messungen von dem amerikanischen Astronom Russel vorgenommen und von seinem englischen Berufskollegen Jeffries bestätigt wurden. Daß es sich hier um keine Zeitungsente handeln könne, wird in dem Buch "Sterne, Welten und Atome" bestätigt, denn hier hat der amerikanische Gelehrte Sir James Jeans schon im Jahre 1931 derartige Behauptungen veröffentlicht.
Das geschah also 1931, im Sterbejahr des Schöpfers der Welteislehre, der dieselben Behauptungen schon neunzehn Jahre vorher veröffentlichte.
Aber damals, 1912, wurden solche Gedanken noch als indiskutable Absurditäten angesehen.
Und welchen Wissensstand besitzen wird heute, im Jahr 2009?
Wie sagte doch ein Professor aus heutiger Zeit: "Wir forschen heute immer noch auf dem derzeitig gründlichen Irrtum".
die WEL-Privatinstitutsleitung
(Quellenschriftauszug aus dem Buch "Welteis - Roman um ein Weltbild" von R.Hörbiger/Soeser, 1952, Verlag Karl Kühne, Wien.)