| Zurück |
Impressum
Datenschutz
Einer der
letzten großen Weisen und Naturverbundenen des
Altertums, der geniale Arzt Hippokrates, schrieb vor zweitausend
Jahren: "Alles im Organismus ist ein
einziges Zusammenströmen, ein einziges harmonisches
Zusammenwirken; alles ist gerichtet auf die Gesamtheit, jedes Teilchen
im einzelnen auf das andere abgestimmt - alles ist zum gemeinsamen
Wirken da."
Das gilt nicht nur für das Wesen, das wir Mensch nennen, sondern es gilt für alles Lebendige. Und es gilt für mehr. Wenn wir goethisch sprechen wollten, könnten wir sagen, das Wort des Hippokrates hätte überhaupt Gültigkeit für die Idee eines Organismus. Und das trifft zu! Denn wir vermögen das Weistum des Griechen ohne jede Einschränkung auf den Kosmos anzuwenden, auf den Kosmos als Begriff unserer Welt, darinnen wir Teilchen sind, jedes im einzelnen auf das andere abgestimmt. Teile eines Organismus.
Das gilt nicht nur für das Wesen, das wir Mensch nennen, sondern es gilt für alles Lebendige. Und es gilt für mehr. Wenn wir goethisch sprechen wollten, könnten wir sagen, das Wort des Hippokrates hätte überhaupt Gültigkeit für die Idee eines Organismus. Und das trifft zu! Denn wir vermögen das Weistum des Griechen ohne jede Einschränkung auf den Kosmos anzuwenden, auf den Kosmos als Begriff unserer Welt, darinnen wir Teilchen sind, jedes im einzelnen auf das andere abgestimmt. Teile eines Organismus.
Der Verlust dieses Wissens hat
die mehr als zweitausendjährige
Tragödie heraufbeschworen, unter der auch wir stöhnen.
Lebendig allein ist es nur geblieben im Volkswissen, das, für die
Geistigkeit der Nur-Vernunftmenschen ohne Bedeutung, besonders deswegen
übersehen wurde, weil es vermeintlich viel zu tief stand, um
ernstliche Beachtung zu erregen.
Nur in volkskundlichen Werken finden die Weistümer meist als Seltsamkeiten Platz und als Äußerungen einer derart schlichten Menschenschicht, daß gelehrte Kreise es unter ihrer Würde hielten, sie mit Ernst zu prüfen.
Eines wurde vor allem völlig vernachlässigt: Die dem Landvolk eigene scharfe Beobachtungsfähigkeit. Immer wurde übersehen, wie gerade der Bauer aus ganz natürlichen Gründen gezwungen ist, den Erscheinungen der Natur allergrößte Aufmerksamkeit zu schenken. Da er aber ohne Retorte, Teleskop und Waage arbeitet, die, wie Goethe sagt, "keine sittlich günstige Wirkung auf den Menschen ausüben", da "der äußere Sinn".... "dadurch mit der inneren Urteilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesetzt" wird, ward sein Wissensschatz als laienhaft und wenig zuverlässig schlechthin übergangen. Und doch ist gerade der Landbewohner mitten in der Natur hineingestellt, ist Tag um Tag von der Natur abhängig, so daß es für ihn Lebensnotwendigkeit bleibt, auf die Äußerungen der Natur zu hören, ihre Zeichen zu merken, um so Nutzen für das Dasein zu ziehen.
Erinnern wir uns doch nur der einfachen Tatsache, die uns hier als Beispiel dienen mag, daß die Tiere ihren Winterpelz bereits im Herbst anzulegen beginnen. Winterpelz und Winterpelz sind aber sehr verschiedene Dinge, je nach der Strenge der bevorstehenden kalten Zeit.
Ist der Pelz der Tiere im Spätherbst besonders dicht, so steht ein scharfer Winter bevor. So handelt die Natur in ihrer weisen Vorausschau zweckmäßig. Und darum kann der Balg eines Hasen für den Landbewohner ein recht verläßliches Anzeichen eines milden oder strengen Winters sein. Es handelt sich sogar hier um ein sehr zuverlässiges Vorzeichen. Jedenfalls sehen wir eine überaus feine vom Volk festgestellte Beobachtung vor uns.
Nur in volkskundlichen Werken finden die Weistümer meist als Seltsamkeiten Platz und als Äußerungen einer derart schlichten Menschenschicht, daß gelehrte Kreise es unter ihrer Würde hielten, sie mit Ernst zu prüfen.
Eines wurde vor allem völlig vernachlässigt: Die dem Landvolk eigene scharfe Beobachtungsfähigkeit. Immer wurde übersehen, wie gerade der Bauer aus ganz natürlichen Gründen gezwungen ist, den Erscheinungen der Natur allergrößte Aufmerksamkeit zu schenken. Da er aber ohne Retorte, Teleskop und Waage arbeitet, die, wie Goethe sagt, "keine sittlich günstige Wirkung auf den Menschen ausüben", da "der äußere Sinn".... "dadurch mit der inneren Urteilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesetzt" wird, ward sein Wissensschatz als laienhaft und wenig zuverlässig schlechthin übergangen. Und doch ist gerade der Landbewohner mitten in der Natur hineingestellt, ist Tag um Tag von der Natur abhängig, so daß es für ihn Lebensnotwendigkeit bleibt, auf die Äußerungen der Natur zu hören, ihre Zeichen zu merken, um so Nutzen für das Dasein zu ziehen.
Erinnern wir uns doch nur der einfachen Tatsache, die uns hier als Beispiel dienen mag, daß die Tiere ihren Winterpelz bereits im Herbst anzulegen beginnen. Winterpelz und Winterpelz sind aber sehr verschiedene Dinge, je nach der Strenge der bevorstehenden kalten Zeit.
Ist der Pelz der Tiere im Spätherbst besonders dicht, so steht ein scharfer Winter bevor. So handelt die Natur in ihrer weisen Vorausschau zweckmäßig. Und darum kann der Balg eines Hasen für den Landbewohner ein recht verläßliches Anzeichen eines milden oder strengen Winters sein. Es handelt sich sogar hier um ein sehr zuverlässiges Vorzeichen. Jedenfalls sehen wir eine überaus feine vom Volk festgestellte Beobachtung vor uns.
Das Urwissen umfaßte in
natürlicheren Zeitläufen, als
es die gegenwärtigen sind, landschaftsgemäß heraus aus
Jahrzehntausende langer Erfahrung alle lebenswichtigen Erscheinungen in
oft geradezu erstaunlicher Feinheit. Denken wir nur an die
geheimnisvolle Wünschelrute, die seit längst verklungenen
Vorzeiten Handwerkzeug des Menschen war.
Das aber ist der Unterschied: Das Urwissen des Volkes gründet sich auf natürliche Erfahrungstatsachen und verzichtet aus zartestem Gefühl für den Ablauf des Weltgeschehens auf "wissenschaftliche" Prüfung. Weil das Leben selbst die Antworten auf die Fragen gibt, besser und in jedem Falle zuverlässiger als Laboratoriumsprüfung in unnatürlicher Umgebung es je vermöchte. Zudem drückt das Volk seine Erfahrungen in einer dem Wissenschaftler ungewohnten Sprache aus, die nur dem naturnahe Lebenden im Letzten verständlich ist.
Das zeigen ganz besonders deutlich die verlästerten Bauernregeln, die ja ebenfalls ganz jenseits der Wissenschaft als Erfahrungstatsachen gewonnen, aber von den Gelehrten mit jener Geringschätzung bedacht wurden, die, ist von den Wetterregeln die Rede, niemals versäumt, das geistvolle Verslein anzuführen:
Das aber ist der Unterschied: Das Urwissen des Volkes gründet sich auf natürliche Erfahrungstatsachen und verzichtet aus zartestem Gefühl für den Ablauf des Weltgeschehens auf "wissenschaftliche" Prüfung. Weil das Leben selbst die Antworten auf die Fragen gibt, besser und in jedem Falle zuverlässiger als Laboratoriumsprüfung in unnatürlicher Umgebung es je vermöchte. Zudem drückt das Volk seine Erfahrungen in einer dem Wissenschaftler ungewohnten Sprache aus, die nur dem naturnahe Lebenden im Letzten verständlich ist.
Das zeigen ganz besonders deutlich die verlästerten Bauernregeln, die ja ebenfalls ganz jenseits der Wissenschaft als Erfahrungstatsachen gewonnen, aber von den Gelehrten mit jener Geringschätzung bedacht wurden, die, ist von den Wetterregeln die Rede, niemals versäumt, das geistvolle Verslein anzuführen:
Wenn der Hahn kräht auf dem
Mist,
so ändert sich das Wetter
oder es bleibt wie es ist.
so ändert sich das Wetter
oder es bleibt wie es ist.
Weit länger als ein
Jahrzehnt habe ich an die Bauernregeln
verwendet und nur dort Ausnahmen gefunden, wo die Regeln durch
Kalenderreformen oder spätere Um- und Verfälschungen in der
Tat für unsere Zeit - nicht an sich! - Irrtümer sind.
Daneben ergaben sich Abweichungen dort, wo Regeln mißverstanden
wurden, wie etwa die Ansicht lehrt, jeder sommerliche Regen werde durch
den erdnahen Flug der Schwalben angekündigt. Das also ist
ein Irrtum, der sicher nicht dem Landbewohner aufs Kerbholz gebucht
werden darf. Darum schicken wir uns an, eine Ehrenrettung der
Bauernregeln zu versuchen und zu zeigen, um wieviel
verläßlicher das Urwissen des Volkes ist als die exakte
Wissenschaft. Dabei wäre es natürlich gänzlich
abwegig, die Leistungen unserer auf die Zivilisationsbedürfnisse
zugeschnittenen Wetterkunde zu verkleinern. Allerdings besteht
kein Zweifel darüber, diese Wissenschaft erst am Anfang ihres
Weges zu sehen, gegen den gehalten das Urwissen über
unvergleichlich größere praktische Erfahrungen
verfügt. Es ist darum auch keineswegs verwunderlich, wenn
hervorragende Köpfe aus dem Kreise der Fachmeteorologie, wie etwa
Prof Dr. W. Grosse-Bremen oder Dr. O. Myrbach-Wien, dem Urwissen des
Volkes ihre Aufmerksamkeit zu schenken beginnen und das zu
bestätigen anfangen, an dessen Richtigkeit ein Landkind nie
gezweifelt hat.
Diese Absichten der Wetterkundler in allen Ehren. Aber eines ist sicher: Mit den Mitteln der amtlichen Wetterkunde ist die Richtigkeit der Bauernregeln nicht nachzuweisen, es gelänge denn, die Geheimnisse einer Sprache zu beurteilen, ohne die Sprache vorher eingehend gelernt zu haben.
Zu kraß sind ja auch die Unterschiede. Während die Meteorologie, von einigen wenigen Ansätzen abgesehen, das Wetter für höchstens zwei Tage im Voraus zu bestimmen in der Lage ist und hierbei den allerschroffsten Irrtümern ausgesetzt bleibt, vermißt sich das Volkswissen, die Wetterlage auf Monate hinaus vorauszusagen.
Wir würden aber ungerecht sein, wollten wir die gänzlich abweichende grundsätzliche Einstellung beider Lager zu den Dingen übersehen.
Diese Absichten der Wetterkundler in allen Ehren. Aber eines ist sicher: Mit den Mitteln der amtlichen Wetterkunde ist die Richtigkeit der Bauernregeln nicht nachzuweisen, es gelänge denn, die Geheimnisse einer Sprache zu beurteilen, ohne die Sprache vorher eingehend gelernt zu haben.
Zu kraß sind ja auch die Unterschiede. Während die Meteorologie, von einigen wenigen Ansätzen abgesehen, das Wetter für höchstens zwei Tage im Voraus zu bestimmen in der Lage ist und hierbei den allerschroffsten Irrtümern ausgesetzt bleibt, vermißt sich das Volkswissen, die Wetterlage auf Monate hinaus vorauszusagen.
Wir würden aber ungerecht sein, wollten wir die gänzlich abweichende grundsätzliche Einstellung beider Lager zu den Dingen übersehen.
Dem Fachwetterkundler kommt es
darauf an, in aller Exaktheit aus den
nach seiner Meinung rein irdischen,
also meßbaren Veränderungen der Lufthülle zu
erschließen, ob Regen fallen, ob Gewitter aufziehen, ob
Sonnenschein herrschen wird. Eine Voraussage auf Monate hinaus
hält er für wissenschaftlich und damit überhaupt
gegenwärtig für höchst fraglich, obwohl ihn bereits ein
Hasenbalg nachdenklich stimmen sollte. Aber das Fell Meister
Lampes ist leider kein Gegenstand der Wetterkunde, sondern der
Biologie. Und in der Wissenschaft wandelt niemand ungestraft in
fremden Fächern!
Anders der Bauer. Er mißt nicht und rechnet nicht. Er beobachtet einfach die Natur. Er ist zwar in der Lage, sehr genaue Angaben über die zu erwartende Wetterlage des Tages machen zu können, zudem ohne weiteres fähig, monatelang Voraussagen zu liefern.
Allerdings ist seine Fragestellung eine völlig andere als die der Wissenschaft. Wenn er von kommenden Regen spricht, so ist da meist nicht ein Platzregen gemeint. Sein "Regen" ist eine länger andauernde Durchnässung, die auch für seine Lebensnotwendigkeiten einschneidende Bedeutung besitzt. Darum versteht er unter dem von niederem Schwalbenflug angekündigten Regen keinen flüchtigen Gewitterschauer, vor dem die Schwalben meist ruhig in der Höhe fliegen, sondern einen wahrhaften Landregen.
Für den Bauer ist ein "guter" Sommer auch keineswegs dasselbe wie für den Städter, für den "gut" und "ewiger Sonnenschein" sich decken. Und wenn etwa der Landmann einen guten Mai voraussagt und wenn dann vom Fachmann wissenschaftlich nachgewiesen wird, daß diese Voraussage sich nicht bewahrheitet habe, weil der Monat kühl und regnerisch gewesen sei, so ist das ein Fehlschluß des Meteorologen. Denn für den Bauern ist ein derart gestalteter Mai eben "gut"!
Anders der Bauer. Er mißt nicht und rechnet nicht. Er beobachtet einfach die Natur. Er ist zwar in der Lage, sehr genaue Angaben über die zu erwartende Wetterlage des Tages machen zu können, zudem ohne weiteres fähig, monatelang Voraussagen zu liefern.
Allerdings ist seine Fragestellung eine völlig andere als die der Wissenschaft. Wenn er von kommenden Regen spricht, so ist da meist nicht ein Platzregen gemeint. Sein "Regen" ist eine länger andauernde Durchnässung, die auch für seine Lebensnotwendigkeiten einschneidende Bedeutung besitzt. Darum versteht er unter dem von niederem Schwalbenflug angekündigten Regen keinen flüchtigen Gewitterschauer, vor dem die Schwalben meist ruhig in der Höhe fliegen, sondern einen wahrhaften Landregen.
Für den Bauer ist ein "guter" Sommer auch keineswegs dasselbe wie für den Städter, für den "gut" und "ewiger Sonnenschein" sich decken. Und wenn etwa der Landmann einen guten Mai voraussagt und wenn dann vom Fachmann wissenschaftlich nachgewiesen wird, daß diese Voraussage sich nicht bewahrheitet habe, weil der Monat kühl und regnerisch gewesen sei, so ist das ein Fehlschluß des Meteorologen. Denn für den Bauern ist ein derart gestalteter Mai eben "gut"!
Mai, kühl und naß,
Füllt dem Bauern Scheuer und Faß.
Auch ein Wort wie:Füllt dem Bauern Scheuer und Faß.
Karfreitag Regen
Bringt keinen Segen,
ist mißverständlich,
wenn wir uns nicht in die Denkweise des
Landmannes versetzen; denn es feuchter oder trüber Karfreitag
pflegt einen dürren oder regenarmen Sommer nach sich zu ziehen,
der für den allein Sonne und Wärme erwartenden Städter
als herrlich gilt. Daß allerdings diese Regel für den
exakt Prüfenden nicht stimmt, liegt nicht an der Regel, sondern an
der heute unbekannten Tatsache, daß unser Ostern, wie ich im
"Herrgottswinkel" zeige, falsch liegt und damit auch der Karfreitag.
Und dann gibt es eine weitere Quelle, aus der für eine exakte Nachprüfung durch den Naturentwöhnten Irrtümer erfließen: Die Verknüpfung der Regeln untereinander.
Wir schicken uns etwa an, die folgende Bauernregel nachzuprüfen:
Und dann gibt es eine weitere Quelle, aus der für eine exakte Nachprüfung durch den Naturentwöhnten Irrtümer erfließen: Die Verknüpfung der Regeln untereinander.
Wir schicken uns etwa an, die folgende Bauernregel nachzuprüfen:
Frühst St. Petrus uppen
Staule
Dann frühst es noch veerzig
Tage uppen Paule.
Ins Hochdeutsche
übersetzt, besagt diese Weisheit, daß
vierzig Tage Frost dann bevorständen, wenn es an Petri Stuhlfeier,
also am 22. Februar, friere. Wir vergleichen also und gewahren
sehr viele Ausnahmen. Der Wissenschaftler würde auf Grund
des Befundes die völlige Unbrauchbarkeit der Regel
bestätigen. Und doch wäre ein solches Urteil falsch;
denn das Wort hat nur dann Gültigkeit, "wenn Matthias seine
Zustimmung" gibt. Mit anderen Worten: Nur wenn es am
Matthias-Tage, also am 24. Februar, ebenfalls friert, bleibt die Regel
in Gültigkeit. Und wer nun mit Hilfe der Wetterregel am 24.
prüft, findet Übereinstimmung.
Eine wirkliche Nachprüfung
des bäuerlichen Wetterwissens
vermag eigentlich nur der vorzunehmen, welcher unaufhörlich die
Natur aufs schärfste beobachtet, der mit ihr aufs engste verbunden
lebt, der die Feinheit ihrer Regungen zu empfinden vermag. Erst
dann wird es möglich, auch Regeln, die einander ergänzen, die
richtigen Schlüsse zu ziehen. Auch müssen wir uns daran
gewöhnen, jene geradezu merkwürdig anmutenden Regeln zu
verwenden, die fast lächerlich erscheinen.
So beschleicht uns zunächst ein aus Milde und Nachsicht gepaartes Gefühl für die Einfalt des Landvolkes, wenn wir hören, daß Regen in Aussicht stehe, wenn die Frauen mit ihrem Schwatz auf der Dorfstraße nicht zu Ende kämen, "eine jener tiefgründigen Weisheiten, die natürlich immer passen", wie ein gelehrter Beurteiler sagt.
Indessen meint das Volkswissen ganz ernsthaft, auch dann, wenn die Enten besonders stark schnatterten, stehe ebenfalls Regen in Aussicht. Hier sind also Frauen und Enten gewissermaßen auf den Generalnenner der Wetterpropheten gebracht. Eine doch höchst lächerliche Behauptung in den Augen derer, die Natur nur aus Büchern und aus Laboratorien kennen.
Erinnern wir uns aber der Deutung des Wortes, daß verschüttetes Salz auf kommenden Ärger weise, so finden wir auch hier nur wohlbegründete Behauptungen.
Bei der Betrachtung des Salzes erfahren wir, wie von der Sonne her elektropositive Feineismassen zur Erde geblasen werden, die das Leben in einen gewissen Erregungszustand versetzen. Und diese Feineismassen bedingen bei entsprechender Menge das Eintreten von Landregen. Und damit halten wir bereits die Lösung der merkwürdigen Behauptung über den Zusammenhang zwischen dem Schwatz der Frauen und dem kommenden schlechten Wetter in Händen. Auch die Tierwelt wird beeinflußt, besonders die Haustiere. Und so ist verständlich, wie Frauen und Enten durch die gleiche Ursache in eine erhöhte nervöse Erregung mit ihren entsprechenden Folgen geraten.
Besonderes gewonnen ist zwar durch diese Ableitung nicht. Sie hat nur wissenschaftlichen Wert; denn an sich genügt es vollauf, mit dem Volke zu wissen, daß derartiges Verhalten von Mensch und Tier einen für das Leben des Bauern und seine Tätigkeit wichtigen Schluß zulassen. Und das ist alles, was wir wirklich brauchen.
Es sei aber hier noch an einen alten Vers aus der "Bauernpraktik" von 1508 erinnert, der die allgemeine Erregung vor dem Wetterumschlag sehr artig schildert:
So beschleicht uns zunächst ein aus Milde und Nachsicht gepaartes Gefühl für die Einfalt des Landvolkes, wenn wir hören, daß Regen in Aussicht stehe, wenn die Frauen mit ihrem Schwatz auf der Dorfstraße nicht zu Ende kämen, "eine jener tiefgründigen Weisheiten, die natürlich immer passen", wie ein gelehrter Beurteiler sagt.
Indessen meint das Volkswissen ganz ernsthaft, auch dann, wenn die Enten besonders stark schnatterten, stehe ebenfalls Regen in Aussicht. Hier sind also Frauen und Enten gewissermaßen auf den Generalnenner der Wetterpropheten gebracht. Eine doch höchst lächerliche Behauptung in den Augen derer, die Natur nur aus Büchern und aus Laboratorien kennen.
Erinnern wir uns aber der Deutung des Wortes, daß verschüttetes Salz auf kommenden Ärger weise, so finden wir auch hier nur wohlbegründete Behauptungen.
Bei der Betrachtung des Salzes erfahren wir, wie von der Sonne her elektropositive Feineismassen zur Erde geblasen werden, die das Leben in einen gewissen Erregungszustand versetzen. Und diese Feineismassen bedingen bei entsprechender Menge das Eintreten von Landregen. Und damit halten wir bereits die Lösung der merkwürdigen Behauptung über den Zusammenhang zwischen dem Schwatz der Frauen und dem kommenden schlechten Wetter in Händen. Auch die Tierwelt wird beeinflußt, besonders die Haustiere. Und so ist verständlich, wie Frauen und Enten durch die gleiche Ursache in eine erhöhte nervöse Erregung mit ihren entsprechenden Folgen geraten.
Besonderes gewonnen ist zwar durch diese Ableitung nicht. Sie hat nur wissenschaftlichen Wert; denn an sich genügt es vollauf, mit dem Volke zu wissen, daß derartiges Verhalten von Mensch und Tier einen für das Leben des Bauern und seine Tätigkeit wichtigen Schluß zulassen. Und das ist alles, was wir wirklich brauchen.
Es sei aber hier noch an einen alten Vers aus der "Bauernpraktik" von 1508 erinnert, der die allgemeine Erregung vor dem Wetterumschlag sehr artig schildert:
So die Hund das graß speyen
Und die Weiber über die Flög schreyen
Oder sy die zeehen jucken
Tut naß Wetter zuher rucken.
Und die Weiber über die Flög schreyen
Oder sy die zeehen jucken
Tut naß Wetter zuher rucken.
Der bisherigen Wetterkunde
konnte der Beweis einer inneren Verbindung
zwischen solcher "Stimmung" des Lebens und dem kommenden Wetter deswegen nicht
gelingen, weil sie alle Wettererscheinungen, trotz der Fülle der
entgegenstehenden Tatsachen, als nur irdischer Herkunft anerkennen
wollte, sich gewaltsam jeder Einsicht in die kosmischen
Zusammenhänge verschloß und zum weitaus größten
Teile heute noch verschließt.
Aber das sind Fragen der
Wissenschaft, die uns nicht zu beschweren
brauchen, da für uns auch aus urältestem Weistum die
Verbindungen zwischen Kosmos und Erde außer allem Zweifel steht.
Erst auf diesem Wege läßt sich endgültig das Urwissen als wirkliches Wissen beweisen. Wenn dieser Beweis hier angetreten wird, so nicht etwa deswegen, um den Wert der Welteislehre oder der Heliobiologie zu erhärten, sondern um die Achtung vor einem Wissen zu erzwingen, das allenthalben die bisherigen Möglichkeiten der Naturerkenntnis in den Schatten stellt und der einzige Weg scheint, den Menschen aus dem Reiche seiner Einbildung in die heimatliche Wirklichkeit zurückzuführen, zu wahrem Naturverständnis als der alleinigen Möglichkeit eines harmonischen Lebens, als des Pfades zur Vollendung.
In diesem Sinne allerdings leisten Hörbigers Gedanken und die auf sie gegründete Heliobiologie mehr als alle bisherigen wissenschaftlichen Forschungen zusammengenommen. So auch ergibt sich eine Möglichkeit der Nachprüfung des Wertes alles Urweistums.
Denn nicht in jedem Falle ist dieser Wert erwiesen. Nicht darum ist Vorsicht am Platze, weil das Volk durch Jahrzehntausende etwa falsch beobachtete, sondern allein deswegen, weil durch zivilisatorische Einflüsse derartige "Regeln" ihres eigentlichen Gepräges durch die bereits erwähnten Beeinträchtigungen und durch Verschleppen an den unrechten Ort beraubt wurden.
Erst auf diesem Wege läßt sich endgültig das Urwissen als wirkliches Wissen beweisen. Wenn dieser Beweis hier angetreten wird, so nicht etwa deswegen, um den Wert der Welteislehre oder der Heliobiologie zu erhärten, sondern um die Achtung vor einem Wissen zu erzwingen, das allenthalben die bisherigen Möglichkeiten der Naturerkenntnis in den Schatten stellt und der einzige Weg scheint, den Menschen aus dem Reiche seiner Einbildung in die heimatliche Wirklichkeit zurückzuführen, zu wahrem Naturverständnis als der alleinigen Möglichkeit eines harmonischen Lebens, als des Pfades zur Vollendung.
In diesem Sinne allerdings leisten Hörbigers Gedanken und die auf sie gegründete Heliobiologie mehr als alle bisherigen wissenschaftlichen Forschungen zusammengenommen. So auch ergibt sich eine Möglichkeit der Nachprüfung des Wertes alles Urweistums.
Denn nicht in jedem Falle ist dieser Wert erwiesen. Nicht darum ist Vorsicht am Platze, weil das Volk durch Jahrzehntausende etwa falsch beobachtete, sondern allein deswegen, weil durch zivilisatorische Einflüsse derartige "Regeln" ihres eigentlichen Gepräges durch die bereits erwähnten Beeinträchtigungen und durch Verschleppen an den unrechten Ort beraubt wurden.
Urwissen ist
landschaftsgebunden und muß es sein, weil die
kosmischen Einflüsse sich je nach der Gestaltung, nach der
geographischen Lage und dem geologischen Untergrunde völlig
verschieden auswirken. Es ist doch ohne weiteres einzusehen,
daß etwa magnetische Gebiete eine gänzlich andere Auswirkung
des sonnenflüchtigen Feineis-Stromes bedingen als völlig
erzfreie. Denken wir doch nur an den auf Böotia Felix
befindlichen magnetischen Nordpol, der als negativer Pol des
Erdmagneten das positiv geladene Feineis in gesteigertem Maße an
sich heranlenken muß. Zwischen derart starken und den
normalen Wirkungen natürlicher Landschaften werden sich gewaltige
Unterschiede ergeben, die auf Leben, Wetter, Saat und Ernte den
allergrößten Einfluß haben, ganz abgesehen von den
bekannten klimatischen Einflüssen der Erde.
Alle diese Dinge, auf die, ohne sie im einzelnen behandeln zu können, hier nur hingewiesen zu werden braucht, um die Landschaftsgebundenheit des Bauernwissens erahnen zu lassen, alle diese Dinge sind bisher außer Beachtung geblieben.
Der erleichterte und gesteigerte Weltverkehr der letzten hundert Jahre hat mit dem reisenden, seine Scholle wechselnden, in die Industriegebiete abwandernden oder gar auswandernden Landbewohner eine Zerstreuung des Urwissens bedingt, die zu einer Irrstellung an sich richtiger Erkenntnisse in wesensfremder Umgebung führte.
So bewahrheitet sich die wegen ihrer Einprägsamkeit fast überall bekannte Regel, sieben Wochen sei dann Regen zu erwarten, wenn am Siebenschläfertage schlecht Wetter herrsche, keineswegs an allen Stellen, an denen sie noch gebräuchlich ist. Erwiesen ist indessen, daß sie für verschiedene Gebiete eine recht verläßliche Voraussage liefert.
Und ein anderes, das wir bereits erwähnten, darf vor allem nicht übersehen werden: Die Kalenderreformen.
Mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders 1582 hat eine Verschiebung um 10-11 Tage stattgefunden, so, daß der alte "Maitag" heute nicht mehr wie einst den ersten Mai bedeutet, sondern auf den 11. fällt. Vielfach hat das Volk diese Wandlung berücksichtigt. So sehen wir, um hier beim Maitag zu bleiben, daß in Niedersachsen die Kühe nicht wie ehedem am ersten Mai auf die Weide getrieben wurden, um, wie der Bauer behauptet, des die Milcherzeugung steigernden betauten Maigrases teilhaftig werden zu lassen, sondern erst am 11. oder 12. Mai. Darum spricht man auch nicht schlechthin vom Maitag, sondern vom alten Maitag:
Ol 'n Maidag mot sik 'n Kraih in'n Rongen verstäken künnen!
Kann sich also am elften Mai eine Krähe im Roggen verstecken, dann ist vorerst auf eine gute Roggenernte zu hoffen.
Hier deuten also die Verhältnisse an einem bestimmten Tage auf Erscheinungen, die in wochenlanger Ferne liegen. Solche Tage werden Lostage genannt. Bei diesen, teilweise auf Monate hinaus das Wetter kennzeichnenden oder bestimmenden Daten ist es keineswegs immer sicher, ob auch sie den Kalenderreformen gemäß vom Volke um die entsprechenden Spannen verlegt wurden. Jedenfalls hat Otto Myrbach den 8. Juni liegenden Medardustag erst auf den 18. verlegen müssen und erst dann die Behauptung des Volkes bestätigt gefunden, es bewahre das Wetter vierzig Tage lang den Charakter eben des Medardustag:
Alle diese Dinge, auf die, ohne sie im einzelnen behandeln zu können, hier nur hingewiesen zu werden braucht, um die Landschaftsgebundenheit des Bauernwissens erahnen zu lassen, alle diese Dinge sind bisher außer Beachtung geblieben.
Der erleichterte und gesteigerte Weltverkehr der letzten hundert Jahre hat mit dem reisenden, seine Scholle wechselnden, in die Industriegebiete abwandernden oder gar auswandernden Landbewohner eine Zerstreuung des Urwissens bedingt, die zu einer Irrstellung an sich richtiger Erkenntnisse in wesensfremder Umgebung führte.
So bewahrheitet sich die wegen ihrer Einprägsamkeit fast überall bekannte Regel, sieben Wochen sei dann Regen zu erwarten, wenn am Siebenschläfertage schlecht Wetter herrsche, keineswegs an allen Stellen, an denen sie noch gebräuchlich ist. Erwiesen ist indessen, daß sie für verschiedene Gebiete eine recht verläßliche Voraussage liefert.
Und ein anderes, das wir bereits erwähnten, darf vor allem nicht übersehen werden: Die Kalenderreformen.
Mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders 1582 hat eine Verschiebung um 10-11 Tage stattgefunden, so, daß der alte "Maitag" heute nicht mehr wie einst den ersten Mai bedeutet, sondern auf den 11. fällt. Vielfach hat das Volk diese Wandlung berücksichtigt. So sehen wir, um hier beim Maitag zu bleiben, daß in Niedersachsen die Kühe nicht wie ehedem am ersten Mai auf die Weide getrieben wurden, um, wie der Bauer behauptet, des die Milcherzeugung steigernden betauten Maigrases teilhaftig werden zu lassen, sondern erst am 11. oder 12. Mai. Darum spricht man auch nicht schlechthin vom Maitag, sondern vom alten Maitag:
Ol 'n Maidag mot sik 'n Kraih in'n Rongen verstäken künnen!
Kann sich also am elften Mai eine Krähe im Roggen verstecken, dann ist vorerst auf eine gute Roggenernte zu hoffen.
Hier deuten also die Verhältnisse an einem bestimmten Tage auf Erscheinungen, die in wochenlanger Ferne liegen. Solche Tage werden Lostage genannt. Bei diesen, teilweise auf Monate hinaus das Wetter kennzeichnenden oder bestimmenden Daten ist es keineswegs immer sicher, ob auch sie den Kalenderreformen gemäß vom Volke um die entsprechenden Spannen verlegt wurden. Jedenfalls hat Otto Myrbach den 8. Juni liegenden Medardustag erst auf den 18. verlegen müssen und erst dann die Behauptung des Volkes bestätigt gefunden, es bewahre das Wetter vierzig Tage lang den Charakter eben des Medardustag:
Wies wittert auf Medardustag,
So witterts wochenlang danach.
So witterts wochenlang danach.
Für die von Myrbach
untersuchte Spanne bewahrheitet sich also die
Urüberzeugung vollkommen. So ist denn im Jahre 1926 das
Wetter, mit Ausnahme weniger heißer Tage im Juli, die
selbstverständlich im bäuerlichen Sinne für die
allgemeine Wetterlage ohne Bedeutung sind, bis zum 23. August
gleichmäßig regnerisch, wie an dem Lostage, gewesen.
Am 24. August liegt aber ein neuer Lostag, der nach dem Gregorianischen
Kalender das Herbstwetter bestimmt.
Solche Prüfungen sind also
nötig in einer Zeit des
Völkeraustausches durch den Verkehr und damit in einer Spanne der
Weistums-Verschleppung, zudem aber auch in einer Zeitwende, da die
Naturentfremdung in bedrohlicher Weise auch auf die
Landbevölkerung übergreift. Es ist somit an der Zeit,
diese Schätze zu retten, ehe das Verständnis für das
Urwissen gänzlich stirbt. Denn schon heute stellen sich dem,
der seine Entzifferung versucht, wie schon angedeutet, nicht
unerhebliche Schwierigkeiten in den Weg.
Es sei darum auch auf einen weiteren Punkt hingewiesen, der bei dem Alter verschiedener Bauernregeln ins Gewicht fallen kann, der aber bisher völlig unbeachtet blieb: Auf die Wanderung des Frühlingspunktes, der erst nach etwa 26 000 Jahren wieder zur alten Himmelsgegend zurückkehrt. Damit verschiebt sich auch die Lage der Erde zur Sonne als der Beherrscherin der irdischen Großwetterlage. Wenn also heute etwa der 24. Februar als Lostag gilt, so lag früher diese entscheidende Wetterwende am 25., 26., 27. Februar, am 4., 5., 6., 15. März und noch weiter im Jahr, je tiefer wir in der Zeit zurückgehen. Das muß in entsprechenden Fällen berücksichtigt werden. Denn viele Bauernregeln scheinen uralt zu sein. Wir dürfen uns da nicht durch ihre Verknüpfung mit der christlichen Mythologie irre machen lassen. Das Auftreten christlicher Heiliger in den Regeln besagt für das Alter des Urwissens, oder besser, die Jugend einer Volksweisheit nicht das Geringste; denn es ist anzunehmen, daß Karl des Franken und des frommen Ludewigs Zertrümmerung alles Germanischen nicht bei den Heiligtümern, den Schriften oder den Flurbenennungen halt gemacht hat, sich nicht darin erschöpfte, alte germanische Heiligtümer mit christlichen Kapellen zu bebauen, heilige und mit den Gottesnamen gezierte Täler, Haine und Berge als Teufelsschlucht, Totengrund, Satanswiese, Hexenberg oder mit ähnlich schmückenden Beinamen zu versehen, sondern fast auch alles, was sonst an echt germanischen Weistum erinnerte, durch römische Apostel im Laufe der Zeit gegen christliche Dinge ausgewechselt wurde.
Das alles sollte berücksichtigt werden, wollen wir das gesamte Urwissen des Volkes in seiner Sinnhaftigkeit wieder zur Geltung bringen.
Gewiß ist es Absicht dieser Zeilen, auf den Wert auch der Bauernregeln hinzuweisen. Und an Hand der Heliobiologie und der Welteislehre wollen wir versuchen, einen kleinen Teil des bäuerlichen Urwissens auf seine Verläßlichkeit zu prüfen. Dabei kann es sich gewißlich nur um eine oberflächliche Betrachtung handeln, die indessen frei von Oberflächlichkeit im Urteil bleibt.
Das zu betonen ist nicht ganz unwichtig, denn gerade beim Urwissen beobachten wir immer wieder, wie die Wissenschaft jene Dinge belächelt und ablehnt, die dem Landbewohner als feststehende Tatsachen gelten. Daß etwa Mond und Wetter in engem Zusammenhange stehen, gilt dem Urwissen ebenso als unerschütterliche Tatsache, wie der Wissenschaft als Aberglaube derer, die nicht alle werden.
Es sei darum auch auf einen weiteren Punkt hingewiesen, der bei dem Alter verschiedener Bauernregeln ins Gewicht fallen kann, der aber bisher völlig unbeachtet blieb: Auf die Wanderung des Frühlingspunktes, der erst nach etwa 26 000 Jahren wieder zur alten Himmelsgegend zurückkehrt. Damit verschiebt sich auch die Lage der Erde zur Sonne als der Beherrscherin der irdischen Großwetterlage. Wenn also heute etwa der 24. Februar als Lostag gilt, so lag früher diese entscheidende Wetterwende am 25., 26., 27. Februar, am 4., 5., 6., 15. März und noch weiter im Jahr, je tiefer wir in der Zeit zurückgehen. Das muß in entsprechenden Fällen berücksichtigt werden. Denn viele Bauernregeln scheinen uralt zu sein. Wir dürfen uns da nicht durch ihre Verknüpfung mit der christlichen Mythologie irre machen lassen. Das Auftreten christlicher Heiliger in den Regeln besagt für das Alter des Urwissens, oder besser, die Jugend einer Volksweisheit nicht das Geringste; denn es ist anzunehmen, daß Karl des Franken und des frommen Ludewigs Zertrümmerung alles Germanischen nicht bei den Heiligtümern, den Schriften oder den Flurbenennungen halt gemacht hat, sich nicht darin erschöpfte, alte germanische Heiligtümer mit christlichen Kapellen zu bebauen, heilige und mit den Gottesnamen gezierte Täler, Haine und Berge als Teufelsschlucht, Totengrund, Satanswiese, Hexenberg oder mit ähnlich schmückenden Beinamen zu versehen, sondern fast auch alles, was sonst an echt germanischen Weistum erinnerte, durch römische Apostel im Laufe der Zeit gegen christliche Dinge ausgewechselt wurde.
Das alles sollte berücksichtigt werden, wollen wir das gesamte Urwissen des Volkes in seiner Sinnhaftigkeit wieder zur Geltung bringen.
Gewiß ist es Absicht dieser Zeilen, auf den Wert auch der Bauernregeln hinzuweisen. Und an Hand der Heliobiologie und der Welteislehre wollen wir versuchen, einen kleinen Teil des bäuerlichen Urwissens auf seine Verläßlichkeit zu prüfen. Dabei kann es sich gewißlich nur um eine oberflächliche Betrachtung handeln, die indessen frei von Oberflächlichkeit im Urteil bleibt.
Das zu betonen ist nicht ganz unwichtig, denn gerade beim Urwissen beobachten wir immer wieder, wie die Wissenschaft jene Dinge belächelt und ablehnt, die dem Landbewohner als feststehende Tatsachen gelten. Daß etwa Mond und Wetter in engem Zusammenhange stehen, gilt dem Urwissen ebenso als unerschütterliche Tatsache, wie der Wissenschaft als Aberglaube derer, die nicht alle werden.
Da ist die landläufige und
kaum bestrittene Behauptung, daß
der Mond Regen künde, wenn er einen Hof habe.
Und nun beobachte man sich doch einmal selbst! Wenn sich an irgend einem Tage plötzlich nervöse Reizzustände zeigen, wenn man sich über Kleinigkeiten ärgert, die sonst als gänzlich nebensächlich erscheinen, wenn also jener Zustand merkbar wird, der bereits zum Verschütten des Salzes führte, der die Enten stark schnattern und die Klatschbasen schwatzen läßt, dann betrachte man, sofern es möglich, den abendlichen Mond. Und man wird erstaunt sein: Das Nachtgestirn zeigt dann fast ausnahmslos einen Hof.
In diesem Zusammenhange soll auf die, wenn wir von der Wissenschaft absehen, überall verbreitete Überzeugung hingewiesen werden, daß Neumond und seine benachbarten Tage einen Wetterwechsel bringen können. Dieser Wechsel kann erfahrungsgemäß bereits zwei und mehr Tage vor dem eigentlichen Neumond, in abgemilderterem Maße vor dem Vollmond, eintreten (Abb.1).
Und nun beobachte man sich doch einmal selbst! Wenn sich an irgend einem Tage plötzlich nervöse Reizzustände zeigen, wenn man sich über Kleinigkeiten ärgert, die sonst als gänzlich nebensächlich erscheinen, wenn also jener Zustand merkbar wird, der bereits zum Verschütten des Salzes führte, der die Enten stark schnattern und die Klatschbasen schwatzen läßt, dann betrachte man, sofern es möglich, den abendlichen Mond. Und man wird erstaunt sein: Das Nachtgestirn zeigt dann fast ausnahmslos einen Hof.
In diesem Zusammenhange soll auf die, wenn wir von der Wissenschaft absehen, überall verbreitete Überzeugung hingewiesen werden, daß Neumond und seine benachbarten Tage einen Wetterwechsel bringen können. Dieser Wechsel kann erfahrungsgemäß bereits zwei und mehr Tage vor dem eigentlichen Neumond, in abgemilderterem Maße vor dem Vollmond, eintreten (Abb.1).
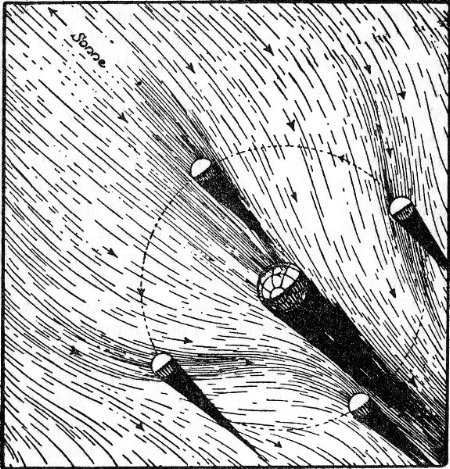
(Bildquelle/-text: Buch "Der
Weg ins Unbetretene" von Hanns Fischer, Verlag Hermann
Eschenhagen/Breslau, 1935)
Abb.1: Erde und Mond.
Links oben ist die Sonne zu denken. Vom Gebiete des Polarsternes
aus gesehen, sind die einzelnen Mondphasen sichtbar gemacht.
Das alles, so fern es der
Denkebene des Wissenschaftlers auch liegen
mag, ist für uns gar nicht schwer zu erklären; denn auch der
Mond besitzt ja genau wie die Erde eine elektronegative Ladung,
muß also in seiner Stellung zwischen Erde und Sonne, also zur
Neumondzeit, den Feineisstrom zur Erde verdichten und somit Leben und
Wetter einer gesteigerten Anwirkung aussetzen, mithin beeinflussen.
Wir werden uns aber sofort sagen, daß hier sehr eigenartige Verhältnisse mitspielen. In Sonnennähe, also während unseres Winters, wird, ganz allgemein gesprochen, die Dichte des Feineisstromes zunehmen; damit wird dann der Wetter-Einfluß des Neumondes gesteigert erscheinen. In Sonnenferne dagegen, also während unseres Sommers, wenn die Nordhalbkugel dem Tagesgestirn zugewendet ist, wird sich die Dichte des Feineisstromes und damit auch die Mondeswirkung verringern.
In beiden Fällen aber werden die erregenden elektrischen Wirkungen vom Leben wahrgenommen.
Und hier treffen wir nun auf sehr feine Beobachtungen, die uns erstmalig den Sinn auch der uralten früh- und vorgeschichtlichen Sternwarten klarwerden lassen.
Es könnte nämlich so scheinen, als sei auch hier reine Wissenschaft am Werke gewesen. Hören wir nun heute von bedeutenden Fachleuten, gerade die Himmelskunde erlaube nur äußerst geringe praktische Auswertung und sei vorwiegend eine Wissenschaft um der Wissenschaft willen, so war es in der Frühzeit nicht nur anders, sondern die Astronomie war in der Tat Inhalt eines königlichen Wissens. Sie hat sich keineswegs damit begnügt, nur den groben Rhythmus des Jahres und den Eintritt der Jahreszeiten festzulegen, um damit der Landwirtschaft zu dienen, sondern sie ist das Wissen vom Leben gewesen.
Wir brauchen hier nicht von neuem die Fernsichten abzuschreiten, welche uns den innigen Zusammenhang des Baustils der Urzeit mit der Himmelskunde dartun; nicht den Beweis zu erbringen, welche ursächliche Verknüpfung zwischen dem bisher so dunklen Sinn der Pyramiden, ihrer Entstehung überhaupt und der Astronomie bestehen, sondern uns nur mit dem heute noch lebendigen Urwissen zu beschäftigen.
Wir müssen da schon hier die eigentlichen Wetterregeln für kurze Zeit verlassen, um auch einen Volksbrauch heranzuziehen und zu betrachten.
Wir werden uns aber sofort sagen, daß hier sehr eigenartige Verhältnisse mitspielen. In Sonnennähe, also während unseres Winters, wird, ganz allgemein gesprochen, die Dichte des Feineisstromes zunehmen; damit wird dann der Wetter-Einfluß des Neumondes gesteigert erscheinen. In Sonnenferne dagegen, also während unseres Sommers, wenn die Nordhalbkugel dem Tagesgestirn zugewendet ist, wird sich die Dichte des Feineisstromes und damit auch die Mondeswirkung verringern.
In beiden Fällen aber werden die erregenden elektrischen Wirkungen vom Leben wahrgenommen.
Und hier treffen wir nun auf sehr feine Beobachtungen, die uns erstmalig den Sinn auch der uralten früh- und vorgeschichtlichen Sternwarten klarwerden lassen.
Es könnte nämlich so scheinen, als sei auch hier reine Wissenschaft am Werke gewesen. Hören wir nun heute von bedeutenden Fachleuten, gerade die Himmelskunde erlaube nur äußerst geringe praktische Auswertung und sei vorwiegend eine Wissenschaft um der Wissenschaft willen, so war es in der Frühzeit nicht nur anders, sondern die Astronomie war in der Tat Inhalt eines königlichen Wissens. Sie hat sich keineswegs damit begnügt, nur den groben Rhythmus des Jahres und den Eintritt der Jahreszeiten festzulegen, um damit der Landwirtschaft zu dienen, sondern sie ist das Wissen vom Leben gewesen.
Wir brauchen hier nicht von neuem die Fernsichten abzuschreiten, welche uns den innigen Zusammenhang des Baustils der Urzeit mit der Himmelskunde dartun; nicht den Beweis zu erbringen, welche ursächliche Verknüpfung zwischen dem bisher so dunklen Sinn der Pyramiden, ihrer Entstehung überhaupt und der Astronomie bestehen, sondern uns nur mit dem heute noch lebendigen Urwissen zu beschäftigen.
Wir müssen da schon hier die eigentlichen Wetterregeln für kurze Zeit verlassen, um auch einen Volksbrauch heranzuziehen und zu betrachten.
Wiederholen wir jedenfalls,
daß in der Neumondzeit nicht nur das
Wetter leicht zu wechseln pflegt, sondern daß hier auch das Leben
durch erregende elektrische Wirkungen beeinflußt wird.
Diese Erregung macht sich auch auf sexuellem Gebiete bemerkbar, wie
jeder an sich selbst leicht zu beobachten vermag.
Deswegen wird in Niedersachsen noch heute vorwiegend bei zunehmendem Monde geheiratet, eine Sitte, der die gleiche Absicht zu Grunde liegt, wie wir sie bei der Betrachtung der Stillen Wochen am Ende des natürlichen Jahres fanden.
Daß hier auch für Saat und Ernte wesentliche Einsichten schlummern, werden wir noch erfahren. Deutlich wird zudem auch die Voraussetzung des altgermanischen Brauches, nur "Gottheiten" zu verehren, welche eine unmittelbare Unterstützung gewähren. Zu diesen Gottheiten, die nur Sinnbilder des Naturgeschehens und gewiß keine Götzen in unserem Sinne waren, gehörte auch der Mond.
So wußte man auch seit frühesten Zeiten um die Tatsache, daß der Schlaf zur Vollmondzeit vielfach sehr leicht und ohne die erwünschte stärkende Wirkung war, mehr ein Schlafwachen. Bisher ist für diese Erscheinung wohl keine Erklärung gegeben worden. Sie liegt aber ganz nahe; denn wenn der Mond in einer Richtung Sonne-Erde-Mond steht, also zur Vollmondzeit, so wird zweifellos durch die von Erde und Mond verdichtete Feineisstrahlung eine elektrische Verbindung zwischen unserem Heimatgestirn und dem nächtlichen Begleiter hergestellt und so auch die Nachtseite der Erde, die sonst nur durch merkwürdige Feineisraffungen des magnetischen Nordpols beunruhigt wird, elektrisch erregt. So ist es zu erklären, daß der Schlaf flach und das Wachstum der Pflanzen gefördert wird.
Der Landbewohner weiß, wie gerade um die Vollmondzeit etwa die Pilze erstaunlich wachsen. Man kann am Tage vor Vollmond eine Waldlichtung besucht und nicht einen Pilz entdeckt haben. Geht gar noch ein Regenschauer nieder und besucht man nun am folgenden Tage die gleiche Stelle, so kann sie mit Schwämmen übersät sein.
Hier endlich finden wir nun auch die Zusammenhänge zwischen den Ansichten des Volkes über die Wirkungen der Gestirne auf den Pflanzenwuchs an den Kreuzwegen und die Güte der dort gedeihenden Heilgewächse.
Deswegen wird in Niedersachsen noch heute vorwiegend bei zunehmendem Monde geheiratet, eine Sitte, der die gleiche Absicht zu Grunde liegt, wie wir sie bei der Betrachtung der Stillen Wochen am Ende des natürlichen Jahres fanden.
Daß hier auch für Saat und Ernte wesentliche Einsichten schlummern, werden wir noch erfahren. Deutlich wird zudem auch die Voraussetzung des altgermanischen Brauches, nur "Gottheiten" zu verehren, welche eine unmittelbare Unterstützung gewähren. Zu diesen Gottheiten, die nur Sinnbilder des Naturgeschehens und gewiß keine Götzen in unserem Sinne waren, gehörte auch der Mond.
So wußte man auch seit frühesten Zeiten um die Tatsache, daß der Schlaf zur Vollmondzeit vielfach sehr leicht und ohne die erwünschte stärkende Wirkung war, mehr ein Schlafwachen. Bisher ist für diese Erscheinung wohl keine Erklärung gegeben worden. Sie liegt aber ganz nahe; denn wenn der Mond in einer Richtung Sonne-Erde-Mond steht, also zur Vollmondzeit, so wird zweifellos durch die von Erde und Mond verdichtete Feineisstrahlung eine elektrische Verbindung zwischen unserem Heimatgestirn und dem nächtlichen Begleiter hergestellt und so auch die Nachtseite der Erde, die sonst nur durch merkwürdige Feineisraffungen des magnetischen Nordpols beunruhigt wird, elektrisch erregt. So ist es zu erklären, daß der Schlaf flach und das Wachstum der Pflanzen gefördert wird.
Der Landbewohner weiß, wie gerade um die Vollmondzeit etwa die Pilze erstaunlich wachsen. Man kann am Tage vor Vollmond eine Waldlichtung besucht und nicht einen Pilz entdeckt haben. Geht gar noch ein Regenschauer nieder und besucht man nun am folgenden Tage die gleiche Stelle, so kann sie mit Schwämmen übersät sein.
Hier endlich finden wir nun auch die Zusammenhänge zwischen den Ansichten des Volkes über die Wirkungen der Gestirne auf den Pflanzenwuchs an den Kreuzwegen und die Güte der dort gedeihenden Heilgewächse.
Über solchen "Aberglauben"
hat natürlich unser sachliches
Zeitalter seine bissigen Glossen gemacht, hat aber trotzdem, wenn es
galt, eine würzige Erdbeerbowle anzusetzen, sehr genau darauf
geachtet, daß die Erdbeeren in aller Morgenfrühe,
keinesfalls aber nach sechs Uhr gepflückt wurden, da sie nur dann
jenes Aroma aufwiesen, das wir an ihnen schätzen.
Desgleichen tat jener Schlecker, der sie mit süßer Sahne
verspeiste und sich dabei lustig machte über den kindlichen
Landmann, der etwa Hollunderblüten gerade am Johannistage
pflückte, weil der hieraus hergestellte vortreffliche Tee
besonders heilkräftig gegen Fieber und Erkältungen wirkt.
Solange uns nun der Bowlen- und Erdbeerfreund nicht verrät, warum er die köstlich duftenden Früchte in aller Frühe und nicht am Tage pflückt und solange er uns nur entgegnet, es geschähe dies, weil die Erdbeeren nur dann den höchsten Gaumenkitzel erzeugten, solange mag er auch unsere Ansicht, gewisse Heilkräuter seien, am Johannistage oder bei bestimmten Gestirnsstellungen an Kreuzwegen geerntet, besonders wertvoll, als eine schlichte Erfahrung gelten lassen. Andernfalls möge er ins Säckel greifen und ein Dutzend Doktorarbeiten finanzieren, damit er wissenschaftlich erfahre, was der Bauer seit uralter Zeit ohnehin schon weiß, daß etwa der Vollmond für die einen, daß Mond und Sonne gleichzeitig am Himmel für die anderen, daß die Johannisnacht für die dritten oder gar die stark strahlenden Kreuzwege in Verbindung mit den erstgenannten Einflüssen auf die letzten Pflanzengattungen besonders günstig wirken.
Solange uns nun der Bowlen- und Erdbeerfreund nicht verrät, warum er die köstlich duftenden Früchte in aller Frühe und nicht am Tage pflückt und solange er uns nur entgegnet, es geschähe dies, weil die Erdbeeren nur dann den höchsten Gaumenkitzel erzeugten, solange mag er auch unsere Ansicht, gewisse Heilkräuter seien, am Johannistage oder bei bestimmten Gestirnsstellungen an Kreuzwegen geerntet, besonders wertvoll, als eine schlichte Erfahrung gelten lassen. Andernfalls möge er ins Säckel greifen und ein Dutzend Doktorarbeiten finanzieren, damit er wissenschaftlich erfahre, was der Bauer seit uralter Zeit ohnehin schon weiß, daß etwa der Vollmond für die einen, daß Mond und Sonne gleichzeitig am Himmel für die anderen, daß die Johannisnacht für die dritten oder gar die stark strahlenden Kreuzwege in Verbindung mit den erstgenannten Einflüssen auf die letzten Pflanzengattungen besonders günstig wirken.
Wohin wir also auch blicken:
Überall sind wesentliche und
lebenswichtige naturnotwendige Einsichten im Urwissen niedergelegt.
Damit soll keineswegs gesagt sein, wir überschauten alle Zusammenhänge. Solches zu behaupten, liegt nicht in unserer Absicht. Uns geht es, um diesen Standpunkt von neuem hervorzuheben darum, den Wert des Urwissens ins Licht zu rücken. Darum machten wir den Umweg über die alten niedersächsischen Heiratsbräuche. Auch sie sind Ausfluß einer urtümlichen Naturerkenntnis, genau so wie der unwandelbare Glaube an die Lostage, von denen wir ausgingen und zu denen wir nun wieder zurückkehren. Gewiß waren ihre Grundlagen bisher verhüllt und gewiß wurden sie und ihr Wert verkannt. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, daß die neueste Fachwetterkunde durch die Wiederentdeckung gewisser Wetterperioden, etwa der im Volkswissen oft genannten annähernd 45tägigen, ihre ablehnende Haltung den Lostagen gegenüber gewiß erst ganz vereinzelt, aber doch bereits gemildert hat. Da indessen die Ursachen der fraglichen Periodizität nur durch die Welteislehre erkannt werden können, seien hier eben auf Grund der Hörbigerschen Forschungen wenigstens einige Hinweise gegeben, welche die Richtigkeit des Urwissens erkennen lassen.
Hörbiger hat sich mit diesen Dingen nicht befaßt. Seine hier berücksichtigten Ergebnisse sind einzig und allein als grundsätzliche Feststellung über die während eines Jahres im Laufe der einzelnen Monate zur Erde gelangenden Feineismengen einschließlich ihrer Wetterwirkungen aufzufassen. Trotzdem hat Hörbiger hier unabsichtlich gerade für uns hochwertvolle Arbeit geliefert. Wenn wir seine Feststellungen betrachten, so erkennen wir, daß in sogenannten Normaljahren etwa am 2. Februar eine verstärkte Feineismenge zur Erde gelangt. Diese Stärke schwankt ebenso wie der genaue Termin in gewissen Grenzen und mit ihr harmonisch alle übrigen Feineiszuflüsse der kommenden Zeit auf Grund uns bekannte kosmischer Regelmäßigkeiten. Gerade diese Regelmäßigkeiten bringen es nun mit sich, daß die Verhältnisse in engen Grenzen derart verschoben sein können, daß sich etwa der Februarhöcker, also der Nachwinter-Kälteeinbruch, weiter in den Februar hinein verlagert. Dann also weist der 2. Februar einen weit geringeren Feineiszufluß auf. Tritt dieser Zustand ein, dann wird der im Urwissen verankerte, meist strenge Februar-Nachwinter eingeleitet sein durch eine Spanne wärmerer Tage, die zwischen ihm und dem im November-Dezember auftretenden Vorwinter liegen. Das hat das Volk sehr genau beobachtet, denn in diese Zeit fällt ein wichtiger Lostag, Lichtmeß am 2. Februar, von dem es heißt:
Damit soll keineswegs gesagt sein, wir überschauten alle Zusammenhänge. Solches zu behaupten, liegt nicht in unserer Absicht. Uns geht es, um diesen Standpunkt von neuem hervorzuheben darum, den Wert des Urwissens ins Licht zu rücken. Darum machten wir den Umweg über die alten niedersächsischen Heiratsbräuche. Auch sie sind Ausfluß einer urtümlichen Naturerkenntnis, genau so wie der unwandelbare Glaube an die Lostage, von denen wir ausgingen und zu denen wir nun wieder zurückkehren. Gewiß waren ihre Grundlagen bisher verhüllt und gewiß wurden sie und ihr Wert verkannt. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, daß die neueste Fachwetterkunde durch die Wiederentdeckung gewisser Wetterperioden, etwa der im Volkswissen oft genannten annähernd 45tägigen, ihre ablehnende Haltung den Lostagen gegenüber gewiß erst ganz vereinzelt, aber doch bereits gemildert hat. Da indessen die Ursachen der fraglichen Periodizität nur durch die Welteislehre erkannt werden können, seien hier eben auf Grund der Hörbigerschen Forschungen wenigstens einige Hinweise gegeben, welche die Richtigkeit des Urwissens erkennen lassen.
Hörbiger hat sich mit diesen Dingen nicht befaßt. Seine hier berücksichtigten Ergebnisse sind einzig und allein als grundsätzliche Feststellung über die während eines Jahres im Laufe der einzelnen Monate zur Erde gelangenden Feineismengen einschließlich ihrer Wetterwirkungen aufzufassen. Trotzdem hat Hörbiger hier unabsichtlich gerade für uns hochwertvolle Arbeit geliefert. Wenn wir seine Feststellungen betrachten, so erkennen wir, daß in sogenannten Normaljahren etwa am 2. Februar eine verstärkte Feineismenge zur Erde gelangt. Diese Stärke schwankt ebenso wie der genaue Termin in gewissen Grenzen und mit ihr harmonisch alle übrigen Feineiszuflüsse der kommenden Zeit auf Grund uns bekannte kosmischer Regelmäßigkeiten. Gerade diese Regelmäßigkeiten bringen es nun mit sich, daß die Verhältnisse in engen Grenzen derart verschoben sein können, daß sich etwa der Februarhöcker, also der Nachwinter-Kälteeinbruch, weiter in den Februar hinein verlagert. Dann also weist der 2. Februar einen weit geringeren Feineiszufluß auf. Tritt dieser Zustand ein, dann wird der im Urwissen verankerte, meist strenge Februar-Nachwinter eingeleitet sein durch eine Spanne wärmerer Tage, die zwischen ihm und dem im November-Dezember auftretenden Vorwinter liegen. Das hat das Volk sehr genau beobachtet, denn in diese Zeit fällt ein wichtiger Lostag, Lichtmeß am 2. Februar, von dem es heißt:
Sonnt sich der Dachs in der
Lichtmeßwoche,
Geht auf vier Wochen er wieder zu Loche.
Damit ist das zu erwartende kalte Wetter angedeutet. Ganz in der
gleichen Richtung bewegt sich die Bauernregel:Geht auf vier Wochen er wieder zu Loche.
Scheint die Sonne an
Lichtmeß hell,
Kommt noch viel Schnee zur Stell.
Die oben erwähnte Verschiebung ins Jahr hinein ist betont in dem
Reim:Kommt noch viel Schnee zur Stell.
Lichtmeß im Klee,
Ostern im Schnee.
Dagegen:Ostern im Schnee.
Wenn es Lichtmeß
stürmt und schneit.
Ist der Frühling nicht mehr weit.
In diesem Falle ist also der harte Nachwinter in den Februaranfang
gerückt und alle weiteren Feineiszuflüsse der kommenden Zeit
verlagern sich harmonisch, derart, daß eine Wettervoraussage auf
weite Sicht möglich ist. Darum:Ist der Frühling nicht mehr weit.
Lichtmeß hell und klar -
Wird die Roggenähre schwar.
Lichtmeß bunt -
Wächst´s auf dem Berg und im Grund.
Lichtmeß Regen -
Bringt keinen Segen.
Wird die Roggenähre schwar.
Lichtmeß bunt -
Wächst´s auf dem Berg und im Grund.
Lichtmeß Regen -
Bringt keinen Segen.
Wesentlich scheint also die
Trennung von Vor- und Nachwinter zu sein,
jedoch derart, daß um Lichtmeß kaltes, klares Wetter
herrschen muß, um den Groß-Wetterablauf des Jahres als landwirtschaftlich "gut" für
den Bauern voraussagen zu können. Hier scheint auf Grund
mehrjähriger Beobachtungen wenigstens für die Lüneburger
Haide Lichtmeß als Lostag am 2. Februar zu stimmen. Eine
Verschiebung ist also nicht nötig. Ähnlich liegen die
Verhältnisse bei Petri
Stuhlfeier am 22. Februar, von dessen Bedeutung wir schon
sprachen als dem Frostkünder für die folgenden vierzig
Tage. Er soll allerdings nur zuverlässig dann sein, wenn es
am Matthiastage, also am 24. Februar, ebenfalls friert.
Betrachten wir die Ergebnisse Hörbigers, dann ergibt sich bei
einem frostigen 22. und 24. Februar zwangsläufig eine den
März füllende kalte Zeit, wie sie uns der sibirische Winter
1928/29 brachte, in dem es am 23. Februar so sommerlich warm war,
daß fußhoher Schnee an diesem Tage wegschmolz, um durch den
am 24. einsetzenden harten Frost die Erde mit einer Eisschicht zu
durchsetzen, die erst im April zu tauen begann.
Ein ganz hervorragender Lostag ist der bewegliche Karfreitag, sofern er, worauf hier nicht näher eingegangen werden kann, sinngemäß angewendet wird:
Wenn es am Stillen Freitag
regnet,
Regnets auf den heißen Stein!
sagt man in der Haide. Das will meinen: Regen am Karfreitag
bedeute einen trockenen Sommer. Auch hier hat die Beobachtung
gelehrt: Immer ist das zu erwartende Wetter eingetreten.Regnets auf den heißen Stein!
Wenn Karfreitag Sonnenglut
Werden Korn und Hafer gut.
Stillen Freitag drög
Wachst der Haber auf der Hög.
Werden Korn und Hafer gut.
Stillen Freitag drög
Wachst der Haber auf der Hög.
Ein weiterer Lostag ist der 25. April, der St. Martinstag:
Was St. Martin für Wetter
hält,
So ist´s auch in der Ernte bestellt.
So ist´s auch in der Ernte bestellt.
Wie uns Hanns Hörbiger
zeigt, sind Ende April und Mitte Juli
erhebliche Wetter-Ähnlichkeiten vorhanden, so daß diese
Bauernregel gewiß vollkommen zuverlässig ist. Gleich
nach dem vom Bauern sehr gut beobachteten alten Maitag, dem heutigen
11. Mai beginnen neue, starke Feineiszuflüsse. Das besagt
Regen- und Kälte-Rückfälle.
Mai, kühl und naß,Füllt dem Bauern Scheuer und Faß.
Um diese Zeit, vom 11.-13- Mai,
liegen aber die Gestrengen Herren, die Eisheiligen,
oder wie der
Niedersachse sagt, der Schwarzdornwinter,
jene gefürchteten Tage oder besser Nächte, deren Fröste
oft alle Frühlingsschönheit zerstören. Wir sehen
eben auch hier die kosmische Einwirkung auf das Leben.
Auf diese Einflüsse
sind auch die
Kälterückfälle im Juni zurückzuführen.
Diese Zeit wird in der Lüneburger Haide als Starenwinter bezeichnet, da hier
erst um diese Zeit die jungen Stare ausfliegen. In meiner Heimat
Schlesien dagegen geschieht dies früher, denn hier heißt es:
In der Pfingstwoche
Bleibt kein Star mehr im Loche.
Den stärksten Kälterückfällen dieser kühlen Zeit, den Eisheiligen im Mai, liegt - kosmisch gesehen- nun genau der 14. November gegenüber, der im Urwissen als jener Tag gilt, an dem der erste Schnee zu erwarten steht. Vergleichen wir hierzu Abb. 2, so erkennen wir sofort die kosmischen Zusammenhänge.
In der Pfingstwoche
Bleibt kein Star mehr im Loche.
Den stärksten Kälterückfällen dieser kühlen Zeit, den Eisheiligen im Mai, liegt - kosmisch gesehen- nun genau der 14. November gegenüber, der im Urwissen als jener Tag gilt, an dem der erste Schnee zu erwarten steht. Vergleichen wir hierzu Abb. 2, so erkennen wir sofort die kosmischen Zusammenhänge.
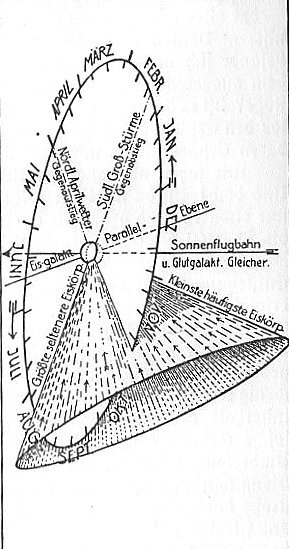
(Bildquelle und -text:
Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)
Abb.
2: Man sieht,
daß
die Erde
diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um
Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu
welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der
Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im
widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen
Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)
Gerade in diesem Beispiel zeigt
sich deutlich, wie ungeheuer fein das
Volk beobachtet.
Das erkennbar zu machen, war unsere Aufgabe, nicht aber, den ganzen Schatz der Bauernregeln abzuhandeln.
Damit wollen wir auch den Vergleich des Urwissens mit den Feststellungen Hörbigers über den Feineiszufluß zur Erde und das von seiner Menge abhängige warm-feuchte Sommerwetter und infolge der besonders dichten Feineisbeschickung kalte Winterwetter der nördlichen Halbkugel abbrechen.
Das erkennbar zu machen, war unsere Aufgabe, nicht aber, den ganzen Schatz der Bauernregeln abzuhandeln.
Damit wollen wir auch den Vergleich des Urwissens mit den Feststellungen Hörbigers über den Feineiszufluß zur Erde und das von seiner Menge abhängige warm-feuchte Sommerwetter und infolge der besonders dichten Feineisbeschickung kalte Winterwetter der nördlichen Halbkugel abbrechen.
Es lag uns bei dieser wenig
reizvollen Betrachtung nicht etwa daran,
den Wert der Welteislehre zu erhärten, auch nicht daran zu
betonen, daß die amtliche Wetterkunde noch nicht genügend
weit vorgedrungen ist, um über die Wetterrhythmen Hinreichendes
aussagen zu können, sondern wir verwendeten die Hörbigerschen
Einsichten aus dem Grunde, weil sie absichtslos die einzige
Möglichkeit geben, die Richtigkeit des Urwissens
aufzuzeigen. Und das sollte zunächst gerade an dem Beispiel
der rätselhaften Bauernregeln, an den bisher gänzlich
undurchschaubaren Lostagen geschehen.
Hörbigers Forschungen erlaubten uns zudem, eine Entscheidung zu treffen, ob die Lostage aus Kalenderursachen verschoben werden müssen oder nicht.
Jedenfalls zeigen uns die Lostage von neuem ein ganz erhebliches Wissen; ein Wissen, das auch hier wieder die Wissenschaft an Tiefe und Verläßlichkeit ungeheuer überragt. Mit unseren "Beweisen" sind wir zwar um nichts schlauer geworden. Vielleicht könnten wir meinen, die Einsichten in die Wechselwirkung zwischen Kosmos und Erde, in die Feineisbestreuung unseres Sternes überrage dennoch das Urwissen. Das aber ist nicht der Fall; denn alles Lebensnötige ist bereits im Urwissen enthalten, ohne daß wir uns um Feineisanblasungen, Sonnenbefleckung oder um die Leitfähigkeit der Luft zu kümmern hätten. Wesentlich und die überragende Größe der Welteislehre ist allein die Tatsache, daß es nur mit den Entdeckungen Hörbigers gelingt, die Richtlinie des Urwissens für den Zivilisationsmenschen nachzuweisen. Aus dieser Feststellung wird klar, daß allein Hörbigers geniale Entdeckung es vermag, den Naturentfremdeten wieder zur wirklichen Natur hinzuführen. Hierin liegt die Größe der Welteislehre für unsere kulturarme Zeit; denn hier schlummert die einzige Möglichkeit, den Suchenden nicht nur auf der Ebene des Materialismus zu befriedigen, sondern ihm jenseits der rein mechanischen Kosmotechnik auf dem Wege über die Heliobiologie den Kosmos als lebendiges Wesen zu erschließen, um zum Sinn der Dinge vorzudringen.
Es muß darum unumwunden ausgesprochen werden: Weder die Wissenschaft noch die Welteislehre als Kosmotechnik vermögen dem Naturnahen jenes Urwissen des Volkes zu ersetzen, dessen Meisterlichkeit sich in der Beschränkung auf das Lebensnötige zeigt. Damit wird die ungeheure Aufgabe nicht verringert, welche der Welteislehre zu erfüllen möglich ist, nämlich den Berufenen den Weg zur Natur und damit zum Menschentum zu erleichtern. Mit diesem Wege allerdings ist noch lange nicht das Ziel erreicht, das im harmonischen Einschwingen des Lebens und in der schöpferischen Kunst des Auserwählten gipfelt.
Hörbigers Forschungen erlaubten uns zudem, eine Entscheidung zu treffen, ob die Lostage aus Kalenderursachen verschoben werden müssen oder nicht.
Jedenfalls zeigen uns die Lostage von neuem ein ganz erhebliches Wissen; ein Wissen, das auch hier wieder die Wissenschaft an Tiefe und Verläßlichkeit ungeheuer überragt. Mit unseren "Beweisen" sind wir zwar um nichts schlauer geworden. Vielleicht könnten wir meinen, die Einsichten in die Wechselwirkung zwischen Kosmos und Erde, in die Feineisbestreuung unseres Sternes überrage dennoch das Urwissen. Das aber ist nicht der Fall; denn alles Lebensnötige ist bereits im Urwissen enthalten, ohne daß wir uns um Feineisanblasungen, Sonnenbefleckung oder um die Leitfähigkeit der Luft zu kümmern hätten. Wesentlich und die überragende Größe der Welteislehre ist allein die Tatsache, daß es nur mit den Entdeckungen Hörbigers gelingt, die Richtlinie des Urwissens für den Zivilisationsmenschen nachzuweisen. Aus dieser Feststellung wird klar, daß allein Hörbigers geniale Entdeckung es vermag, den Naturentfremdeten wieder zur wirklichen Natur hinzuführen. Hierin liegt die Größe der Welteislehre für unsere kulturarme Zeit; denn hier schlummert die einzige Möglichkeit, den Suchenden nicht nur auf der Ebene des Materialismus zu befriedigen, sondern ihm jenseits der rein mechanischen Kosmotechnik auf dem Wege über die Heliobiologie den Kosmos als lebendiges Wesen zu erschließen, um zum Sinn der Dinge vorzudringen.
Es muß darum unumwunden ausgesprochen werden: Weder die Wissenschaft noch die Welteislehre als Kosmotechnik vermögen dem Naturnahen jenes Urwissen des Volkes zu ersetzen, dessen Meisterlichkeit sich in der Beschränkung auf das Lebensnötige zeigt. Damit wird die ungeheure Aufgabe nicht verringert, welche der Welteislehre zu erfüllen möglich ist, nämlich den Berufenen den Weg zur Natur und damit zum Menschentum zu erleichtern. Mit diesem Wege allerdings ist noch lange nicht das Ziel erreicht, das im harmonischen Einschwingen des Lebens und in der schöpferischen Kunst des Auserwählten gipfelt.
Blicken wir aber nun mit diesen
Einsichten zurück auf das uns hier
vertraut gewordene Weistum des Volkes, so bemächtigt sich uns eine
geradezu verehrende Bewunderung für die Bedeutung der jahrtausende
alten Beobachtungen. Wer die Vorgänge der Natur mit dem
Schatz des Urwissens jahrelang vergleicht, der wird erstaunt sein zu
finden, wie wenige Regeln in bejahendem Sinne jährlich Anwendung
finden können. Denken wir überdies daran, wie gewaltig
die Zeiträume sein können, nach denen sich gleiche
Verhältnisse wiederholen, so müssen viele Jahrtausende dazu
gedient haben, die Regeln der Lostage überhaupt erst werden zu
lassen. Wir sind also gezwungen, sehr lange Spannen der
Beobachtung deswegen vorauszusetzen, weil die äußeren
kosmischen Einflüsse in jahrhundertelangen Rhythmen jene
Verschiebungen bedingen, die wir nachdrücklich hervorhoben.
Wahrscheinlich wird es sich beim Volkswissen nicht so sehr um die Ergebnisse scharfer Beobachtungen einer breiten Bauernschicht als vielmehr um das handeln, was früh- und vorgeschichtliche Sternwarten erarbeiteten, jene Sternwarten, wie wir sie in den Extern-Steinen, in den Stufenpyramiden, in den Steinkreisen und in den Resten sonstiger uralter Himmelswarten vor uns haben.
Die damaligen Sternbeobachter lösten keine wissenschaftlichen Aufgaben, sondern behüteten das Leben und erarbeiteten im ewigen Fluß des Geschehens die Richtlinien, die Regeln, welche das Leben im natürlichen Gleichgewicht hielten und es vor Schädigungen bewahrten. Solche Regeln sind also keine lebensfremd-exakten Gesetze, sondern beziehen sich, wie bei den Lostagen, auf die allgemeine Großwettergestaltung mehrerer Wochen oder Monate und damit auch auf das kosmisch bedingte Leben überhaupt. Immer aber alles aus der Welt des Erdverbundenen, des Bauern gesehen! Es ist darum, um diese Tatsache nochmals zu betonen, also keineswegs gesagt, etwa die nassen auf einen regnerischen Siebenbrüdertag folgenden Wochen müßten nun von pausenlosem Regen angefüllt sein. Eine solche Erwartung vermöchte nur ein völlig Naturentwöhnter auszusprechen; denn der Inhalt der Bauernregeln ist immer und ausnahmslos auf die Bedeutung des Wetters für den Landmann, also den natürlich Lebenden gerichtet. Schiebt sich also in eine Regenperiode eine Anzahl schöner Tage ein, so besagt das gar nichts gegen die Regel, da einzelne Sonnentage für die Maßnahmen des Landwirtes zur Erhaltung des Lebens bedeutungslos sind. Indessen versteht der Landbewohner sehr wohl sie zu nützen. Keineswegs wird er etwa von ihnen auf Grund eines sturen Glaubens an die "sieben" Regenwochen überrascht. Er hockt nämlich auch dann nicht abwartend in der Stube, sondern ist täglich draußen in Wald und Feld. Nichts entgeht seinem scharfen und geschulten Auge, so nebensächlich es auch dem Städter erscheinen mag.
Wir beobachten etwa in einer regenlosen Zeit. Wie wichtig oft ganz alltägliche Dinge zu werden vermögen, wenn wir im Buch der Natur zu lesen versuchen, das soll uns ein Beispiel zeigen. Wir beobachten bei zunehmendem Monde einen Hof. Nach alter Volksregel ist dann Regen zu erwarten. Unbedenklich wird der Naturfremde diese Voraussage stellen und, wenn er etwas mehr von dem Urweistum kennt, die Frist des Regenbeginns vielleicht auf den übernächsten Tag angeben. Der nächste Tag ist hell. Um so sicherer wird unser Wetterprophet für den kommenden Tag das vorhergesagte Naß erwarten. Beobachtet er feiner, dann stellt er bei Mensch und Tier auch die Nervenerregungen fest, die ihn in seinem Schlusse noch weiter bestärken. Und wirklich ist es am anderen Morgen trüb. Beim Frühspaziergang begegnet er einem Bauern. Und wenn er nicht ein eingefleischter Städter ist, dann grüßt er den Landmann, bleibt einen Augenblick stehen, schaut bedenklich nach dem Himmel und bringt seine Weisheit an.
Aber der Bauer lächelt: "Regen
gibt´s heute nicht!"Wahrscheinlich wird es sich beim Volkswissen nicht so sehr um die Ergebnisse scharfer Beobachtungen einer breiten Bauernschicht als vielmehr um das handeln, was früh- und vorgeschichtliche Sternwarten erarbeiteten, jene Sternwarten, wie wir sie in den Extern-Steinen, in den Stufenpyramiden, in den Steinkreisen und in den Resten sonstiger uralter Himmelswarten vor uns haben.
Die damaligen Sternbeobachter lösten keine wissenschaftlichen Aufgaben, sondern behüteten das Leben und erarbeiteten im ewigen Fluß des Geschehens die Richtlinien, die Regeln, welche das Leben im natürlichen Gleichgewicht hielten und es vor Schädigungen bewahrten. Solche Regeln sind also keine lebensfremd-exakten Gesetze, sondern beziehen sich, wie bei den Lostagen, auf die allgemeine Großwettergestaltung mehrerer Wochen oder Monate und damit auch auf das kosmisch bedingte Leben überhaupt. Immer aber alles aus der Welt des Erdverbundenen, des Bauern gesehen! Es ist darum, um diese Tatsache nochmals zu betonen, also keineswegs gesagt, etwa die nassen auf einen regnerischen Siebenbrüdertag folgenden Wochen müßten nun von pausenlosem Regen angefüllt sein. Eine solche Erwartung vermöchte nur ein völlig Naturentwöhnter auszusprechen; denn der Inhalt der Bauernregeln ist immer und ausnahmslos auf die Bedeutung des Wetters für den Landmann, also den natürlich Lebenden gerichtet. Schiebt sich also in eine Regenperiode eine Anzahl schöner Tage ein, so besagt das gar nichts gegen die Regel, da einzelne Sonnentage für die Maßnahmen des Landwirtes zur Erhaltung des Lebens bedeutungslos sind. Indessen versteht der Landbewohner sehr wohl sie zu nützen. Keineswegs wird er etwa von ihnen auf Grund eines sturen Glaubens an die "sieben" Regenwochen überrascht. Er hockt nämlich auch dann nicht abwartend in der Stube, sondern ist täglich draußen in Wald und Feld. Nichts entgeht seinem scharfen und geschulten Auge, so nebensächlich es auch dem Städter erscheinen mag.
Wir beobachten etwa in einer regenlosen Zeit. Wie wichtig oft ganz alltägliche Dinge zu werden vermögen, wenn wir im Buch der Natur zu lesen versuchen, das soll uns ein Beispiel zeigen. Wir beobachten bei zunehmendem Monde einen Hof. Nach alter Volksregel ist dann Regen zu erwarten. Unbedenklich wird der Naturfremde diese Voraussage stellen und, wenn er etwas mehr von dem Urweistum kennt, die Frist des Regenbeginns vielleicht auf den übernächsten Tag angeben. Der nächste Tag ist hell. Um so sicherer wird unser Wetterprophet für den kommenden Tag das vorhergesagte Naß erwarten. Beobachtet er feiner, dann stellt er bei Mensch und Tier auch die Nervenerregungen fest, die ihn in seinem Schlusse noch weiter bestärken. Und wirklich ist es am anderen Morgen trüb. Beim Frühspaziergang begegnet er einem Bauern. Und wenn er nicht ein eingefleischter Städter ist, dann grüßt er den Landmann, bleibt einen Augenblick stehen, schaut bedenklich nach dem Himmel und bringt seine Weisheit an.
Und wirklich, es klärt sich wieder auf.
Damit aber ist für den
Naturfernen der Wert der Bauernregeln
entschieden: Sie sind völlig unzuverlässig! Nur hat er
leider übersehen, daß der Landbewohner sich keineswegs auf
gestrige oder vorgestrige Beobachtungen allein
verläßt. Auch er hat zwar den Mondhof beobachtet und
damit die Möglichkeit kommenden Regen vielleicht freudig
begrüßt. Er hat auch die Unruhe bei Mensch und Tier
wahrgenommen. Aber eine entscheidende Voraussage erlaubte er sich
noch nicht, flogen doch am gestrigen Abend die gutes Wetter
kündenden Mistkäfer und weiß er doch, daß ihm die
Natur selbst, Pflanze und Tier noch hinreichend zeitig Aufschluß
geben werden. Gewiß beobachtete auch er den bewölkten
Morgenhimmel. Aber beim frühen Gang durch den Hof und aufs
Feld hat er gesehen, daß die Ringelblume sich zwischen 6 und 7
Uhr morgens bereits entfaltete, was sie nur dann tut, wenn gutes Wetter
zu erwarten steht. Und er beobachtete auch, wie am Morgen schon
die Spinnen fleißig webten:
Wenn de Spinnen flietig weben,
Schall 't noch keen Regen geben.
Schall 't noch keen Regen geben.
Der Gang über Feld
überzeugte ihn weiterhin vom Fehlen der
schwarzen Schnecken und der Regenwürmer, der Regen kündenden
Würmer, die gewiß vorhanden gewesen wären, sofern
Nässe gedroht hätte:
Krupt veel Dauwürms un
swarte Sniggen an Pö (Pfützen) un Wegen,
So kriegt wie boll 'n anholl´n Regen.
Der Bauer behält also Recht und die Natur auch. Es ist eben
nur nötig, mit ihr zusammenzuleben, um alles Lebensnötige von
ihr zu erfahren.So kriegt wie boll 'n anholl´n Regen.
Wieder stoßen wir auf die
Tatsache, die immer eindringlicher
zeigt, daß Wissenschaft für wirkliches naturverbundenes
Kulturleben nur eine dienende Rolle spielt, während sie für
den zivilisierten, in einer künstlichen Umwelt lebenden
Städter für dessen krankmachende Bedürfnisse ein
unentbehrliches Bedürfnis ist.
Obwohl wir die Übereinstimmung zwischen wissenschaftlichen Ergebnissen und dem Urwissen des Volkes über die Welteislehre glaubhaft zu machen versuchten, haben wir damit im Lebenssinne nichts gewonnen; denn das schlichte Urwissen genügt vollauf für den natürlichen Menschen und es ist auf gesündere Weise zu erwerben als aus Pandekten, Lehrbüchern und Studierstuben. Wir wundern uns deswegen gar nicht so sehr darüber, daß der Landmann der Wetterkarte sehr wenig, dem Barometer schon mehr, seinen Bauernregeln und damit der Natur voll vertraut. Und er tut gut daran!
Obwohl wir die Übereinstimmung zwischen wissenschaftlichen Ergebnissen und dem Urwissen des Volkes über die Welteislehre glaubhaft zu machen versuchten, haben wir damit im Lebenssinne nichts gewonnen; denn das schlichte Urwissen genügt vollauf für den natürlichen Menschen und es ist auf gesündere Weise zu erwerben als aus Pandekten, Lehrbüchern und Studierstuben. Wir wundern uns deswegen gar nicht so sehr darüber, daß der Landmann der Wetterkarte sehr wenig, dem Barometer schon mehr, seinen Bauernregeln und damit der Natur voll vertraut. Und er tut gut daran!
Daß er richtig handelt,
wenn er sich auf seine Beobachtungen
verläßt, wird uns um so klarer, je tiefer wir in die
täglichen Voraussagemöglichkeiten eindringen. Der
Mondhof gehört hierher. Sind also die höheren
Gasschichten der Erde mit Feineis geschwängert, so sehen wir diese
Anreicherung bei zunehmendem Monde eben als Hof. Es ist aber
damit keineswegs gesagt, diese Feineismenge reiche hin, um einen Regen
zu veranlassen. Bei entsprechender Wärme und Lufttrockenheit
kann sie sehr wohl von den Gasmassen aufgenommen werden, ohne das
Niederschlagsbildung eintritt. Ob dieser Fall oder aber Landregen
erscheint, läßt sich durch die natürlichen Anzeichen
vorher entscheiden. Regenwürmer, Schnecken, Spinnen, Blumen
geben hinreichenden Anhalt. Vor allem ist das Volk der Spinnen
als Wetterkünder geschätzt. Denken wir nur an die
weitverbreitete Regel:
Spinne am Morgen
Bringt Kummer und Sorgen.
Bringt Kummer und Sorgen.
Gewiß dürfen wir
nicht unberücksichtigt lassen,
daß dieses Wort auch eine ganz andere Bedeutung besitzt, wenn es
heißt: "Spinnen" am Morgen, wobei das Spinnen am Spinnrocken
gemeint ist; aber der erst erwähnte Spruch hat auch seine volle
Berechtigung. Denn die Behauptung bezieht sich nicht etwa auf das
Entdecken einer Spinne draußen im Netz, sondern auf die Spinne,
welche früh im Hause sichtbar wird. Das Tier hat also sein
Netz verlassen und sucht einen geschützten Schlupfwinkel auf.
Und damit erkennen wir bei einigem Nachdenken schon die Zusammenhänge mit dem verschütteten Salz, das seinerseits mit der regenkündenden nervösen Erregung und der Wettervorfühligkeit verknüpft ist. Die Spinne folgt also ebenfalls auch nur ihrer Wettervorfühligkeit, die sie dazu treibt, geschützte Stellen aufzusuchen. Aus der nervösen Erregung ergeben sich dann "Kummer und Sorgen" genau wie beim Salz.
Auch diese Beobachtung ist also lebensnah! Ein anderes Wort sagt von den Spinnen:
Und damit erkennen wir bei einigem Nachdenken schon die Zusammenhänge mit dem verschütteten Salz, das seinerseits mit der regenkündenden nervösen Erregung und der Wettervorfühligkeit verknüpft ist. Die Spinne folgt also ebenfalls auch nur ihrer Wettervorfühligkeit, die sie dazu treibt, geschützte Stellen aufzusuchen. Aus der nervösen Erregung ergeben sich dann "Kummer und Sorgen" genau wie beim Salz.
Auch diese Beobachtung ist also lebensnah! Ein anderes Wort sagt von den Spinnen:
Hollt de Spinnen ganz op tu
weben,
Hebbt wie meest Wind noch to
kregen.
Auch hier dürfte die
Wettervorfühligkeit eine Rolle
spielen.
Derartige Möglichkeiten einer kurzfristigen Wettervorhersage gibt es zahlreiche. Da es nicht unsere Absicht ist, hier die Wetterregeln vollzählig wiederzugeben, sondern nur ihren Wert erahnbar zu machen, wollen und müssen wir uns mit einer nicht zu umfangreichen, weil sonst ermüdenden, Auswahl begnügen.
Derartige Möglichkeiten einer kurzfristigen Wettervorhersage gibt es zahlreiche. Da es nicht unsere Absicht ist, hier die Wetterregeln vollzählig wiederzugeben, sondern nur ihren Wert erahnbar zu machen, wollen und müssen wir uns mit einer nicht zu umfangreichen, weil sonst ermüdenden, Auswahl begnügen.
Wer aus der Natur schöpfen
will, muß mit der Natur nach
ihrem Rhythmus leben. Er darf nicht bis in den Vormittag hinein
schlafen, sondern mit der Sonne sich erheben; denn schon der Aufgang
des Taggestirns kann entscheidend sein. Zeigt sich nämlich
Morgenrot, so ist auf Regen und Wind zu schließen. Das
Morgenrot ist überhaupt ein Vorbote unangenehmer Ereignisse.
Auch das Dichterwort: "Morgenrot
leuchtet mir zu frühem Tod" ist beileibe keine nur
poetische Wendung. Auch hier treten wieder die kosmischen
Wirkungen der Erregung inkraft.
Wir wissen heute, daß Massenhandlungen wie sie etwa die Kriege und Revolutionen darstellen, genau dem kosmischen Rhythmus unterworfen sind und immer in jene Spannen fallen, während denen sich die Sonnenwirkungen infolge gehäufter Befleckung und der damit verknüpften gesteigerten Feineisanblasungen besonders stark fühlbar machen. Diese Einflüsse lassen sich bis in Einzelheiten dieser Großhandlungen verfolgen. So fallen innerhalb der Kriege die einzelnen Schlachten und Scharmützel meist wieder auf die Tage besonderer Sonnentätigkeit, genau so wie der Schwatz der Frauen, das Geschnatter der Enten, das Salzverschütten, das Bestreben der Spinnen, Schutz zu suchen, oder das übermäßige Gegacker der Hühner. Und Morgenrot erscheint nur an Tagen, die auch anderweitige Regenanzeichen aufweisen, wobei das früher Gesagte nicht außer Acht gelassen werden darf, daß Regenanzeichen noch lange nicht mit dem sicheren Eintreten von Schlechtwetter gleichzusetzen sind. Wenn indessen der Dichter Morgenrot und Schlachtentod zusammenbringt, so tut er dies nicht etwa des bequemen Reimes wegen, sondern er wiederholt eine Volksweisheit, deren Tatsächlichkeit erwiesen ist.
Wir wissen heute, daß Massenhandlungen wie sie etwa die Kriege und Revolutionen darstellen, genau dem kosmischen Rhythmus unterworfen sind und immer in jene Spannen fallen, während denen sich die Sonnenwirkungen infolge gehäufter Befleckung und der damit verknüpften gesteigerten Feineisanblasungen besonders stark fühlbar machen. Diese Einflüsse lassen sich bis in Einzelheiten dieser Großhandlungen verfolgen. So fallen innerhalb der Kriege die einzelnen Schlachten und Scharmützel meist wieder auf die Tage besonderer Sonnentätigkeit, genau so wie der Schwatz der Frauen, das Geschnatter der Enten, das Salzverschütten, das Bestreben der Spinnen, Schutz zu suchen, oder das übermäßige Gegacker der Hühner. Und Morgenrot erscheint nur an Tagen, die auch anderweitige Regenanzeichen aufweisen, wobei das früher Gesagte nicht außer Acht gelassen werden darf, daß Regenanzeichen noch lange nicht mit dem sicheren Eintreten von Schlechtwetter gleichzusetzen sind. Wenn indessen der Dichter Morgenrot und Schlachtentod zusammenbringt, so tut er dies nicht etwa des bequemen Reimes wegen, sondern er wiederholt eine Volksweisheit, deren Tatsächlichkeit erwiesen ist.
Schlechtwetterkünder
besitzt der Landbewohner in großer
Zahl. Regen tritt ein, wenn der Wald dampft, wenn der Herdrauch
nicht aus der Esse in die Höhe steigt oder wenn die Steine des
Flurs oder der Straße dunkle Feuchtigkeitsflecke aufweisen, wenn
die Steine "schwitzen".
Beginnt es aber morgens zu regnen, so weiß der Kenner: Morgenregen und Morgenbesuch bleiben nicht lange.
Auch der Wind, der früh zu wehen beginnt, steht mit den Hühnern auf und geht mit ihnen zu Bette.
Baldiger Landregen kündigt sich, wie wir erwarten dürfen, durch allerhand Sonderbarkeiten an:
Kriechen die Bienen auf ihrem Korbe herum ohne auszufliegen; baden sich die Tauben; trägt das Schwein Strohhalme im Maul; fliegen die Schwalben tief; beißen die Fische hurtig an; zeigen die Singvögel Unruhe und huschen sie von Ast zu Ast, so sind das alles wieder unverkennbare Zeichen der Erregung oder Zeichen des natürlichen Selbsterhaltungstriebes und als solche nun in ihrem Werte für die Wettervoraussage klar erkennbar.
Zieht sich der Fischreiher zeitig zu Nest oder fressen die Schafe besonders gierig; kratzen die Katzen an Bäumen und Brettern, so erblicken wir auch hier Vorgänge der gleichen Richtung! Der Fischreiher zieht zum Schutze der Jungen horstwärts; das Schaf frißt gewissermaßen auf Vorrat, da es bei Regen nicht auf die Weide geht.
Ebenso ist Schlechtwetter im Anzuge, wenn die Ameisen ihre Puppen (Eier) in den Bau tragen; gutes Wetter, wenn sie sie herausbringen.
Ist aber Regen eingetreten und bilden sich große Blasen auf den Pfützen, dann regnet es drei Tage lang.
Beginnt es aber morgens zu regnen, so weiß der Kenner: Morgenregen und Morgenbesuch bleiben nicht lange.
Auch der Wind, der früh zu wehen beginnt, steht mit den Hühnern auf und geht mit ihnen zu Bette.
Baldiger Landregen kündigt sich, wie wir erwarten dürfen, durch allerhand Sonderbarkeiten an:
Kriechen die Bienen auf ihrem Korbe herum ohne auszufliegen; baden sich die Tauben; trägt das Schwein Strohhalme im Maul; fliegen die Schwalben tief; beißen die Fische hurtig an; zeigen die Singvögel Unruhe und huschen sie von Ast zu Ast, so sind das alles wieder unverkennbare Zeichen der Erregung oder Zeichen des natürlichen Selbsterhaltungstriebes und als solche nun in ihrem Werte für die Wettervoraussage klar erkennbar.
Zieht sich der Fischreiher zeitig zu Nest oder fressen die Schafe besonders gierig; kratzen die Katzen an Bäumen und Brettern, so erblicken wir auch hier Vorgänge der gleichen Richtung! Der Fischreiher zieht zum Schutze der Jungen horstwärts; das Schaf frißt gewissermaßen auf Vorrat, da es bei Regen nicht auf die Weide geht.
Ebenso ist Schlechtwetter im Anzuge, wenn die Ameisen ihre Puppen (Eier) in den Bau tragen; gutes Wetter, wenn sie sie herausbringen.
Ist aber Regen eingetreten und bilden sich große Blasen auf den Pfützen, dann regnet es drei Tage lang.
Das Ende des Regens wird durch
vielerlei Zeichen angezeigt, von denen
wir schon die am Abend fliegenden Mitkäfer und die Ringelblume
erwähnten. Aber auch andere, kaum noch beachtete oder als
kindliche Redensarten bewertete Regeln sind ganz zuverlässig,
sofern sie im Rahmen aller sonstigen Erscheinungen sinngemäß
berücksichtigt werden.
Uns allen hat einst die Mutter schönes Wetter versprochen, wenn wir unsere Teller leeressen würden. Gewiß ist das nur ein für Kinder verwendbares Versprechen, aber es fließt auch aus einer alten Volksweisheit; denn während es zwar noch heftig zu regnen vermag, kann die kosmische Anwirkung selbst bereits aufgehört haben, sodaß die Stimmung und das Lebensgefühl des Einzelnen wieder steigen und damit auch der Appetit. Darum ist das Wort keineswegs unsinnig, das da behauptet, es gäbe gutes Wetter, wenn alle Teller leer aufgegessen würden. Jeder hat Gelegenheit, diese Tatsache zu beobachten. -
Nicht unwichtig ist auch die Runkelrübe als Gewitterkünder. Sie läßt "rechtzeitig" ihre Blätter hängen, eine Erscheinung, die keineswegs vereinzelt dasteht, sondern mit dem regenkündenden, blätterschließenden Klee, dem Schließen der Blüte des Löwenzahns, dem Ticken der Totenuhr, der nervösen Erregung, die gleiche Ursache teilt, nämlich die infolge erhöhter kosmischer Anwirkung gesteigerte Bodenstrahlung. Nur scheint die Runkelrübe erst bei starken Einflüssen ihr Aussehen zu verändern, wenn also Gewitter oder schwere Unwetter im Anzuge sind, dann läßt sie ihre Blätter hängen. Sie werden schlaff, um vom Sturm nicht geknickt zu werden.
Selbst für die Dauer bis zum Eintritt eines Regens oder Unwetters gibt es verläßliche Anzeichen. Kehren die Bienen "wie ein Frühjahreshagel" vom Felde heim, so ist das Wetter in unmittelbarem Anzuge. Sind dagegen Regen oder Gewitter mit Sicherheit zu erwarten, ist der Himmel bedeckt und fliegen die Immen dennoch aus, so kann man "ruhig noch eine Fuhre Korn hereinholen".
Uns allen hat einst die Mutter schönes Wetter versprochen, wenn wir unsere Teller leeressen würden. Gewiß ist das nur ein für Kinder verwendbares Versprechen, aber es fließt auch aus einer alten Volksweisheit; denn während es zwar noch heftig zu regnen vermag, kann die kosmische Anwirkung selbst bereits aufgehört haben, sodaß die Stimmung und das Lebensgefühl des Einzelnen wieder steigen und damit auch der Appetit. Darum ist das Wort keineswegs unsinnig, das da behauptet, es gäbe gutes Wetter, wenn alle Teller leer aufgegessen würden. Jeder hat Gelegenheit, diese Tatsache zu beobachten. -
Nicht unwichtig ist auch die Runkelrübe als Gewitterkünder. Sie läßt "rechtzeitig" ihre Blätter hängen, eine Erscheinung, die keineswegs vereinzelt dasteht, sondern mit dem regenkündenden, blätterschließenden Klee, dem Schließen der Blüte des Löwenzahns, dem Ticken der Totenuhr, der nervösen Erregung, die gleiche Ursache teilt, nämlich die infolge erhöhter kosmischer Anwirkung gesteigerte Bodenstrahlung. Nur scheint die Runkelrübe erst bei starken Einflüssen ihr Aussehen zu verändern, wenn also Gewitter oder schwere Unwetter im Anzuge sind, dann läßt sie ihre Blätter hängen. Sie werden schlaff, um vom Sturm nicht geknickt zu werden.
Selbst für die Dauer bis zum Eintritt eines Regens oder Unwetters gibt es verläßliche Anzeichen. Kehren die Bienen "wie ein Frühjahreshagel" vom Felde heim, so ist das Wetter in unmittelbarem Anzuge. Sind dagegen Regen oder Gewitter mit Sicherheit zu erwarten, ist der Himmel bedeckt und fliegen die Immen dennoch aus, so kann man "ruhig noch eine Fuhre Korn hereinholen".
Alle diese Regeln bedürfen
für uns keiner besonderen Erklärung mehr. Sie sind uns
selbstverständlich; denn sie zeigen uns doch nur, wie innig das
Leben der Tiere und Blumen und Pflanzen in den Gang der Natur
eingesenkt ist, wie ein Vorgang in den anderen eingreift, wie sich
alles zum Ganzen webt. Und sollte da nicht auch der Mensch wieder
jene Harmonie finden, welche ihn der natürlichen Gnade teilhaftig
werden und sein Leben sinngemäß verlaufen
läßt? Diese Frage
ist die tiefste und folgeschwerste, die ein Volk sich stellen kann.
Aus der Einsicht in die Ganzheit der Natur, dieses Allzusammenwirkens, werden auch alle jene Bauernregeln verständlich, welche die Großwetterlage auf lange Zeit vorausverkünden, ohne an die schon behandelten Lostage gebunden zu sein.
Hierher gehören die Vorzeichen eines kalten Winters.
Tragen Brombeeren, Vogelbeeren und Eichen reichlich, so steht ein strenger Winter bevor. Verpichen die Bienen im Herbst die Fluglöcher ihrer Körbe teilweise, so deutet das in gleicher Richtung. Ebenso künden im Oktober zahlreich auftretende Hornissen einen harten Winter.
Der ungeübte Beobachter wird aber dann, wenn er diese Vorzeichen bemerkt, auch in der Lage sein, andere, gegenteilige Erscheinungen anzuführen, die im Urwissen als Vorboten milden Wetters gelten. Er wird sich kaum fähig fühlen, sich aus diesen Widersprüchen herauszufinden und deswegen die Bauernregeln als unbrauchbar bei Seite lassen; denn er sieht die südwärts ziehenden Kraniche ziemlich tiefe Luftschichten wählen, eine Maßnahme, welche diese Vögel nur dann ergreifen, wenn ein milder Winter bevorsteht. Auch das Laichen der Forellen gegen Ende November zeigt an, daß kein starker Frost in Aussicht steht; denn der jungen Brut muß noch genügend Zeit zur Entwicklung bleiben.
Wie schon angedeutet, können sowohl die Vorzeichen für einen harten als auch für einen milden Winter gleichzeitig auftreten. Damit scheint nun der Wert der Bauernregeln besiegelt. Die Naturwissenschaft wird es also ablehnen, sich mit derart unzuverlässigen Dingen zu befassen. Das Naturwissen aber ist und muß anderer Meinung sein.
Versuchen wir doch einmal natürlich zu denken!
Für die Kraniche hat das Wetter allein während ihrer Zugzeit Bedeutung, ebenso für die Forellen nur die Spanne der ersten Kindheit ihrer Brut. Beiden kann es gleichgiltig sein, ob der Februar kalt ist oder nicht. Anders liegen die Dinge für die Samen, welche Baum und Strauch hervorbringen. In einem harten oder langen Winter werden Eicheln, Brombeeren und andere Waldfrüchte nicht nur durch hohe Kältegrade, sondern vorwiegend durch nahrungsuchende Tiere gefährdet sein. Hier liegt es also im Sinne der Arterhaltung, die Samenmenge zu steigern. Auch die Immen müssen für die gesamte kalte Zeit vorsorgen, wollen sie nicht der Gefahr des Erfrierens ausgesetzt sein.
Diese Feststellungen ermöglichen uns nun einen völlig neuen Einblick in das Weben der Natur. Gemeinhin sprechen wir zwar nur von dem kommenden Winter, während das Volk sehr deutlich zwischen Vor- und Nachwinter zu unterscheiden pflegt.
Ein harter Vorwinter würde also Kranichen und Forellen gefährlich werden können, vielleicht auch Hasen, Immen und Hornissen. Ein besonders kalter Nachwinter im Februar wäre aber für Forellen und Kraniche ohne Bedeutung.
Wenn also diese beiden Tierarten mildes Wetter vorausverkünden, so ist damit nur der Vorwinter im November und dem größten Teil des Dezember gemeint und alle anderen Hinweise auf eine kalte Zeit sind auf den Nachwinter zu beziehen.
Laichen dagegen die Forellen besonders zeitig oder fliegen die Kraniche hoch, so steht auch eine harte Vorwinterperiode in Aussicht.
Aus der Einsicht in die Ganzheit der Natur, dieses Allzusammenwirkens, werden auch alle jene Bauernregeln verständlich, welche die Großwetterlage auf lange Zeit vorausverkünden, ohne an die schon behandelten Lostage gebunden zu sein.
Hierher gehören die Vorzeichen eines kalten Winters.
Tragen Brombeeren, Vogelbeeren und Eichen reichlich, so steht ein strenger Winter bevor. Verpichen die Bienen im Herbst die Fluglöcher ihrer Körbe teilweise, so deutet das in gleicher Richtung. Ebenso künden im Oktober zahlreich auftretende Hornissen einen harten Winter.
Der ungeübte Beobachter wird aber dann, wenn er diese Vorzeichen bemerkt, auch in der Lage sein, andere, gegenteilige Erscheinungen anzuführen, die im Urwissen als Vorboten milden Wetters gelten. Er wird sich kaum fähig fühlen, sich aus diesen Widersprüchen herauszufinden und deswegen die Bauernregeln als unbrauchbar bei Seite lassen; denn er sieht die südwärts ziehenden Kraniche ziemlich tiefe Luftschichten wählen, eine Maßnahme, welche diese Vögel nur dann ergreifen, wenn ein milder Winter bevorsteht. Auch das Laichen der Forellen gegen Ende November zeigt an, daß kein starker Frost in Aussicht steht; denn der jungen Brut muß noch genügend Zeit zur Entwicklung bleiben.
Wie schon angedeutet, können sowohl die Vorzeichen für einen harten als auch für einen milden Winter gleichzeitig auftreten. Damit scheint nun der Wert der Bauernregeln besiegelt. Die Naturwissenschaft wird es also ablehnen, sich mit derart unzuverlässigen Dingen zu befassen. Das Naturwissen aber ist und muß anderer Meinung sein.
Versuchen wir doch einmal natürlich zu denken!
Für die Kraniche hat das Wetter allein während ihrer Zugzeit Bedeutung, ebenso für die Forellen nur die Spanne der ersten Kindheit ihrer Brut. Beiden kann es gleichgiltig sein, ob der Februar kalt ist oder nicht. Anders liegen die Dinge für die Samen, welche Baum und Strauch hervorbringen. In einem harten oder langen Winter werden Eicheln, Brombeeren und andere Waldfrüchte nicht nur durch hohe Kältegrade, sondern vorwiegend durch nahrungsuchende Tiere gefährdet sein. Hier liegt es also im Sinne der Arterhaltung, die Samenmenge zu steigern. Auch die Immen müssen für die gesamte kalte Zeit vorsorgen, wollen sie nicht der Gefahr des Erfrierens ausgesetzt sein.
Diese Feststellungen ermöglichen uns nun einen völlig neuen Einblick in das Weben der Natur. Gemeinhin sprechen wir zwar nur von dem kommenden Winter, während das Volk sehr deutlich zwischen Vor- und Nachwinter zu unterscheiden pflegt.
Ein harter Vorwinter würde also Kranichen und Forellen gefährlich werden können, vielleicht auch Hasen, Immen und Hornissen. Ein besonders kalter Nachwinter im Februar wäre aber für Forellen und Kraniche ohne Bedeutung.
Wenn also diese beiden Tierarten mildes Wetter vorausverkünden, so ist damit nur der Vorwinter im November und dem größten Teil des Dezember gemeint und alle anderen Hinweise auf eine kalte Zeit sind auf den Nachwinter zu beziehen.
Laichen dagegen die Forellen besonders zeitig oder fliegen die Kraniche hoch, so steht auch eine harte Vorwinterperiode in Aussicht.
Mit den hier gemachten
Feststellungen ist natürlich noch nichts erklärt. Wir
wissen nicht, woher Eiche und Brombeeren, Hase, Forelle, Kraniche und
Bienen ihre "Kenntnisse" schöpfen. Wüßten wir es,
was wäre uns geholfen? Die Natur gibt uns ja so wie so alle
nötigen Hinweise. Wir müssen nur wieder lernen, sie
lesen zu können. Tun wir das aber, dann wird uns wenigstens
klar, welches die treibende Kraft der Tage oder gar Monate umfassenden
Wettervorfühligkeit ist.
Da erscheint in unserem Bauernwissen der Laubfrosch als Wetterkünder. Ein harmloser Geselle, der sehr zu Unrecht zu einer Witzblatt-Karikatur wurde, während er trotzdem und alledem ein ganz vorzüglicher Wetterkünder ist. Das zu erkennen, genügt es, einen Blick in das Leben dieses Wasser- und Baumbewohners zu werfen.
An schönen Tagen verläßt er seinen Tümpel, um einen Baum zu besteigen und dort auf einem Blatt einen sonnigen Platz einzunehmen, der von Insekten umschwärmt, ihm hinreichende Beute sichert. Mit Hilfe seines Körperschleimes und seiner an den Zehen sitzenden Haftorgane ist es ihm leicht, seinen luftigen Sitz zu behaupten. Würde er indessen von Regen oder Sturm hier überrascht werden, so läge die Gefahr eines Sturzes in die Tiefe nahe, die ihm wohl das Leben kosten dürfte.
Wo immer wir nun die reine Natur beobachten, finden wir eine erstaunliche Vorsorge der gütigen Mutter Natur. Überall schwebt ihre schützende Hand über bedrohtem Leben. Darum besitzen alle natürlich lebenden Wesen ein warnendes Vorgefühl für drohende Gefahren, ob wir nun Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Wetterstürze betrachten.
Mag die Sonne also noch so herrlich scheinen und das Wetter verführerisch schön sein, sind aber Sturm und Regen oder Gewitter im Anzuge, so wird der Laubfrosch infolge jenes Naturtriebes, den wir Instinkt und in diesem besonderen Falle Wettervorfühligkeit nennen, seinen Hochsitz verlassen und den schützenden Tümpel aufsuchen. Tritt dagegen trotz bewölkten Himmels Neigung zu Schönwetter ein, so wird er von neuem das nun wieder trockene und ihm Halt bietende Blatt beziehen.
Mutter Natur schirmt also das Leben vor Gefahr und warnt es mit Hilfe der Wettervorfühligkeit, die mithin ein Naturtrieb ist oder, wie die Wissenschaft sagt, ein Instinkt. Aber dieses Wort ist eben nur eine Bezeichnung und erklärt nichts; denn nach wie vor bleibt das Eigentliche des Vorganges in Dunkel gehüllt, auch dann, wenn wir sagen, es seien die kosmisch-elektrisierten Kräfte, welche bewegende Ursache seien.
Wie kommt es aber dann, daß der Laubfrosch diese Erregung zur Veranlassung nimmt, in den schützenden Tümpel zurückzukehren, statt etwa noch höher auf den Baum zu klimmen? Oder wie kommt es, daß die Schafe am Abend vor dem kommenden Regen besonders scharf fressen, anstatt wie die Enten durch vermehrte Laute ihre Erregung kund zu tun? Es ist dies umso unverständlicher, als das Schaf zu den allerältesten Haustieren gehört und inzwischen, wenn diese Annahme hier Geltung haben sollte, "gelernt" haben könnte, daß es auch bei Regenwetter verpflegt wird. Die Ente dagegen, eines der jüngsten menschlichen Haustiere, schnattert nur und wartet ruhig auf das Futter.
Oder wie wollten wir gar das Dichterwerden des Hasenpelzes je nach der Strenge des bevorstehenden Winters "erklären"? Oder, um hier noch des Kiebitz zu gedenken, wie erfährt er es, daß Überschwemmungen bevorstehen, sodaß er seine Nester in diesem Falle nicht in den Wiesengründen, sondern auf Höhen anlegt?
Da erscheint in unserem Bauernwissen der Laubfrosch als Wetterkünder. Ein harmloser Geselle, der sehr zu Unrecht zu einer Witzblatt-Karikatur wurde, während er trotzdem und alledem ein ganz vorzüglicher Wetterkünder ist. Das zu erkennen, genügt es, einen Blick in das Leben dieses Wasser- und Baumbewohners zu werfen.
An schönen Tagen verläßt er seinen Tümpel, um einen Baum zu besteigen und dort auf einem Blatt einen sonnigen Platz einzunehmen, der von Insekten umschwärmt, ihm hinreichende Beute sichert. Mit Hilfe seines Körperschleimes und seiner an den Zehen sitzenden Haftorgane ist es ihm leicht, seinen luftigen Sitz zu behaupten. Würde er indessen von Regen oder Sturm hier überrascht werden, so läge die Gefahr eines Sturzes in die Tiefe nahe, die ihm wohl das Leben kosten dürfte.
Wo immer wir nun die reine Natur beobachten, finden wir eine erstaunliche Vorsorge der gütigen Mutter Natur. Überall schwebt ihre schützende Hand über bedrohtem Leben. Darum besitzen alle natürlich lebenden Wesen ein warnendes Vorgefühl für drohende Gefahren, ob wir nun Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Wetterstürze betrachten.
Mag die Sonne also noch so herrlich scheinen und das Wetter verführerisch schön sein, sind aber Sturm und Regen oder Gewitter im Anzuge, so wird der Laubfrosch infolge jenes Naturtriebes, den wir Instinkt und in diesem besonderen Falle Wettervorfühligkeit nennen, seinen Hochsitz verlassen und den schützenden Tümpel aufsuchen. Tritt dagegen trotz bewölkten Himmels Neigung zu Schönwetter ein, so wird er von neuem das nun wieder trockene und ihm Halt bietende Blatt beziehen.
Mutter Natur schirmt also das Leben vor Gefahr und warnt es mit Hilfe der Wettervorfühligkeit, die mithin ein Naturtrieb ist oder, wie die Wissenschaft sagt, ein Instinkt. Aber dieses Wort ist eben nur eine Bezeichnung und erklärt nichts; denn nach wie vor bleibt das Eigentliche des Vorganges in Dunkel gehüllt, auch dann, wenn wir sagen, es seien die kosmisch-elektrisierten Kräfte, welche bewegende Ursache seien.
Wie kommt es aber dann, daß der Laubfrosch diese Erregung zur Veranlassung nimmt, in den schützenden Tümpel zurückzukehren, statt etwa noch höher auf den Baum zu klimmen? Oder wie kommt es, daß die Schafe am Abend vor dem kommenden Regen besonders scharf fressen, anstatt wie die Enten durch vermehrte Laute ihre Erregung kund zu tun? Es ist dies umso unverständlicher, als das Schaf zu den allerältesten Haustieren gehört und inzwischen, wenn diese Annahme hier Geltung haben sollte, "gelernt" haben könnte, daß es auch bei Regenwetter verpflegt wird. Die Ente dagegen, eines der jüngsten menschlichen Haustiere, schnattert nur und wartet ruhig auf das Futter.
Oder wie wollten wir gar das Dichterwerden des Hasenpelzes je nach der Strenge des bevorstehenden Winters "erklären"? Oder, um hier noch des Kiebitz zu gedenken, wie erfährt er es, daß Überschwemmungen bevorstehen, sodaß er seine Nester in diesem Falle nicht in den Wiesengründen, sondern auf Höhen anlegt?
Was nützt es, hier weiter
zu bohren? Überall ist es die sorgende göttliche Natur
selber, die für ihre Kinder handelt und sie so versieht, daß
ihnen der geringstmögliche Schaden zugefügt wird. Ein
vollkommener Schutz wäre ja ein Verstoß gegen die Harmonie,
da in ihr alles nur angenähert sein kann.
Bewundernd blicken wir hier in das sinnvolle Getriebe des Lebens, des kosmischen Lebens, dessen geheimnisreicher Ablauf uns zwingt, in Ehrfurcht das Knie vor der Größe der Schöpfung zu beugen. Bewundernd erkennen wir nun, wie sich der schollenverwurzelte Mensch alle diese natürlichen Fingerzeige dienen gelassen hat, und wie zart er sie in seinem Weistum erhielt; doch war er weise genug, auf die Frage zu verzichten, wie etwas geschieht, sondern er begnügte sich mit der Feststellung, ob und wann und daß etwas geschieht!
Aus solcher Stellung zur Natur muß um so größerer Nutzen für den Menschen erwachsen, je inniger und aufmerksamer er Natur beobachtet; je hingegebener und reiner er mit ihr lebt.
Bewundernd blicken wir hier in das sinnvolle Getriebe des Lebens, des kosmischen Lebens, dessen geheimnisreicher Ablauf uns zwingt, in Ehrfurcht das Knie vor der Größe der Schöpfung zu beugen. Bewundernd erkennen wir nun, wie sich der schollenverwurzelte Mensch alle diese natürlichen Fingerzeige dienen gelassen hat, und wie zart er sie in seinem Weistum erhielt; doch war er weise genug, auf die Frage zu verzichten, wie etwas geschieht, sondern er begnügte sich mit der Feststellung, ob und wann und daß etwas geschieht!
Aus solcher Stellung zur Natur muß um so größerer Nutzen für den Menschen erwachsen, je inniger und aufmerksamer er Natur beobachtet; je hingegebener und reiner er mit ihr lebt.
Nur kurz soll noch auf die
Anwendung des Urwissens für die Saat und Erntearbeiten eingegangen
werden. Mancher Gartenfreund würde vor Enttäuschungen
bewahrt bleiben, wenn er sich die alten Erfahrungen dienen ließe.
Wer achtet wohl darauf, wann er sät? Wenn der Boden "offen" ist, sagen die Gartenbücher. Und so kommt es, daß sich die Hausfrau, die mit eigener Hand und großer Liebe ihr Küchengärtlein bestellt, bei selbstgezogenen Bohnen Enttäuschungen erlebt: Sie bleiben beim Kochen hart. Nach Meinung der sorglichen Gärtnerin liegt das an der Sorte! Der Landmann aber weiß, daß es an der Saatzeit liegt; denn wenn Bohnen dann in die Erde gelegt werden, wenn das Zeichen des Krebses am Himmel steht, so kochen sie nicht weich. Das gilt auch für Erbsen. Legt man sie im Zeichen des Steinbockes, so gedeihen sie überhaupt schlecht - trotz aller Pflege. Bringt man sie aber am zweiten Tage vor Neumond in die Erde, so blühen sie nicht zu lange und setzen rechtzeitig an. Diese Vorschrift widerspricht einer allgemeinen Regel. Bei zunehmendem Monde sollen sonst alle jene Gewächse gesät werden, die sich über der Erde entwickeln, also Salat, Kohl, Gurken, während alle unter der Erde sich entfaltenden, also Karotten, Möhren, Zwiebeln, Rüben zur Zeit des abnehmenden Mondes gesät werden müssen.
Auch für die Ernte gibt es gar manche Regel. Wir wollen uns hier damit begnügen, die Vorschrift zu erwähnen, daß die Heuernte bei zunehmendem Monde stattzufinden hat. Um diese Zeit ist die Pflanze an wertvollen Säften reicher und wächst leicht und schnell nach. Aus diesem Grunde werden auch Bäume und Sträucher nicht bei zunehmendem, sondern bei abnehmendem Monde verpflanzt, da sie so Zeit haben, neue Saugwurzeln zu bilden.
Wer achtet wohl darauf, wann er sät? Wenn der Boden "offen" ist, sagen die Gartenbücher. Und so kommt es, daß sich die Hausfrau, die mit eigener Hand und großer Liebe ihr Küchengärtlein bestellt, bei selbstgezogenen Bohnen Enttäuschungen erlebt: Sie bleiben beim Kochen hart. Nach Meinung der sorglichen Gärtnerin liegt das an der Sorte! Der Landmann aber weiß, daß es an der Saatzeit liegt; denn wenn Bohnen dann in die Erde gelegt werden, wenn das Zeichen des Krebses am Himmel steht, so kochen sie nicht weich. Das gilt auch für Erbsen. Legt man sie im Zeichen des Steinbockes, so gedeihen sie überhaupt schlecht - trotz aller Pflege. Bringt man sie aber am zweiten Tage vor Neumond in die Erde, so blühen sie nicht zu lange und setzen rechtzeitig an. Diese Vorschrift widerspricht einer allgemeinen Regel. Bei zunehmendem Monde sollen sonst alle jene Gewächse gesät werden, die sich über der Erde entwickeln, also Salat, Kohl, Gurken, während alle unter der Erde sich entfaltenden, also Karotten, Möhren, Zwiebeln, Rüben zur Zeit des abnehmenden Mondes gesät werden müssen.
Auch für die Ernte gibt es gar manche Regel. Wir wollen uns hier damit begnügen, die Vorschrift zu erwähnen, daß die Heuernte bei zunehmendem Monde stattzufinden hat. Um diese Zeit ist die Pflanze an wertvollen Säften reicher und wächst leicht und schnell nach. Aus diesem Grunde werden auch Bäume und Sträucher nicht bei zunehmendem, sondern bei abnehmendem Monde verpflanzt, da sie so Zeit haben, neue Saugwurzeln zu bilden.
An all diesen Bräuchen
spüren wir Mutter Natur als Lehrmeisterin. Und aus allen
Einzelheiten des Urwissens spricht die ungeheure feine Beobachtungsgabe
des unverbildeten Menschen. Wie überraschend scharf der
Landmann sah und teilweise heute noch sieht, das mag uns eine
überaus merkwürdige Beobachtung lehren, die sich auf die
Hühnerzucht bezieht.
An sich ist es das Bestreben des Bauern, recht zeitig Kükennachwuchs zu erhalten; denn die jungen Hühner beginnen, sind sie bereits im März dem Ei entschlüpft, gerade dann zu legen, wenn im Spätsommer die Alten in die Mauser gehen und das Legen einstellen. Trotzdem behauptet der Bauer, man dürfe niemals am 14. Februar eine Henne setzen, da die Jungen dann blind oder lahm bleiben oder bald stürben.
Da sich diese Regel bis auf den heutigen Tag erhalten hat, so muß ihr irgendwelche Tatsächlichkeit anhaften. Hier kann nur daran erinnert werden, daß gerade um diese Zeit einer der wichtigsten jährlichen kosmisch bedingten Erregungshöhepunkte liegt, der sich unter anderem auch in der Zahl der Verbrechen deutlich ausprägt, überdies die kälteste Zeit des Nachwinters zu sein pflegt; hier wachsen auch die schädigenden Erdstrahlungen zu besonderer Kraft an. Es handelt sich also um eine für das zarte, junge Leben sehr ungünstige Zeit. -
An sich ist es das Bestreben des Bauern, recht zeitig Kükennachwuchs zu erhalten; denn die jungen Hühner beginnen, sind sie bereits im März dem Ei entschlüpft, gerade dann zu legen, wenn im Spätsommer die Alten in die Mauser gehen und das Legen einstellen. Trotzdem behauptet der Bauer, man dürfe niemals am 14. Februar eine Henne setzen, da die Jungen dann blind oder lahm bleiben oder bald stürben.
Da sich diese Regel bis auf den heutigen Tag erhalten hat, so muß ihr irgendwelche Tatsächlichkeit anhaften. Hier kann nur daran erinnert werden, daß gerade um diese Zeit einer der wichtigsten jährlichen kosmisch bedingten Erregungshöhepunkte liegt, der sich unter anderem auch in der Zahl der Verbrechen deutlich ausprägt, überdies die kälteste Zeit des Nachwinters zu sein pflegt; hier wachsen auch die schädigenden Erdstrahlungen zu besonderer Kraft an. Es handelt sich also um eine für das zarte, junge Leben sehr ungünstige Zeit. -
Lassen wir nochmals den
allgemeinen Eindruck der wenigen hier dargelegten Bauernregeln am
geistigen Auge vorüberziehen, so bemächtigt sich uns
aufrichtige Bewunderung für die Leistungen des schlichten
Volkes. Bescheiden und voller Ehrfurcht stehen wir vor der
Größe und den gnadenreichen Schätzen Mutter Naturs;
überwältigt von der lückenlosen Einheit alles Seins; und
voller Hoffnung, den Weg zu finden, der aus den Tiefen einer
schollenfremden Zivilisation ins Kulturreich des wahren Menschentums
führt. Klein und fast unscheinbar wird das Ersonnene; in
strahlender Reinheit und Pracht aber leuchtet unserem Pfade voran das
Urweistum des Volkes.
Hanns Fischer
(Quellenschriftauszug aus dem Buch "Der Weg ins Unbetretene" von Hanns Fischer, 1935, Verlag Dr. Hermann Eschenhagen/Breslau)
Hinweis:
Wer sich ausführlich mit dem Urwissen des Bauern (Volkes) beschäftigen möchte, dem empfehlen wir das Buch "Aberglaube oder Volksweisheit", das bei uns im WFG-Shop bezogen werden kann.