| Zurück |
Impressum
Datenschutz
Grobeis aus dem Weltraum und sein Zerfall im irdischen Luftmantel
I. Darstellung des von der Sonne auszufischenden Eishimmels des Milchstraßensystems.
Die Entstehung des uns
zunächst sichtbaren Sternen-Eis- und
Glut-Systems nach Hörbigers Theorie hat für den mit dem
Minenkriege (1. Weltkrieg) Vertrauten oder an schwere
Geschoßeinschläge Gewöhnten ihren eigenen Reiz.
Die Vorstellung der dabei auftretenden Kräfte auf engstem Raume
und ihre ins Freie ausblasende Wirkung ist fortreißend. Zum
Empfinden kann man sie am besten durch Dichterworte bringen (Faust II,
4. Aufzug., 1. Szene), die Mephisto in den Mund gelegt werden:
Da, wo zentralisch glühend, um und umEin ewig Feuer flammend sich entbrannte. -
Wir fanden uns bei allzu großer Hellung
In sehr gedrängter, unbequemer Stellung ---
Die Hölle schwoll von Schwefelstank und Säure -
Das gab ein Gas! Das ging ins Ungeheure --
Und wir entrannen knechtisch heißer Gruft -
Ins Übermaß der Herrschaft freier Luft. -
Ein offenbar Geheimnis, wohl verwahrt -
Und wird nur spät den Völkern offenbart.
Bildlich zeigt Voigt, "Eis -
ein Weltenbaustoff" 1928, Atlas, Tafel XI,
Bild IX das Ergebnis des Vorganges:
das in der Mitte schon etwas gegen die Scheibe des Eiskranzes
aufgerichtete Sonnensystem und den Eiskranz selbst, der zum Teil auf
ewig hinter der Sonne zurückbleiben, zum Teil bei ihrem
schnelleren Fortschreiten wieder in ihr Anziehungsfeld geraten und von
ihr ausgefischt werden muß.
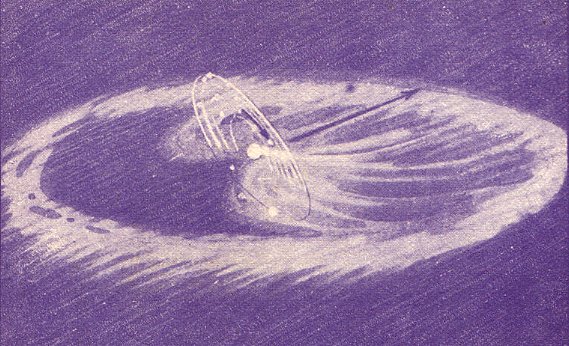
Abb. 1. (Bildquelle: Buch
"Welteis und Weltentwicklung" von H.W. Behm, 1926)
Unsere Sonnenwelt und Grobeiszufluß aus der ringförmigen (hier aus Raumgründen verengert gezeichnet) Eismilchstraße (Zeichnung Alfred Hörbiger).
Unsere Sonnenwelt und Grobeiszufluß aus der ringförmigen (hier aus Raumgründen verengert gezeichnet) Eismilchstraße (Zeichnung Alfred Hörbiger).
II. Darstellung des Eistrichters und seiner Doppelseitigkeit.
Es ist hier nicht die Aufgabe,
die Annäherung des Eises an Sonne
und Planeten zu beschreiben, sondern den Vorgang des Niedersturzes einzelner
Grobeiskörper auf die Erde.
Voigt "Eis - ein Weltenbaustoff" 1928, Atlas, Tafel XII, XIII, XIV
zeigt den Strudel, der unablässig niedersinkt und dabei sein Ende
auf Planeten und Sonne findet, sowie die Stellen größerer
oder geringerer Dichte und Körpergröße.
Wir sehen, daß uns die Sommermonate, besonders der Juni und Juli, die größten und eindrucksvollsten Grobeiseinschüsse bringen.
Wir sehen, daß uns die Sommermonate, besonders der Juni und Juli, die größten und eindrucksvollsten Grobeiseinschüsse bringen.
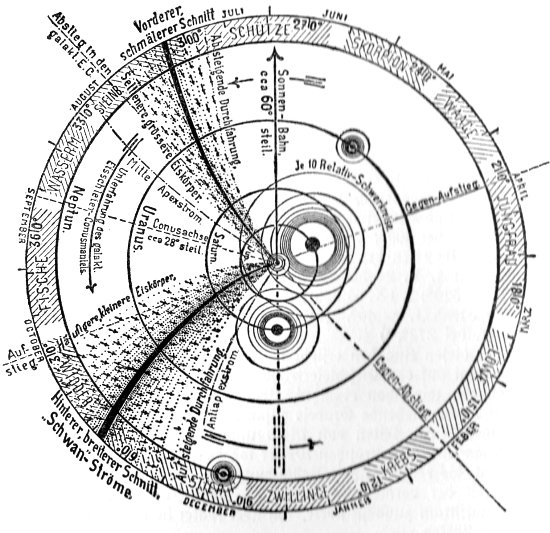
Abb. 2.
(Bildquelle/-text: "Rhythmus des
kosmischen Lebens" v. Hanns Fischer, 1925, Voigtländers
Verlag-Leipzig)
Schnitt durch das Eisschleierhorn, geführt in der Ebene der Großwandelsternbahnen. Grundlegendes Schaubild für die Erklärung des
Zusammenhanges der Sonnenflecken, der Großwetterlage, der Ernteerträge, sowie der psychischen und kulturellen Erscheinungen
auf Erden mit den Stellungen der Wandelsterne. (Zeichnung von Hanns Hörbiger)
Schnitt durch das Eisschleierhorn, geführt in der Ebene der Großwandelsternbahnen. Grundlegendes Schaubild für die Erklärung des
Zusammenhanges der Sonnenflecken, der Großwetterlage, der Ernteerträge, sowie der psychischen und kulturellen Erscheinungen
auf Erden mit den Stellungen der Wandelsterne. (Zeichnung von Hanns Hörbiger)
III. Darstellung der Hagelwahrnehmung auf der Erdoberfläche.
Vom Himmel hoch, da komm ich
her. - Wo der Hagel herkommt, das hat
Hörbiger erst spät den Völkern offenbart. Die
bisherige Wissenschaft führt die uns auf der Erdoberfläche
ins Auge, besser auf den Kopf fallenden Hagelkörner auf
atmosphärische Bildung zurück. Dem widerspricht
zunächst die auffallende Wahrnehmung, daß der Hagel strichweise in schmalen Streifen
fällt. Die Grobstückigkeit
setzt manchmal in Erstaunen - wie sollen sich solche Stücke im
Luftraum "angeschoppt" haben? Ihre bitterliche Kälte, die
lange Dauer des Abschmelzens, die dicken Massen, in denen sie fallen,
setzen Wissenschaftler und Laien immer wieder in Verwunderung, nicht
minder die Zertrümmerungen, Beschädigungen, Verwundungen, die
sie an Gebäuden, Kraft- und Lichtleitungen, an Tieren und Menschen
anrichten. Das alles soll in kürzester Frist wie aus dem
Nichts in unserem sonst so harmlosen Luftmantel entstehen und dann noch
in geradlinigen Strichen fallen? - Daß Hagel immer mit Sturm und fast immer mit Gewittererscheinungen auftritt, hat
die bisher landläufige Erklärung erzeugt, seine Bildung sei
Folgeerscheinung des Gewitters. Das Umgekehrte zu beweisen, ist
die Aufgabe. Ihr kommt zugute, daß der Hagelvorgang selbst nur kurze Zeit
anhält und rasche Aufheiterung ihm meistens folgt.
IV. Physikalische und ballistische Erwägungen.
Bleiben wir zur Führung
unseres Nachweises für die
Notwendigkeit der Entstehung der vorgenannten Erscheinungen, wie wir
sie auf der Erdoberfläche selbst beobachten, bei der Vorstellung,
daß das Eis des Hagels nicht im Luftmantel der Erde entsteht,
sondern in ihn eindringt. Dann kommt er eben als mehr oder
weniger großes Grobeisstück von außen her mit
gewaltiger Geschwindigkeit und schießt meist tangential in den
Luftmantel ein. War er bisher nur dem Zuge der Anziehungskraft
der Erde gefolgt, so wird er beim Eindringen in ihren Luftmantel
alsbald noch weiteren Einflüssen unterworfen, die wir physikalisch
und ballistisch untersuchen wollen.
Zunächst erfährt er schon in den höchsten, dünnsten Luftschichten eine gewaltige, immer stärker werdende Bremsung. Vor ihm und um ihn herum abfließende, durch die Stauchung erhitzte Luft wirkt schmelzend an seiner Oberfläche. Die Hemmung der Geschwindigkeit wandelt fortschreitend seine Bewegungsenergie in innere Wärme um. Das erzeugt nun einen besonderen Vorgang. Das Wasser nimmt unter den allermeisten Stoffen eine seltsame Ausnahmestellung ein; es wird nicht mit fortschreitender Abkühlung immer dichter, sondern sein Punkt größter Dichtigkeit liegt bei + 4°C. So muß also ein mit Weltraumtemperatur - 273°C in den Luftmantel einschießender Eiskörper bei zunehmender Erwärmung immer dichter werden, sein Volumen nimmt ab und darum muß er sich, spröde, wie er ist, mehr und mehr mit Sprüngen durchsetzen, die nicht nur speichenförmig, sondern auch schalig um den Mittelpunkt angeordnet sein müssen.
(Daß auch einmal aus einem großen Stück eine tellergroße, 3 cm dicke, mehr als 1 kg schwere Scheibe "herausspringen" kann lehrt uns folgende Meldung aus der "Zeitschrift für WEL", Heft 1, S. 30, Jahrg. 1933: Herr Gustav Hohns-Brefeld stellte uns folgende Zeitungsmeldung - Krefelder Zeitung vom 25. Juli 1932, Abendausgabe - zur Verfügung: Bern, 25. Juli 1932. Aus Biglen in Emmenthal wird von einer seltenen Naturerscheinung berichtet, die bei einem kürzlich dort aufgetretenen Hagelwetter beobachtet wurde. Es handelt sich um eine Schloße von außergewöhnlicher Größe. Sie war scheibenförmig und umfangreicher als ein Suppenteller, während ihre Dicke gut drei Zentimeter betrug. Die Schloße schlug eine Vertiefung in den Boden und war erst nach drei Tagen geschmolzen. Ihr Gewicht dürfte mehr als ein Kilo betragen haben. Sie sah nicht aus, als ob sie aus zusammengefrorenen Eiskörnern bestehe. Ihre Oberfläche war rauh und stachelig von Eiskristallen.)
Zunächst erfährt er schon in den höchsten, dünnsten Luftschichten eine gewaltige, immer stärker werdende Bremsung. Vor ihm und um ihn herum abfließende, durch die Stauchung erhitzte Luft wirkt schmelzend an seiner Oberfläche. Die Hemmung der Geschwindigkeit wandelt fortschreitend seine Bewegungsenergie in innere Wärme um. Das erzeugt nun einen besonderen Vorgang. Das Wasser nimmt unter den allermeisten Stoffen eine seltsame Ausnahmestellung ein; es wird nicht mit fortschreitender Abkühlung immer dichter, sondern sein Punkt größter Dichtigkeit liegt bei + 4°C. So muß also ein mit Weltraumtemperatur - 273°C in den Luftmantel einschießender Eiskörper bei zunehmender Erwärmung immer dichter werden, sein Volumen nimmt ab und darum muß er sich, spröde, wie er ist, mehr und mehr mit Sprüngen durchsetzen, die nicht nur speichenförmig, sondern auch schalig um den Mittelpunkt angeordnet sein müssen.
(Daß auch einmal aus einem großen Stück eine tellergroße, 3 cm dicke, mehr als 1 kg schwere Scheibe "herausspringen" kann lehrt uns folgende Meldung aus der "Zeitschrift für WEL", Heft 1, S. 30, Jahrg. 1933: Herr Gustav Hohns-Brefeld stellte uns folgende Zeitungsmeldung - Krefelder Zeitung vom 25. Juli 1932, Abendausgabe - zur Verfügung: Bern, 25. Juli 1932. Aus Biglen in Emmenthal wird von einer seltenen Naturerscheinung berichtet, die bei einem kürzlich dort aufgetretenen Hagelwetter beobachtet wurde. Es handelt sich um eine Schloße von außergewöhnlicher Größe. Sie war scheibenförmig und umfangreicher als ein Suppenteller, während ihre Dicke gut drei Zentimeter betrug. Die Schloße schlug eine Vertiefung in den Boden und war erst nach drei Tagen geschmolzen. Ihr Gewicht dürfte mehr als ein Kilo betragen haben. Sie sah nicht aus, als ob sie aus zusammengefrorenen Eiskörnern bestehe. Ihre Oberfläche war rauh und stachelig von Eiskristallen.)
Beim Einschuß eines
Grobeiskörpers führt
also die durch Bremsung
im Luftmantel erzeugte innere
Erwärmung unmittelbar zum Zerfall. Daß die vor
ihm her zusammengestauchte Luft in die Spalten dringen und die
Trümmer auseinandertreiben muß, befördert die
Ausstreuung der Trümmer noch mehr. Die Zerkleinerung der
Hagelstücke muß also um so mehr fortschreiten, je
länger ihr Weg im Luftraume wird. Es ist schon ein
Glück, daß die strudelförmige Annäherung der
ankommenden Fremd- und Eiskörper in den allermeisten Fällen
eine sehr tangentiale Einschußrichtung bedingt, sonst würden
uns noch ganz andere Eisstücke auf den Kopf hageln, als die im
Bilde noch zu zeigenden. Die Abschmelzung durch die gestauchte,
erwärmte Luft wirkt nebenher noch abrundend. Noch weitere
physikalische Folgen treten auf: der Grobeiskörper, aber auch
Feineis, bringt entweder schon eine elektrische
Ladung mit oder reißt elektrisch geladene Luft aus den
hohen Schichten mit in die tieferen hinab. Dieser Gewinn an
elektrischer Ladung oder zum mindesten die Annäherung muß
eine Induktionswirkung hervorbringen, die einerseits in Licht-, Kraft-
und Fernleitungen (s. "Zeitschrift für Welteislehre", Heft 1, S.
11-14, Jahrg. 1933) und Radio-Apparaten fühlbar wird und
andererseits gewitterbildend wirkt. Letztere Einwirkung wird noch
dadurch verstärkt, daß
kalte Luft, in wärmere Schichten hinabgerissen, kondensierend und
regenbildend wirkt, wobei die Kondensation
noch spannungserhöhend
wirkt. Das Gewitter ist also Folge,
nicht Ursache des Hagels. Mechanisch
macht sich die vorwärtsgeschobene
und mitgerissene Luft als Sturm fühlbar.
Das Zerspringen ermöglicht
innerhalb der widerstehenden Luft aber
auch noch eine besondere, ballistische,
die Flugrichtung der Eistrümmer stark beeinflussende Einwirkung, die den älteren
Artilleristen aus der Zeit der glatten Geschütze her noch wohl
erinnerlich ist.
Die Vollkugel beschreibt im Luftraum statt der Parabel die ballistische Kurve, eine weit kürzere Bahn mit flacherem aufsteigenden und steilerem absteigenden Ast.
Das Gesetz sollte an sich auch auf einen heilbleibenden Eisblock zutreffen, bei dem Schwerpunkt und Mittelpunkt zusammenfallen. Das trifft aber nicht zu, und Flugbahnen müssen entstehen, die wir von den Kugelgranaten mit ellipsoidaler Höhlung her kennen. Vergl. Abb. 3.
Die Vollkugel beschreibt im Luftraum statt der Parabel die ballistische Kurve, eine weit kürzere Bahn mit flacherem aufsteigenden und steilerem absteigenden Ast.
Das Gesetz sollte an sich auch auf einen heilbleibenden Eisblock zutreffen, bei dem Schwerpunkt und Mittelpunkt zusammenfallen. Das trifft aber nicht zu, und Flugbahnen müssen entstehen, die wir von den Kugelgranaten mit ellipsoidaler Höhlung her kennen. Vergl. Abb. 3.
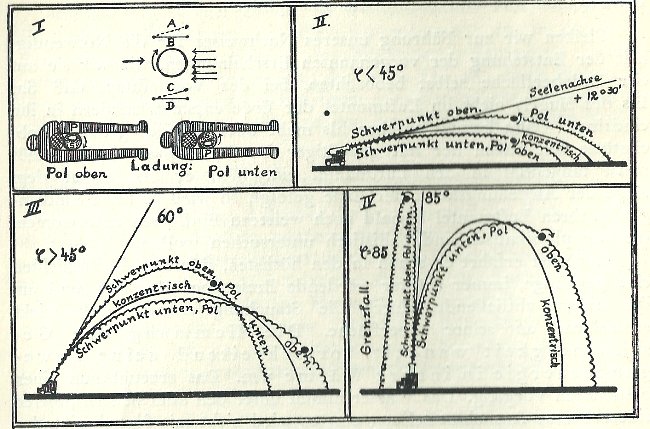
Abb. 3.
I. Einfluß des Luftwiderstandes auf eine fliegende und umrollende Kugel. Bei B ist Verdickung und Stau, die Windfahne bei A schlägt unter Überdruck nach oben aus. Bei C entleert der Sog der umrollenden Kugelhaut den Stau, die Windfahne bei D wird angesaugt. Der Luftwiderstand drückt die Kugel nach unten.
II. Flugbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Untere Erhöhungsgruppe. Pol unten = Weitschuß. Pol oben = Kurzschuß.
III. Wurfbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Obere Erhöhungsgruppe. Pol oben = Weitschuß. Pol unten = Steilschuß.
IV. Wurfbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Grenzfall: Pol unten erzeugt Schuß hinter den Mörser.
I. Einfluß des Luftwiderstandes auf eine fliegende und umrollende Kugel. Bei B ist Verdickung und Stau, die Windfahne bei A schlägt unter Überdruck nach oben aus. Bei C entleert der Sog der umrollenden Kugelhaut den Stau, die Windfahne bei D wird angesaugt. Der Luftwiderstand drückt die Kugel nach unten.
II. Flugbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Untere Erhöhungsgruppe. Pol unten = Weitschuß. Pol oben = Kurzschuß.
III. Wurfbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Obere Erhöhungsgruppe. Pol oben = Weitschuß. Pol unten = Steilschuß.
IV. Wurfbahn der Granate mit ellipsoidaler Höhlung. Grenzfall: Pol unten erzeugt Schuß hinter den Mörser.
Schon eine Vollkugel
erfährt, wenn sie eine Rollbewegung in die
Flugbahn mitbringt, eine Ablenkung durch die Luft, die ihrer
Umlaufsrichtung stauend entgegenwirkt. Das verstärkt sich
bei Hohlkugeln mit nicht mehr konzentrischem Schwerpunkt ganz
wesentlich; die Richtung ihrer Umdrehung empfangen sie durch den
Stoß der Pulvergase, der sie schon im Rohr rollen
läßt. Ihre Flugbahnen sind dementsprechend verschieden
und um so verschiedener, je nachdem ihr Abgangswinkel der unteren oder
oberen Erhöhungsgruppe angehört. Der Grund dafür
liegt in der Umkehr der Bewegungsrichtung des Geschosses im Scheitel
der steilen Flugbahnen (Abb. 3, II, III).
Das geht so weit, daß aus dem Mörser bei genügend steiler Erhöhung (+ 85°) und "Pol unten" die Hohlkugel bis hinter das Geschütz geschossen werden kann (Abb. 3, IV). Die eigene Rollbewegung, die ein in den Luftmantel einschießender Grobeiskörper mitbringt, wird an sich unbeträchtlich sein. Rollzeit und Umlaufszeit werden gleich sein.
Selbst wenn er die Erde schon mehrmals umkreist haben sollte, wird seine Umdrehungszeit einige Stunden betragen. Viel "Effekt" bringt er also nicht mit. Zerspringt er aber in unregelmäßig geformte Stücke mit exzentrischer Schwerpunktlage, so fangen diese unter dem Einfluß des Luftwiderstandes eine Rollbewegung an, die der im Geschützrohr gewonnenen entgegengesetzt sein muß und Ablenkungen hervorrufen wird, die in ihrem Sinne durchaus an die Verschiedenheit der Hohlkugelbahnen bei "Pol oben" oder "Pol unten" erinnern.
Betrachten wir so vorbereitet das Bild vom Zerfall des Grobeises im Luftmantel nach Zeiten, Zonen und Bahnen.
Das geht so weit, daß aus dem Mörser bei genügend steiler Erhöhung (+ 85°) und "Pol unten" die Hohlkugel bis hinter das Geschütz geschossen werden kann (Abb. 3, IV). Die eigene Rollbewegung, die ein in den Luftmantel einschießender Grobeiskörper mitbringt, wird an sich unbeträchtlich sein. Rollzeit und Umlaufszeit werden gleich sein.
Selbst wenn er die Erde schon mehrmals umkreist haben sollte, wird seine Umdrehungszeit einige Stunden betragen. Viel "Effekt" bringt er also nicht mit. Zerspringt er aber in unregelmäßig geformte Stücke mit exzentrischer Schwerpunktlage, so fangen diese unter dem Einfluß des Luftwiderstandes eine Rollbewegung an, die der im Geschützrohr gewonnenen entgegengesetzt sein muß und Ablenkungen hervorrufen wird, die in ihrem Sinne durchaus an die Verschiedenheit der Hohlkugelbahnen bei "Pol oben" oder "Pol unten" erinnern.
Betrachten wir so vorbereitet das Bild vom Zerfall des Grobeises im Luftmantel nach Zeiten, Zonen und Bahnen.
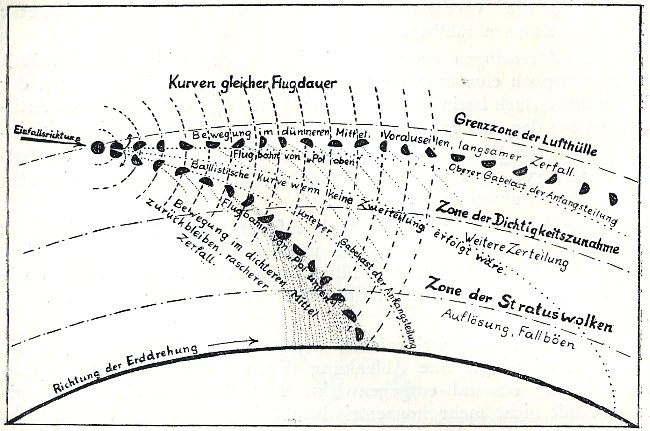
Abb. 4. Zerteilung eines
eingeschossenen Grobeiskörpers, ballistische Einwirkung des
Luftwiderstandes und fortschreitender Zerfall. (Schematisch.)
Unsere Abbildung 4 zeigt diese
Art des "ballistischen Zerfalles" in
verschiedenen Zeitstufen und beweist dazu noch, daß die
ballistische Einwirkung des Luftwiderstandes zum mindesten in der
überwiegenden Zahl der Fälle das Trefferbild des zerfallenden
Grobeisblockes noch mehr in die Länge ziehen muß, als das
schon ohnehin bei den großen, in Betracht kommenden
Geschwindigkeiten und der sehr tangentialen Einschußrichtung der
Fall sein würde. Wenn nun gar der einschießende
Eisblock noch eine eigene Rollbewegung mitbringt, so müssen die
Zerfalls- und Flugbahnverhältnisse noch wesentlich verwickelter
ausfallen. Immer aber muß beim Fortschreiten im Luftmantel
bei dessen zunehmender Dichte und Geschwindigkeitsabnahme der
Eistrümmer deren Zerfall mit fortschreitender innerer
Erwärmung reißend zunehmen.
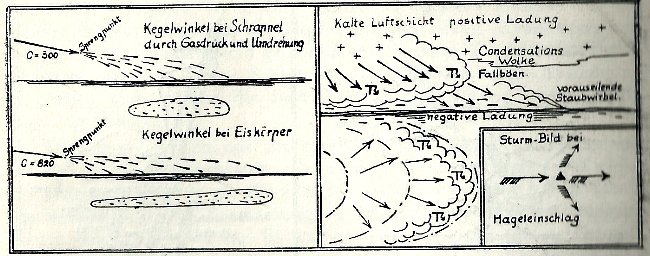
Abb.
5a. Kegelwinkel
bei Schrapnell und Eiskörper. Kegelwinkel beim Schrapnell
durch Gasdruck und Umdrehung hervorgerufen, beim Eiskörper nur
durch Eindringen von Luft in die Spalten des Zerfalls und durch
Geschwindigkeitsunterschiede, daher zu Beginn schmaler und wegen
größerer Endgeschwindigkeit noch länger als beim
Schrapnell.
Abb. 5b. Sturmbild bei Hagelschlag in Seitenansicht, Aufsicht und meteorologischer Darstellung.
Abb. 5b. Sturmbild bei Hagelschlag in Seitenansicht, Aufsicht und meteorologischer Darstellung.
So erhalten wir beim Auftreffen
des Grobeiseinschusses auf den festen
Erdboden ein Trefferbild, wie es der Schrotschuß oder
Kartätschschuß, mehr noch wie es der Schuß des
Bodenkammerschrapnells bei großer Endgeschwindigkeit und flachem
Fallwinkel erzeugen, (Abb. 5a), also den streifenartigen, strichweisen
Eindruck des Hagelfalles, mit sehr schmalem Beginn und am Ende
streuend, mit vereinzelten, sich weiter ausbreitenden Treffern.
Selbst bei Darstellung der "Wasserbedeckung" = Benetzungsfläche,
tritt das noch hervor.
Die Bilder einer Anzahl von Hagelfällen mögen dafür die Belege liefern.
1. Hagelfall vom 27. 5. 1929. Gegend von Bischofswerda über Schwerin-Bomst bis Flatow-Schlochau (Abb. 6).
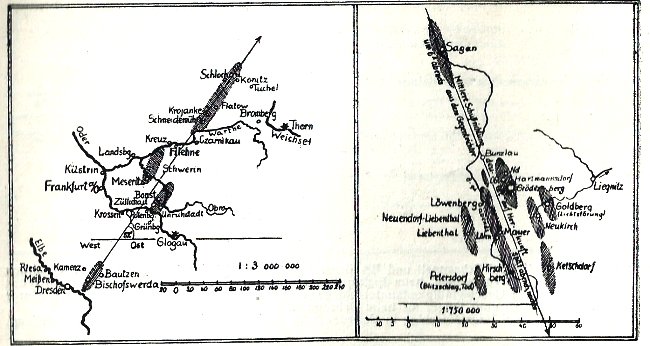
Abb.
6. (links) Hagelfall
vom 27. Mai 1929. Trefferbild: Sehr strichweiser
Schrapnellschuß mit flacher Bahn, 360 km Strichlänge.
Das Bild mit seinen unterbrochenen Einschlägen beweist, daß
der Hagelfall nicht aus einem fortschreitenden atmosphärischen
Wirbel stammen kann, sondern den Trümmerstücken eines
zerfallenden Körpers entspricht.
Abb. 7. (rechts) Hagelfall vom 26. April 1930. Trefferbild, wie bei einem Schrapnell in großer Sprenghöhe und merklichem Fallwinkel, zeigt an, daß die Hagelfälle nicht aus einem fortschreitenden, atmosphärischen Wirbel stammen. Zerteilung des Eiskörpers von vorn herein in mehrere große Stücke. Tiefenstreuung 115 km. Gesamtbreite 35 km, einzelne Stücke aber schmal. Gewaltige Wassermassen. Bei Gr. Hartmannsdorf dicke, tagelang liegengebliebene Eismassen.
Abb. 7. (rechts) Hagelfall vom 26. April 1930. Trefferbild, wie bei einem Schrapnell in großer Sprenghöhe und merklichem Fallwinkel, zeigt an, daß die Hagelfälle nicht aus einem fortschreitenden, atmosphärischen Wirbel stammen. Zerteilung des Eiskörpers von vorn herein in mehrere große Stücke. Tiefenstreuung 115 km. Gesamtbreite 35 km, einzelne Stücke aber schmal. Gewaltige Wassermassen. Bei Gr. Hartmannsdorf dicke, tagelang liegengebliebene Eismassen.
Man erkennt besonders den
gleich anfänglichen Zerfall eines
mächtigen Körpers in vier große Stücke, auch seine
mächtige Geschwindigkeit, denn die Gesamteinschlagsfläche ist
rund 360 km lang. Das kann bei allem Einfluß eintretender
Rollbewegung des obersten Stückes doch nur auf eine gewaltige
Energie und Masse zurückgeführt werden. - Gemeldet werden starke Schloßen (Hagelstücke),
wolkenbruchartiger Regen, ungeheure Flurschäden, auch solche durch
die abfließenden Wassermengen, viele Blitzschläge mit 2
Scheunenbränden, 1 Mann und 1 Kuh vom Blitz erschlagen.
Zeitangaben leider mangelhaft.
2.
Hagelfall vom 26. 4. 1930. Gegend von Sagan über den
Kreis Löwenberg hinweg bis Hirschberg im Riesengebirge (Abb. 7).
Auch hier ist der Zerfall gleich anfangs in mehrere, große Stücke unverkennbar; in jeder der einzelnen Benetzungsflächen tritt ein Hagelkern auf. Immerhin ist der vom weitest geflogenen Teilstück zurückgelegte Weg noch lang genug, die Gesamtlänge der Einschlagsfläche beträgt immer noch 115 km. Die gerade Richtung, die Streifen und die Lücken erweisen ganz deutlich, wie auch bei dem vorhergegangenen Bilde, daß die Hagelfälle nicht einem Wettersturz oder einer vordringenden Gewitterfront entstammen, sondern daß die den Luftraum durchfahrenden Schloßenschauer Gewitter und Sturm durch Mitreißen von kalter Luft in die warmen Schichten über dem Erdboden erst erzeugt haben.
An Schäden werden auch hierbei gemeldet: Schwere Hagelschloßen, die stellenweise noch bis zum nächsten Tage liegen blieben, Überschwemmungen, wobei 1 Mann ertrank, Ersäufungen, Verschlammungen, schwerste Flur- und Gartenschäden, Beschädigungen an einem Bahnkörper und Blitzschäden, wobei auch ein Gespann getroffen wurde.
Zeiten und Richtung erweisen das Fortschreiten des Wetters zu abendlicher Zeit, der Hörbigerschen Darstellung entsprechend, in einer Richtung, die mir aus dem Gegenkegel (s. Abb. 2 - Zeitraum Februar bis Mai) zu stammen scheint, und beträchtliche Fluggeschwindigkeit eines mächtigen Grobeiskörpers, der ziemlich tangential eingeschossen sein muß.
Auch hier ist der Zerfall gleich anfangs in mehrere, große Stücke unverkennbar; in jeder der einzelnen Benetzungsflächen tritt ein Hagelkern auf. Immerhin ist der vom weitest geflogenen Teilstück zurückgelegte Weg noch lang genug, die Gesamtlänge der Einschlagsfläche beträgt immer noch 115 km. Die gerade Richtung, die Streifen und die Lücken erweisen ganz deutlich, wie auch bei dem vorhergegangenen Bilde, daß die Hagelfälle nicht einem Wettersturz oder einer vordringenden Gewitterfront entstammen, sondern daß die den Luftraum durchfahrenden Schloßenschauer Gewitter und Sturm durch Mitreißen von kalter Luft in die warmen Schichten über dem Erdboden erst erzeugt haben.
An Schäden werden auch hierbei gemeldet: Schwere Hagelschloßen, die stellenweise noch bis zum nächsten Tage liegen blieben, Überschwemmungen, wobei 1 Mann ertrank, Ersäufungen, Verschlammungen, schwerste Flur- und Gartenschäden, Beschädigungen an einem Bahnkörper und Blitzschäden, wobei auch ein Gespann getroffen wurde.
Zeiten und Richtung erweisen das Fortschreiten des Wetters zu abendlicher Zeit, der Hörbigerschen Darstellung entsprechend, in einer Richtung, die mir aus dem Gegenkegel (s. Abb. 2 - Zeitraum Februar bis Mai) zu stammen scheint, und beträchtliche Fluggeschwindigkeit eines mächtigen Grobeiskörpers, der ziemlich tangential eingeschossen sein muß.
3.
Der Hagelfall vom 27. 5. 1930 bei Petersdorf - Ludwigsmühle -
Gläsersdorf in nächster Nähe von Primkenau zeigt dagegen
ein anderes Gepräge: Auch hier handelt es sich um Schloßen
von Haselnußgröße, die den Boden 2-3 cm hoch noch
längere Zeit bedeckten, Vernichtung der Fluren (Roggen vernichtet,
Felder, Obstgärten schlimm heimgesucht), Beschädigungen an
der Hochspannungsleitung (Kabel zerrissen), Isolatoren
zertrümmert, und Blitzschläge, die einen Transformatorbrand
erzeugten und als kalter Schlag ein Haus trafen. Die Ausdehnung
ist gering, man möchte die Bezeichnung "punktförmig" oder
"Platzhagel" gebrauchen.
Hier kann es sich nur um einen kleinen Eiskörper handeln, der ziemlich steil eingeschossen sein muß und bei flacherem Fallwinkel die Erdoberfläche nur als flüssiger Niederschlag erreicht haben würde. Die kurze Dauer der Erscheinung, ¼ Stunde, wird in den Zeitungsberichten besonders erwähnt. Es war ein "Schuß aus heiterem Himmel".
Hier kann es sich nur um einen kleinen Eiskörper handeln, der ziemlich steil eingeschossen sein muß und bei flacherem Fallwinkel die Erdoberfläche nur als flüssiger Niederschlag erreicht haben würde. Die kurze Dauer der Erscheinung, ¼ Stunde, wird in den Zeitungsberichten besonders erwähnt. Es war ein "Schuß aus heiterem Himmel".
4.
Das war zwar auch am 4 Juli 1929, einem besonders eindrucksvollen
Hageltage der Fall, aber dieser Tag zeigt die seltsame Häufung von
4 ganz mächtigen Hagelstrichen, die sich untereinander sehr
ähnlich sehen (Abb. 8).
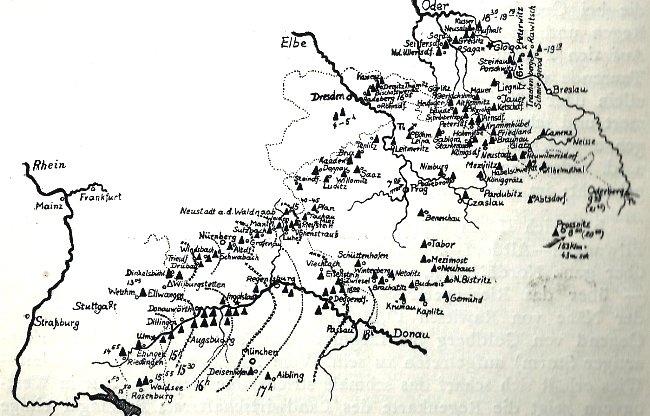
Abb.
8. Hagelfälle
vom 4. Juli 1929. Die eingezeichneten Isobronten stellen sich als
Kopfwellen des fliegenden Hagelgeschosses dar, dem Schauer entsprechend
gerundet.
a)
Strich I. Schon im östlichen Erzgebirge beginnend
über Radeberg - Bischofswerda - Sorau - Greisitz b. Sagan -
Neusalz a. d. Oder - Aufhalt a. d. Oder.
Hagellücken scheinen in der Gegend von Dresden, von Bautzen bis zur Sorauer Gegend und in der Gegend von Freystadt aufgetreten zu sein; das deutet bei der sonst sehr schmalen Bahn auf einen gleich anfänglichen Zerfall des Grobeiskörpers in nur wenige Stücke, die sich bei flachem Einschußwinkel dem vorher gezeigten theoretischen Bilde gemäß fortbewegt haben müssen. Im östlichen Erzgebirge beginnend, kommt der Hagelstrich über Radeberg - Bischofswerda (4,35) - Seifersdorf bei Sorau - Greisitz (Gewitter und Hagel 5,30) - Neusalz (Gewitter und Hagel 6,30) - Aufhalt (Gewitter, Hagel und Sturm 7,15) abends zu Ende. Das sind 100 km in der Stunde (27 m sec.). Hier muß ein großer Körper fast genau tangential eingeschossen, in den höchsten, dünnsten Luftschichten lange verweilt haben und nur allmählich zerfallen sein.
Die den Erdboden erreichenden Trümmer fielen in beträchtlicher Größe und sehr dicht, auch noch gewaltige Luftmassen mitreisend. Berichtet wird von Schloßen in Walnuß- und Hühnereigröße, die bei Greisitz bis 25 cm hoch gehäuft lagen, wolkenbruchartigem Regen und orkanartigem Sturm; die Schäden sind dementsprechend. Auf den Fluren kein Halm, an Bäumen kein Blatt mehr, nicht nur Tausende von Fensterscheiben zerschlagen (bei Gruschwitz in Neusalz allein über 3000!), sondern auch massenhaft Dachziegel zertrümmert und schwere Schäden an Telegraphen- und Hochspannungsleitungen angerichtet. Blitzschläge sind mehrfach gemeldet und in Aufhalt a. d. Oder der Glockenturm durch Blitz und Sturm zum Einsturz gebracht; im nahen Walde Bäume entwurzelt.
Hagellücken scheinen in der Gegend von Dresden, von Bautzen bis zur Sorauer Gegend und in der Gegend von Freystadt aufgetreten zu sein; das deutet bei der sonst sehr schmalen Bahn auf einen gleich anfänglichen Zerfall des Grobeiskörpers in nur wenige Stücke, die sich bei flachem Einschußwinkel dem vorher gezeigten theoretischen Bilde gemäß fortbewegt haben müssen. Im östlichen Erzgebirge beginnend, kommt der Hagelstrich über Radeberg - Bischofswerda (4,35) - Seifersdorf bei Sorau - Greisitz (Gewitter und Hagel 5,30) - Neusalz (Gewitter und Hagel 6,30) - Aufhalt (Gewitter, Hagel und Sturm 7,15) abends zu Ende. Das sind 100 km in der Stunde (27 m sec.). Hier muß ein großer Körper fast genau tangential eingeschossen, in den höchsten, dünnsten Luftschichten lange verweilt haben und nur allmählich zerfallen sein.
Die den Erdboden erreichenden Trümmer fielen in beträchtlicher Größe und sehr dicht, auch noch gewaltige Luftmassen mitreisend. Berichtet wird von Schloßen in Walnuß- und Hühnereigröße, die bei Greisitz bis 25 cm hoch gehäuft lagen, wolkenbruchartigem Regen und orkanartigem Sturm; die Schäden sind dementsprechend. Auf den Fluren kein Halm, an Bäumen kein Blatt mehr, nicht nur Tausende von Fensterscheiben zerschlagen (bei Gruschwitz in Neusalz allein über 3000!), sondern auch massenhaft Dachziegel zertrümmert und schwere Schäden an Telegraphen- und Hochspannungsleitungen angerichtet. Blitzschläge sind mehrfach gemeldet und in Aufhalt a. d. Oder der Glockenturm durch Blitz und Sturm zum Einsturz gebracht; im nahen Walde Bäume entwurzelt.
b)
Strich II. In Württemberg bei Welzheim 13, 05 beginnend,
über Ellwangen - Altdorf - Sulzbach - Weiden - Neustadt a. d.
Waldnaab - über ganz Nordböhmen, anscheinend nur mit wenigen
Lücken hinweg - über das Riesengebirge - Liegnitz - Steinau,
bei Schmiegerode in der Nähe von Rawitsch 19,32 endend.
Lücken scheinen nur in der Gegend von Goldberg bis Liegnitz (dort
nur Graupeln aber orkanartiger Sturm) aufgetreten zu sein. Vom
Anfange bis Tachau - Plan - Wies erhält sich scharf das schmale
strichartige Gepräge. Nur in Westbayern zeigt die Regenkarte
des Landwirtschaftsrats Benzinger einige seitliche Splitter; gegen das
Ende der Trefferfläche tritt eine gewisse Seiten- und besonders
Längenstreuung auf, ein Zeichen, daß beim Eintritt in den
Luftmantel ein oberes Teilstück infolge des "Pol oben" - Effekts
eine sehr tangentiale Bahn in sehr dünnen Luftschichten
eingeschlagen hat und erst sehr allmählich zerfallen ist.
Wir haben hier also das ballistische Bild eines Schrapnellschusses bei
sehr flachem Einfallwinkel und sehr hoher Endgeschwindigkeit.
Wenn man die Gesamtlänge der ganzen Hagelstrecke - 640 km - durch die Gesamtzeit des Hagelfalles - 387 Minuten - teilt, so erhält man eine Fortschrittsgeschwindigkeit von rund 100 km in der Stunde. Die Bayerische Wetterdienststelle errechnet für Bayern allein nur 80 km in der Stunde. Somit ergab die Fluggeschwindigkeit des untersten, zuerst die Erde erreichenden Teilstücks mal cos des steileren Fallwinkels nur 80 km, diejenige des obersten, am flachsten fliegenden Teilstücks mal cos des zugehörigen, flachen Fallwinkels 100 km. Die Zerteilung des Grobeiskörpers erfolgt schon sehr bald nach dem Einschuß und der eingangs erläuterte ballistische Einfluß des Luftmantels werden also durch diese Verschiedenheit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit innerhalb desselben Hagelstrichs aufs handgreiflichste nachgewiesen. Es ist schwer, zu glauben, daß ein fortschreitender Gewitterwirbel eine gleiche Erscheinung hervorbringen sollte.
Wieder werden die entsprechenden Hagelerscheinungen gemeldet: Schloßen von Walnuß- bis Hühnereigröße, in der Gegend von Dinkelsbühl - Altdorf - Sulzbach bis Faustgröße, in Ellwangen 20 - 30 cm, bei Dinkelsbühl 20 cm hoch liegend und lange liegenbleibend, ungeheure Regenmassen dazu. Eine Frau totgeschlagen, viele Leute verletzt, einige blutüberströmt, bewußtlos liegenbleibend. 50 Schafe tot, Tierärzte hatten alle Hände voll zu tun, Wild, Gänse, Enten, Tauben, Singvögel in Massen tot, Ernte an Früchten jeglicher Art völlig vernichtet, zahllose Dachziegel zerschlagen (in Schwabach allein über 100 000), Dächer abgehoben. An Fern-, Licht- und Kraftleitungen sehr viele weit ausgedehnte Zerstörungen, Eisenbahnwagen auf Bahngleisen durch Sturm ins Rollen gebracht, im D-Zug Berlin-München 75 Fensterscheiben zertrümmert, 35 Reisende verletzt; starke Zugverspätungen infolge umgebrochener Gestänge und gestörter Leitungen, durch viele Blitzschläge Schäden: 1 Ehepaar und 2 Männer getötet, einer Frau bei Tachau durch ein einziges Hagelkorn das Schultergelenk ausgerenkt, Blitzschlag in einer Liegnitzer elektrischen Bahn, mehrere umgewehte Scheunen, viele starke Bäume an vielen Stellen entwurzelt, durch die gefallenen Wassermassen meterhohe Schuttmassen angeschwemmt. Auffallend ist, daß auf dem Riesengebirge nur schwacher Hagel - Heufuderbaude nur Graupeln - bei wolkenbruchartigem Regenfall auftrat, bei Hirschberg und Krummhübel aber schwerer Hagel. Das läßt auf "Lücken" zwischen einzelnen Trümmerstücken schließen; es wiederholt sich auch nach einer "Lücke" mit den Graupeln und furchtbaren Sturm- und Blitzschäden bei Liegnitz. Die Zeitungen heben noch besonders hervor: Kaum nennenswerte Abkühlung, alsbaldige Aufheiterung nach den nur 7-15 Minuten dauernden Hagelschauern: Solcher Hagel soll einem Gewitterzuge entspringen? Umgekehrt ist es! Der Gewitterstrich ist nichts als eine Folgeerscheinung des Hagelfalles.
Wenn man die Gesamtlänge der ganzen Hagelstrecke - 640 km - durch die Gesamtzeit des Hagelfalles - 387 Minuten - teilt, so erhält man eine Fortschrittsgeschwindigkeit von rund 100 km in der Stunde. Die Bayerische Wetterdienststelle errechnet für Bayern allein nur 80 km in der Stunde. Somit ergab die Fluggeschwindigkeit des untersten, zuerst die Erde erreichenden Teilstücks mal cos des steileren Fallwinkels nur 80 km, diejenige des obersten, am flachsten fliegenden Teilstücks mal cos des zugehörigen, flachen Fallwinkels 100 km. Die Zerteilung des Grobeiskörpers erfolgt schon sehr bald nach dem Einschuß und der eingangs erläuterte ballistische Einfluß des Luftmantels werden also durch diese Verschiedenheit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit innerhalb desselben Hagelstrichs aufs handgreiflichste nachgewiesen. Es ist schwer, zu glauben, daß ein fortschreitender Gewitterwirbel eine gleiche Erscheinung hervorbringen sollte.
Wieder werden die entsprechenden Hagelerscheinungen gemeldet: Schloßen von Walnuß- bis Hühnereigröße, in der Gegend von Dinkelsbühl - Altdorf - Sulzbach bis Faustgröße, in Ellwangen 20 - 30 cm, bei Dinkelsbühl 20 cm hoch liegend und lange liegenbleibend, ungeheure Regenmassen dazu. Eine Frau totgeschlagen, viele Leute verletzt, einige blutüberströmt, bewußtlos liegenbleibend. 50 Schafe tot, Tierärzte hatten alle Hände voll zu tun, Wild, Gänse, Enten, Tauben, Singvögel in Massen tot, Ernte an Früchten jeglicher Art völlig vernichtet, zahllose Dachziegel zerschlagen (in Schwabach allein über 100 000), Dächer abgehoben. An Fern-, Licht- und Kraftleitungen sehr viele weit ausgedehnte Zerstörungen, Eisenbahnwagen auf Bahngleisen durch Sturm ins Rollen gebracht, im D-Zug Berlin-München 75 Fensterscheiben zertrümmert, 35 Reisende verletzt; starke Zugverspätungen infolge umgebrochener Gestänge und gestörter Leitungen, durch viele Blitzschläge Schäden: 1 Ehepaar und 2 Männer getötet, einer Frau bei Tachau durch ein einziges Hagelkorn das Schultergelenk ausgerenkt, Blitzschlag in einer Liegnitzer elektrischen Bahn, mehrere umgewehte Scheunen, viele starke Bäume an vielen Stellen entwurzelt, durch die gefallenen Wassermassen meterhohe Schuttmassen angeschwemmt. Auffallend ist, daß auf dem Riesengebirge nur schwacher Hagel - Heufuderbaude nur Graupeln - bei wolkenbruchartigem Regenfall auftrat, bei Hirschberg und Krummhübel aber schwerer Hagel. Das läßt auf "Lücken" zwischen einzelnen Trümmerstücken schließen; es wiederholt sich auch nach einer "Lücke" mit den Graupeln und furchtbaren Sturm- und Blitzschäden bei Liegnitz. Die Zeitungen heben noch besonders hervor: Kaum nennenswerte Abkühlung, alsbaldige Aufheiterung nach den nur 7-15 Minuten dauernden Hagelschauern: Solcher Hagel soll einem Gewitterzuge entspringen? Umgekehrt ist es! Der Gewitterstrich ist nichts als eine Folgeerscheinung des Hagelfalles.
c)
Strich III. beginnt 2.55 (14.55) schmal bei Riedlingen und setzt
sich über Ulm längs der Donau fort; von Ingolstadt ab macht
sich eine gewisse Seitenverschiebung und Verbreitung des Trefferbildes
erkennbar, als folge dem Zerfall eines ersten, großen nun der
Zerfall eines ähnlich großen, seitlich abirrenden
Stückes, und in Böhmen gehen östlich des
Böhmerwaldes die Hagelpunkte seitlich noch mehr auseinander.
Leider berichtet die Prager Wetterwarte wohl über das Vordringen
einer Gewitter- und Regenzone, scheint aber die einzelnen Striche
zeitlich und räumlich nicht auseinanderzuhalten, denn sie
erwähnt das Auftreten von Hagel an vielen Stellen wohl ganz
nebenbei, sieht in der ganzen Erscheinung aber nur einen
Kaltluftvorstoß, betont, daß die Niederschläge keine
Überschreitung normaler Ergiebigkeit darstellen und gibt mit
besonderem Nachdruck an, daß die verursachten Schäden auf
den Sturm zurückzuführen sind. - Ich verdanke die
Angaben der Hagelorte Herrn Professor Hiersche und Herrn Oberingenieur
Köhler, der auch aus damaligen Zeitungen mit großer Sorgfalt
Nachrichten über die angerichteten Schäden zusammengesucht
hat, und desgleichen Professor Morres und Löffler, der von den
Gemeinden und Bezirken Mestsky, Tachau,
Prachatitz, Braunau und Leitmeritz zum Teil sehr wertvolle Angaben
erhalten hat. Immerhin läßt sich der Hagelzug nach
einer Lücke beiderseits der Moldau über Beneschau - Czaslau -
Pardubitz - Meziritz - Neustadt bis in die Grafschaft Glatz verfolgen,
wo er, auch bei seitlicher Streuung, um 10.40 (22.40) bei Camenz a. d.
Neiße geendet hat. - Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist rund
100 km in der Stunde (28 m sec.). - Die Verteilung der einzelnen
Hagelschläge gleicht bei diesem Striche ganz besonders derjenigen
der Kugeln des Schrapnellschusses bei flachem Einfallwinkel und hoher
Fluggeschwindigkeit, und das Bild wäre noch deutlicher, wenn meine
böhmischen Angaben ebenso vollständig wie meine bayrischen
und schlesischen wären.
Beachtenswert sind die von der
Münchner Wetterwarte angegebenen
Isobronten, welche mit auf Abb. 8 eingetragen sind; sie stellen die
Kopfwelle des fliegenden Geschosses dar, nur, daß sie sich nicht
um das kleine Vollgeschoß, sondern um die Wolke der
Sprengtrümmer herumlegen und auch nicht unmittelbare Erzeugnisse
der fliegenden Trümmer selbst, sondern der mitgerissenen,
kondensierenden und gewitternden Luftmassen sind. Das ist
experimentell sehr hübsch darzustellen. Man richte einmal
einen starken Wasserstrahl schräg von oben auf eine dick
verstaubte Chaussee, so sieht man um dessen Einschlag herum den Staub
in Wolken aufwirbeln. Ein raschfahrender Kraftwagen zeigt
dasselbe Bild. Aus vielen Beobachtungsangaben der Berliner
Wetterwarte habe ich übrigens auch das gleiche Sturmbild
herausschälen können, das ich in Abb. 5 b zugleich mit dem
Bild der Kondensationswolke und der Isobronten dem Leser vorführe.
-
So wirbelt eben der
fortschreitende Hagelzug die Gewitterwolken kopfwellenartig auf; er braucht die
Luft auch gar nicht erst auf dem Erdboden aufzustauchen, sondern
staucht von obenher kalte Luft in untere, wärmere Schichten hinein.
In Gestalt der auf Abbildung 5 b unten links gegebenen Aufsicht sähe ein hochfliegender Ballon oder Flieger den einschlagenden Hagelzug; nur wäre ihm zu wünschen, daß er nicht in die Schußbahn selbst geriete, denn dort würde er Hagelstücke von sehr unerwünschter Größe und Durchschlagskraft zu fühlen bekommen. Das Bild von Ensisheim 1492 (Abb. 9) zeigt die gleiche Erscheinung, für einen Meteoriten, besonders den "Nachlauf". -
In Gestalt der auf Abbildung 5 b unten links gegebenen Aufsicht sähe ein hochfliegender Ballon oder Flieger den einschlagenden Hagelzug; nur wäre ihm zu wünschen, daß er nicht in die Schußbahn selbst geriete, denn dort würde er Hagelstücke von sehr unerwünschter Größe und Durchschlagskraft zu fühlen bekommen. Das Bild von Ensisheim 1492 (Abb. 9) zeigt die gleiche Erscheinung, für einen Meteoriten, besonders den "Nachlauf". -
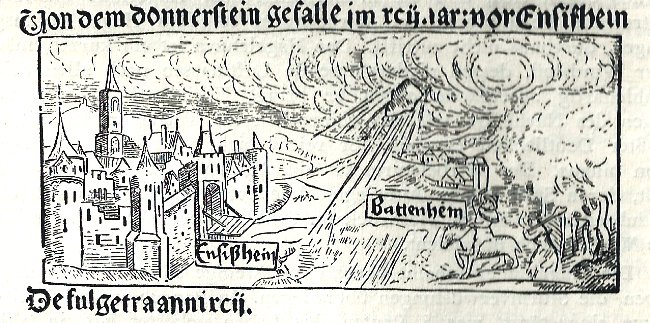
Abb.
9. Flugblatt aus dem
Jahre 1492 zu einem Gedicht von Sebastian Brant. (Aus Königs
Literaturgeschichte 1882 S. 187.) Auffallend ist die
"Schußrichtung". Man sieht den Schwarzwald mit der Burg
Staufen über Ensisheim hinweg. Der Donnerstein kam also aus
südlicher, südöstlicher oder südwestlicher
Richtung. Von der Ekliptik weicht der Meteorit somit ganz
beträchtlich ab. Entfernung Ensisheim - Battenheim 5,5 km,
Battenheim liegt südöstlich von Ensisheim. Man sieht
auch hier, daß der "Donnerstein" kalte, obere, elektrisch positiv
geladene Luft in niedere, dampfreiche, warme elektrisch negativ
geladene Luftschichten mitgerissen hat, die er nun unter Blitz und
Donner durchstößt. Bei Hagel ist es das Gleiche, nur
daß der Hagelblock zum Schauer zerfällt und dabei noch mehr
Luft mitreißt.
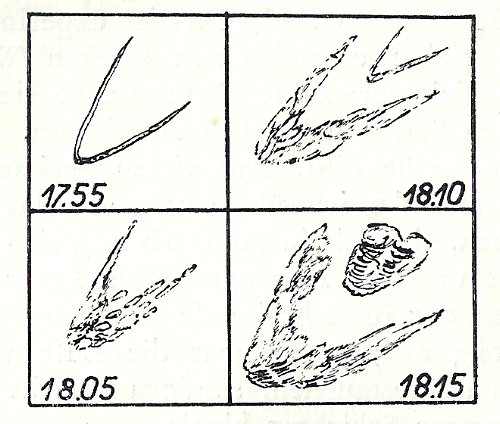
Abb.
10. Von F. T. Prosser
aufgenommene und in Nr. 800 des "Meteorological Magazine"
veröffentlichte Wolkenform. Hier ist die "Kopfwelle" ganz
ausgezeichnet erkennbar. Die Bilder von 18.10 und 18.15 zeigen
auch den Nachlauf. Typisches Bild eines Einschusses; man
könnte auch auf einen kleinen, verpuffenden Meteoriten
schließen.
Das Wolkenbild eines kleinen
Einschusses zeigt die Z. Wel vom
Februar 1933 S. 59 (Abb. 10). Ich vermute hierin eine
"Verpuffung eines kleinen, steil eingeschossenen Körpers an der
Stratosphärengrenze. Daraus ergibt sich, daß die in
Berichten über Hagelfälle manchmal auftretende Behauptung,
ein Wirbelsturm sei dem Hagel vorausgegangen, durchaus nicht
zutrifft. Der Hagelsturm ist ein kurzer, mächtiger
Windstoß, dessen niederstürzende Luftmassen nach allen
Seiten strahlenartig auseinanderfahren, er bringt Hochdruck, gefolgt
vom Regen des Nachlaufs, wie das namentlich die Tachauer Berichte mit
größter Deutlichkeit ergaben. Er reicht nicht weit
über die Hagelbahn hinaus. Der Wirbelsturm ist ein Ansaugen
rasch aufsteigender Luft, deren Strähnen im Aufstiegsschlote
heftig kreisen, um sich oben auszubreiten, er bringt Tiefdruck im
Schlote, der nach Vorüberziehen des Wirbels sich ausgleicht.
Die Hageldauer scheint überall nur wenige Minuten betragen zu haben, die Sturmverwüstungen überwiegen. In Pardubitz sind 2 Kirchtürme eingestürzt, was 5 Leuten das Leben gekostet hat, in Tabor Ausstellungspavillons weggeweht und ein Boot gekentert (7 Tote), in Aiterhofen ein Ziegelofen abgedeckt und eingestürzt.
Die Hageldauer scheint überall nur wenige Minuten betragen zu haben, die Sturmverwüstungen überwiegen. In Pardubitz sind 2 Kirchtürme eingestürzt, was 5 Leuten das Leben gekostet hat, in Tabor Ausstellungspavillons weggeweht und ein Boot gekentert (7 Tote), in Aiterhofen ein Ziegelofen abgedeckt und eingestürzt.
d)
Strich IV, zeitlich etwa 25 Minuten später,
räumlich etwas
früher als Strich III, am Bodensee beginnend, zieht sich fast
gleichlaufend mit III über Ravensburg-Waldsee in Württemberg
nach Südbayern und Südböhmen und bis bis Oderberg zu
verfolgen. Die Stuttgarter Wetterdienststelle kennzeichnet ihn
als schweren Hagelzug von 20 km Breite und 100 - 110 km
Stundengeschwindigkeit. Seine Gestaltung in Bayern habe ich nur
durch den Artikel des Landwirtschaftsrates I. Kl. Benzinger erfahren,
der auch von Hagelfällen bei Deisenhofen und Aibling berichtet und
Schloßen - und was für welche! - daraus abbildet (Abb. 11).
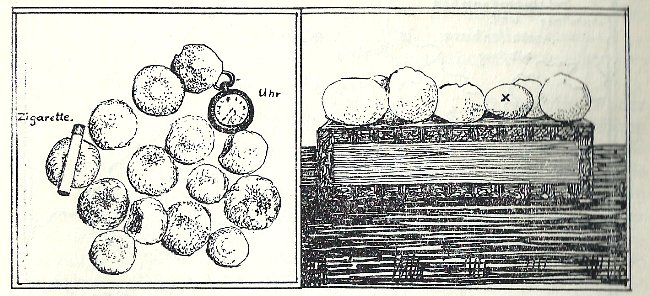
Abb. 11b. Hagel-Schloßen gefallen bei Aibling, Oberbayern, am 4. 7. 1929 um 3 Uhr, bis 250 gr schwer, X Hühnerei zum Vergleich.
Die Münchener Wetterkarte
und der zugehörige Bericht lassen
von diesem Vorgange fast gar nichts erkennen, und als auffallend wird
nur hervor- gehoben, daß im Chiemsee- und Salzachgebiet kein oder
nur geringer Niederschlag fiel.
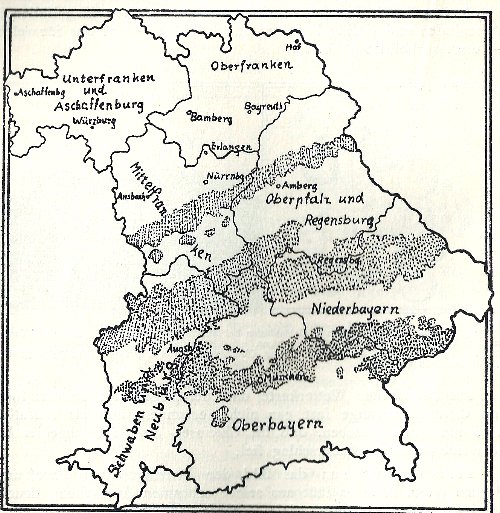
Abb.
12. Hagelfälle
vom 4. 7. 1929 in Bayern. Benetzungsfläche nach Benzinger.
Betrachten wir nun das Bild der
Benzingerschen Benetzungsflächen
(Abb. 12). Es läßt aus seiner seltsamen Auszackung
deutlich erkennen, daß diese durch viele "Tropfen" eines
erzeugenden "Strahles" entstanden sein muß, wobei nur einige
Schloßenschauer noch in fester Form bis auf den Boden gelangten, die niederstürzende Wassermasse aber
nichtsdestoweniger den Sturm erzeugte. Den gleichen
Eindruck erhält man aus Südböhmen mit der Betonung der
nicht übermäßigen Niederschläge und des gewaltigen
Sturmes, wird aber durch die faustgroßen Hagelschloßen und
die 43 m sec. Windgeschwindigkeit bei Prossnitz deutlichst auf die
eigentliche, erzeugende Ursache des ganzen Vorganges
hingestoßen. Es bleibt leider ungewiß, ob die
Hagellücken in dem hier gezeigten Bilde wirkliche Lücken
waren, oder ob nur das vorliegende Berichtsmaterial Lücken hat.
Folgerungen aus der Vorführung dieser einzelnen Hagelbilder.
a) Kosmische Geschwindigkeiten.
1.
Zunächst drängt sich die große
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Hagelfälle auf. Sie ist
eine Endgeschwindigkeit zerfallener, schon gebremster
Grobeiskörper. Berücksichtigt man, daß sie, auf
der Erdoberfläche abgegriffen, durch den cos der geographischen
Breite verringert auftritt, so ergibt sich für den letzten Teil
des absteigenden Astes eine noch größere Geschwindigkeit,
und auch diese stellt sich nur als
Überschuß der Fluggeschwindigkeit des Grobeiskörpers
über die Geschwindigkeit des vom Hagel getroffenen
Oberflächenstücks bei seiner täglichen Erdumdrehung dar.
Um ihn recht genau zu messen, müßte man die
Umlaufgeschwindigkeit eines Punktes am Äquator mit dem cos der
geographischen Breite vervielfältigen und durch den cos des
Einschußazimuts - bei Strich II vom 4.7.1929 durch 25° -
teilen und dazu noch den cos des geschätzten Einfallwinkels
einsetzen.
Jedenfalls kommt man auf höchst beträchtliche, kosmische Geschwindigkeiten der Grobeiskörper.
Jedenfalls kommt man auf höchst beträchtliche, kosmische Geschwindigkeiten der Grobeiskörper.
2.
Der Anblick der 4
Hagelstriche des 4.7.1929 verlockt ferner dazu, zu vermuten, daß
die einzelnen Striche einem einzigen, größeren Körper
ihren Ursprung verdanken könnten; auf der Karte sehen sie wie eine
Schrapnellage einer wohl eingeschossenen Flachbahnbatterie aus.
Nun hat aber ein Punkt auf dem Äquator schon 1669,583 km
stündliche Umdrehungsgeschwindigkeit (in 50° nördl.
Breite immer noch 1073,2), die Erde selbst 30 km in der Sekunde
Umlaufsgeschwindigkeit (stündlich 108 000 km) und die Sonne rund
20 km in der Sekunde Eigengeschwindigkeit
(stündlich 72 000 km). Bedenkt man dagegen, daß die
Hagelstriche zeitlich bis zu einer Stunde auseinanderliegen, so wird es
doch recht schwer zu glauben, daß man hier 4 Trümmer eines
einzigen Körpers vor sicht hat, und man zieht sich lieber auf die
Hörbigersche Darlegung zurück, daß diese
Einschüsse dem Strome der der Sonne zustrebenden, großen,
ungestörten Eiskörper entstammen, der im Juli von der sich
der Trichterwandung nähernden Erde durchfahren wird (die
Eiskörper streben in Form eines Trichters zur Sonne, siehe Abb. 1
und 2), und ihre Häufung dem Zufall zuzuschreiben ist,
während die gleichen Azimute der Einschüsse um so sicherer
den ungestörten Zustrom
verraten. Daß aber solche auffallend starken, fast genau
gleich gerichteten, zeitlich gestaffelten Hagelstriche die Folge des
Vorschreitens einer Gewitterfront eines Witterungsumschlages eines
überaus heißen Tages sein sollen, fällt schwer zu
glauben, namentlich nach den Zeitungsangaben, daß nach
Aufhören der nur 5 - 15 Minuten dauernden Hagelfälle alsbald
wieder Aufheiterung eintrat.
b)
Häufigkeit der
Fälle. Die gezeigten Beispiele sind lediglich nach
dem Aufsehen gewählt worden, das sie seiner Zeit erregten und das
sich in Zeitungsnachrichten ausdrückte. Sie bestätigen
zunächst die Hörbigersche Darlegung, daß Hagel
vorwiegend in den Nachmittagsstunden auftritt. Ich beziehe mich
auf die Kämtzsche Tabelle, Voigt "Eis - einen Weltenbaustoff"
1928 S. 22, zu der die Zeitangaben durchweg recht gut passen,
namentlich, wenn man die Zeiten des Auftretens der ersten
Hagelkörner berücksichtigt.
Ich gebe nun noch ein Bild der Sternschnuppenkurve im Vergleich zu den Schadenanmeldungen (Abb. 13). Für die Häufigkeit der Fälle besagen sie wenig. Hierfür muß ich mich auf die Voigtschen Darstellungen der Kurven der mit den Sternschnuppenfällen zusammenhängenden Stürme und besonders die Kurve der Sternschnuppenfälle selbst beziehen - auf der im Bilde vorgeführten Tabelle in punktierter Linie.
Ich gebe nun noch ein Bild der Sternschnuppenkurve im Vergleich zu den Schadenanmeldungen (Abb. 13). Für die Häufigkeit der Fälle besagen sie wenig. Hierfür muß ich mich auf die Voigtschen Darstellungen der Kurven der mit den Sternschnuppenfällen zusammenhängenden Stürme und besonders die Kurve der Sternschnuppenfälle selbst beziehen - auf der im Bilde vorgeführten Tabelle in punktierter Linie.

Abb.
13. Angaben
einer Preußischen Hagelversicherungs-Gesellschaft, im Vergleich
zu den Sternschnuppenfällen.
Ich habe versucht, einen
Vergleich dazu mit den in unseren Breiten
auftretenden Hagelfällen anzustellen und mich der Angaben der
Häufigkeit der Hagelschäden-Anmeldungen zu bedienen, die eine
hauptsächlich in Preußen wirkende Hagelversicherung zu
machen so gütig war. Tabelle und Kurve erheben keinen
Anspruch auf völlige Genauigkeit und Unabänderlichkeit.
Dazu ist schon die Jahresreihe zu kurz und das betreffende Gebiet zu
klein. Hier hätte ein Forscher wohl noch ein großes
Feld vor sich und würde aus einer langen Beobachtungsreihe sicher
die 11,8 jährige Jupiterperiode und die Brücknersche Periode
u. a. m. herausfinden können. Immerhin paßt sich die
Kurve dem Sonnenlaufe und dem Bilde des Schnittes der Erdbahn mit dem
Trichter und Gegentrichter des Eiszustromes durchaus an. Die
Schadenkurve hat im Sommer ihre höchste Erhebung; in den Zeiten
der Tag- und Nachtgleiche sinkt sie auf Null - das sind zugleich die
Zeiten der Durchfahrung der leeren oder eisarmen Innenräume der
Trichter - und müßte im Winter auf der Südhalbkugel in
ähnlicher Form erscheinen. - Hierzu ist eine Unzulänglichkeit
der Tabelle zu berücksichtigen: die Kämtzsche Tagestabelle
weist Hagelfälle auch im Herbst und Winter nach. Das tut die
Schadentabelle nicht, weil in den entsprechenden Monaten die Felder
vorwiegend leer sind und Schäden daher wohl nur ganz selten zur
Anmeldung kommen.
Dagegen gibt die Verschiebung der höchsten Erhebung der Schadenkurve sehr zu denken. In den einzelnen Jahren wechselt sie nach Häufigkeit überhaupt und größter Häufigkeit in den Monaten; die Gesamtsumme zeigt aber die höchste Erhebung im Juni. Diese Verschiebung ist nur so zu erklären, daß nicht die Häufigkeit der Hagelfälle an sich die Zahl der Schadenanmeldungen allein bedingt, sondern die größere oder geringere Ausdehnung und Grobheit der Hagelfälle.
Dagegen gibt die Verschiebung der höchsten Erhebung der Schadenkurve sehr zu denken. In den einzelnen Jahren wechselt sie nach Häufigkeit überhaupt und größter Häufigkeit in den Monaten; die Gesamtsumme zeigt aber die höchste Erhebung im Juni. Diese Verschiebung ist nur so zu erklären, daß nicht die Häufigkeit der Hagelfälle an sich die Zahl der Schadenanmeldungen allein bedingt, sondern die größere oder geringere Ausdehnung und Grobheit der Hagelfälle.
Es wird sehr selten sein,
daß ein verhältnismäßig
kleiner Körper, wie der Primkenauer vom 27.5.1930 so steil
einschießt, daß er seine noch haselnußgroßen
Schloßen bis auf den festen Erdboden durchbringen kann.
Gerade kleinere, der Regel nach tangential einschießende
Eiskörper müssen schon in hohen, dünnen Luftschichten so
starken Widerstand erfahren, daß ihre in innere Erwärmung
umgesetzte Energie sie sehr früh zur Auflösung bringen
muß. Die Mehrzahl der Eiseinschüsse wird rasch in
Teile zerspalten, deren Trümmer fortschreitend immer weiter
zerfallen und von Erreichung der Stratosphäre an bei dem immer
wachsenden Widerstande der nach unten an Dichtigkeit zunehmenden Luft
sich immer mehr zerkleinern und in den wärmeren Luftschichten auch
von außen her abgeschmolzen werden. Dafür spricht die
größere Häufigkeit der Hagelfälle in
Gebirgsgegenden. Was in
größeren Höhen den festen Erdboden noch als Hagelkorn
erreicht, kommt im Tieflande schon als Regen an, bestenfalls als
Graupelkorn.
So können wir also Gott danken, daß nur die mächtigsten Grobeiskörper die Wucht in sich tragen, den schützenden Luftmantel so zu durchbrechen, daß sie ihre Trümmer noch als große Hagelkörner bis auf den festen Erdboden durchbringen. Das sind die ganz starken Juni- und die etwas schwächeren, ungestörten Juli-Grobeiskörper, wie auch die Schadentabelle zeigt.
So können wir also Gott danken, daß nur die mächtigsten Grobeiskörper die Wucht in sich tragen, den schützenden Luftmantel so zu durchbrechen, daß sie ihre Trümmer noch als große Hagelkörner bis auf den festen Erdboden durchbringen. Das sind die ganz starken Juni- und die etwas schwächeren, ungestörten Juli-Grobeiskörper, wie auch die Schadentabelle zeigt.
Hörbiger spricht ihnen
schon in seinen Ausführungen den
kleineren gegenüber den Vorteil auch für den
außerirdischen Ätherraum zu; das gleiche Gesetz gilt erst
recht für den irdischen Luftmantel, das ballistische Beispiel soll
es beweisen: Das S-Geschoß, 11 gr, mit rund 1000 m
Mündungsgeschwindigkeit verschossen, erreicht eine
Gesamtschußweite von 4000 m. Das Geschoß 88, 16 gr,
mit rund 700 m Mündungsgeschwindigkeit, reicht ebensoweit.
Die Feldgranate, mit ähnlicher Geschwindigkeit wie Geschoß
88, fliegt schon bis 7500 m, die schweren Marinegeschosse 20-30 km und
mehr, bis gegen 50 km.
Wir sehen, daß der mächtigere Körper in der Luft weit längere Wege zurücklegen kann, ehe er seine Energie in innere Wärme umsetzen muß, als der kleinere. Die mächtigsten aber treffen, wie das Hörbigersche Trichterbild ergibt, die Erde im Juni und Juli, und das zeigen uns schon diese kurze, auf Vollständigkeit noch wenig Anspruch machende Hagelschadentabelle und Kurve ganz deutlich an.
Ich greife noch einmal auf ballistische Erfahrungen zurück. Der "Lange Wilhelm", ein 21 cm Langrohr von 200 Kalibern Länge, der mit mächtiger Ladung als Steilfeuergeschütz seine Granaten mit 1500 m Mündungsgeschwindigkeit 125 km weit trieb - φ = 57° 30' - durchschoß die dichten, stark bremsenden Luftschichten steil, auf möglichst kürzester Linie, damit die Granate eine schöne, fast parabolische Bahn in den dünnen Luftschichten - Scheitel bei + 50 km - durchfahren konnte. Fiel sie vom Scheitel ab, so machte das für den absteigenden Ast in der Höhe zunächst so gut wie gar nichts aus, und die Stratosphäre konnte an dem schweren, spitzen, achsenbeständigen, festen Geschoß keine merkliche, für seinen Bestand oder für die Sprengladung durch innere Erwärmung gefährliche Änderung bewirken.
In ähnlicher Weise kommt ein leichter Grobeiskörper in oberen Luftschichten schon früher zur Zerteilung als ein großer. Ein großer hat aber noch den Vorteil, daß zum mindesten seine oberen Teilstücke in hohen, dünnen Schichten längere Wege zurücklegen können und auch dann noch langsamer in mehr Stücke zerfallen, so daß deren Weg im Ende des absteigenden Astes sich noch vermindert.
Aber der Fall durch das letzte Ende, die dichteren Luftschichten, den die Eistrümmer bei immer zunehmender Bremsung mit immer wachsender Widerstandsfläche bei immer stärker wirkender Außenwärme zurücklegen müssen, wirkt im Gegensatz zu dem metallenen Geschoß auf das Eis so auflösend und zersprengend, daß eben nur die mächtigsten Körper, die ihre Trümmer oben schon von vornherein "möglichst weit gebracht haben", ihre Schloßen bis auf den Boden der Tiefebene hindurchbringen. Sie erzeugen daher auch die längsten schwerstgetroffenen Einschlagsflächen und reißen auch am meisten kalte, obere Luft mit in die unteren, wärmeren Schichten, so daß sie außer dem mechanischen Sturmstoß und der eigenen Wassermasse auch noch durch Kondensation und elektrische Aufladung Wolkenbrüche und Gewitter mit sich reißen.
Wir sehen, daß der mächtigere Körper in der Luft weit längere Wege zurücklegen kann, ehe er seine Energie in innere Wärme umsetzen muß, als der kleinere. Die mächtigsten aber treffen, wie das Hörbigersche Trichterbild ergibt, die Erde im Juni und Juli, und das zeigen uns schon diese kurze, auf Vollständigkeit noch wenig Anspruch machende Hagelschadentabelle und Kurve ganz deutlich an.
Ich greife noch einmal auf ballistische Erfahrungen zurück. Der "Lange Wilhelm", ein 21 cm Langrohr von 200 Kalibern Länge, der mit mächtiger Ladung als Steilfeuergeschütz seine Granaten mit 1500 m Mündungsgeschwindigkeit 125 km weit trieb - φ = 57° 30' - durchschoß die dichten, stark bremsenden Luftschichten steil, auf möglichst kürzester Linie, damit die Granate eine schöne, fast parabolische Bahn in den dünnen Luftschichten - Scheitel bei + 50 km - durchfahren konnte. Fiel sie vom Scheitel ab, so machte das für den absteigenden Ast in der Höhe zunächst so gut wie gar nichts aus, und die Stratosphäre konnte an dem schweren, spitzen, achsenbeständigen, festen Geschoß keine merkliche, für seinen Bestand oder für die Sprengladung durch innere Erwärmung gefährliche Änderung bewirken.
In ähnlicher Weise kommt ein leichter Grobeiskörper in oberen Luftschichten schon früher zur Zerteilung als ein großer. Ein großer hat aber noch den Vorteil, daß zum mindesten seine oberen Teilstücke in hohen, dünnen Schichten längere Wege zurücklegen können und auch dann noch langsamer in mehr Stücke zerfallen, so daß deren Weg im Ende des absteigenden Astes sich noch vermindert.
Aber der Fall durch das letzte Ende, die dichteren Luftschichten, den die Eistrümmer bei immer zunehmender Bremsung mit immer wachsender Widerstandsfläche bei immer stärker wirkender Außenwärme zurücklegen müssen, wirkt im Gegensatz zu dem metallenen Geschoß auf das Eis so auflösend und zersprengend, daß eben nur die mächtigsten Körper, die ihre Trümmer oben schon von vornherein "möglichst weit gebracht haben", ihre Schloßen bis auf den Boden der Tiefebene hindurchbringen. Sie erzeugen daher auch die längsten schwerstgetroffenen Einschlagsflächen und reißen auch am meisten kalte, obere Luft mit in die unteren, wärmeren Schichten, so daß sie außer dem mechanischen Sturmstoß und der eigenen Wassermasse auch noch durch Kondensation und elektrische Aufladung Wolkenbrüche und Gewitter mit sich reißen.
Tropenregen
müssen auf solche Weise ganz natürlich entstehen,
und diese und die zugehörigen Tropengewitter sind mir aus eigener
Anschauung bekannt. Eigene Kenntnis von tropischen
Hagelfällen habe ich nicht, bekannt geworden sind mir nur
Hörbigersche und Voigtsche Angaben über Hagel in Indien und
Angaben von Bekannten über Hagelfälle in der Pampas, bei
Porto Alegre und kürzlich bei Bogota in Kolumbien. Trifft es
zu, daß sie in den Tropen weniger häufig sind als bei uns -
was ich aber nicht sicher weiß -, so kann ich mir die Erscheinung
nur dadurch erklären, daß der Luftmantel der Erde die
Sphäroidgestalt noch stärker zeigt als der fest
Erdkörper. Die Eiskörper haben also über den
Tropen einen längeren Weg im Luftmantel zurückzulegen als in
unseren Breiten, so daß nur die allermächtigsten
Schloßen bis unten hindurchdringen können. Um so
länger ziehen sich die Teil- und Trümmerstücke in den
oberen, dünnsten Luftschichten auseinander, und der Fall der
aufgelösten Splitter in Regenform zieht die Erscheinung auch noch
zeitlich sehr auseinander. Das Mitreißen kalter Luft, die
Kondensation und elektrische Aufladung bleiben auch so noch bestehen
und erzeugen verstärkte Regengüsse und Gewitter. Auch
diese Erscheinung gleicht insofern der bei uns bekannten, als sie
endet, sobald die Ursache, der eigentliche Hagelfall,
aufhört. Auch in den Tropen strahlt nach dem täglichen
Nachmittagsgewitter die Sonne von einem rasch wieder wolkenlos
werdenden Himmel.
c) Wenn
Hagelfälle wirklich einem
Wettersturz und dessen Gewitterfront ihre Entstehung verdankten, so
müßte das an und nach einem Tage wie dem 4. Juli 1929
ersichtlich werden.
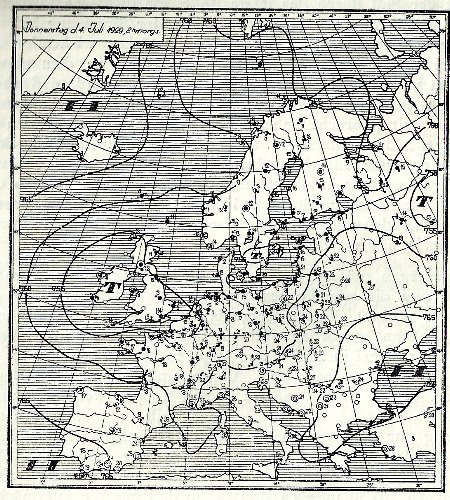
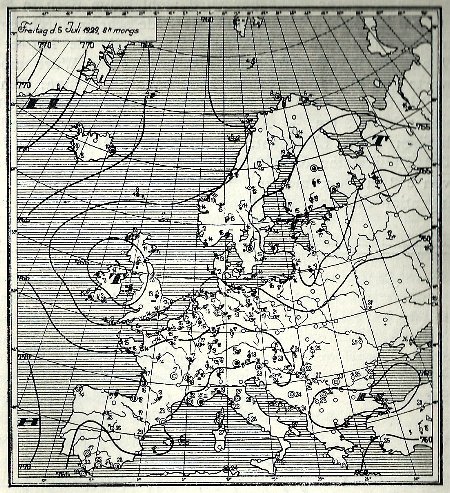
Abb.
14a und 14b.
Ich zeige
daher die Wetterkarte des 4. 7. 1929 (Abb. 14 a, b).
Die Wetterkarte vom 5. Juli 1929 zeigt fast das gleiche Bild wie tags
vorher! Das Tief vom 4. 7. über den britischen Inseln ist
geblieben, der Ausläufer des Azorenhochs über Spanien
auch. Die Rinne niederen Drucks, die am 4. 7. über
Frankreich lief, ist am 5. 7. ausgefüllt, und über
Südfrankreich und die oberen Donauländer erstreckt sich nun
eine Zunge von ganzen 5 Millimetern höherem Druck mit ganz
uneinheitlich gerichteten, ebenso schwachen Winden wie am
Vortage. Diese Zunge höheren Druckes ist dadurch entstanden,
daß die geschilderten Hageleinschüsse wie ein
Wasserstrahlgebläse Luft mit sich hinabgerissen und so in der von
ihnen betroffenen Gegend höheren Druck erzeugt haben.
Somit folgere ich als Physiker und Ballistiker: nicht Wettersturz und Gewitter erzeugen den Hagel, sondern der Grobeiseinschuß zerfällt durch Bremsung und innere Erwärmung auf dem langen Luftwege in Hagel und der Hagel, Luft mit niederreißend, erzeugt Sturm, Regen und Gewitter, die aufhören, sobald der Hagel die feste Erde erreicht hat.
Somit folgere ich als Physiker und Ballistiker: nicht Wettersturz und Gewitter erzeugen den Hagel, sondern der Grobeiseinschuß zerfällt durch Bremsung und innere Erwärmung auf dem langen Luftwege in Hagel und der Hagel, Luft mit niederreißend, erzeugt Sturm, Regen und Gewitter, die aufhören, sobald der Hagel die feste Erde erreicht hat.
Errechnet
habe ich folgende Angaben:
Zum Schmelzen von 1 kg weltraumkalten Eises sind 273 + 79 = 352 Kalorien nötig. Diesen entsprechen 33789,6 Meterkilogramm. Die Energie des 1 kg schweren Eiskörpers sei P. v² ÷ 2. g = 33789,6 mkg. Dazu gehört v = 813 m. sec.
Das ist noch keine kosmische Geschwindigkeit. Wir bedürfen ja auch nur des Geschwindigkeitsunterschiedes. Ein 1 kg schwerer Eiskörper wird wohl kaum noch in Schloßenform den 300 km hohen Luftmantel der Erde schräg durchdringen. -
Nehmen wir einen großen Eiskörper vor, z. B. die Masse des am 4. 7. 1929 auf Strich IV gefallenen Eiskörpers. Die Württembergische Wetterwarte gibt 20 km Breite der Hagelbahn an. Länge: vom Bodensee bis Oderberg, rund 700 km, Niederschlagsfläche: 14 000 qkm, Niederschlagshöhe 3 cm. - Ab für Zusatzmenge durch Kondensation 1 cm, bleiben 2 cm Eisschicht. Das sind 280 000 000 000 kg oder 280 000 000 Kubikmeter oder 0,280 Kubikkilometer, sie ergeben eine Kugel von 812 m Durchmesser.
Tangential eingeschossen, kann sie einen sehr viel längeren Weg als ein Stück von 1 Liter Inhalt zurücklegen - denken wir daran, daß sie bei 300 km Höhe in allerdünnste Luft einschießt. (Der lange Wilhelm kam nur bis 50 km hoch). Nehmen wir zu diesem Fluge das Zehnfache der erzeugten Streuungslänge des Einschlages Bodensee - Oderberg, also 7000 km, so läge der Einschußpunkt, auf dem Globus abgegriffen, über Manaos am Amazonenstrom, nahe dem Zusammenfluß mit dem Rio Negro und dem Madeira (Abb. 15).
Zum Schmelzen von 1 kg weltraumkalten Eises sind 273 + 79 = 352 Kalorien nötig. Diesen entsprechen 33789,6 Meterkilogramm. Die Energie des 1 kg schweren Eiskörpers sei P. v² ÷ 2. g = 33789,6 mkg. Dazu gehört v = 813 m. sec.
Das ist noch keine kosmische Geschwindigkeit. Wir bedürfen ja auch nur des Geschwindigkeitsunterschiedes. Ein 1 kg schwerer Eiskörper wird wohl kaum noch in Schloßenform den 300 km hohen Luftmantel der Erde schräg durchdringen. -
Nehmen wir einen großen Eiskörper vor, z. B. die Masse des am 4. 7. 1929 auf Strich IV gefallenen Eiskörpers. Die Württembergische Wetterwarte gibt 20 km Breite der Hagelbahn an. Länge: vom Bodensee bis Oderberg, rund 700 km, Niederschlagsfläche: 14 000 qkm, Niederschlagshöhe 3 cm. - Ab für Zusatzmenge durch Kondensation 1 cm, bleiben 2 cm Eisschicht. Das sind 280 000 000 000 kg oder 280 000 000 Kubikmeter oder 0,280 Kubikkilometer, sie ergeben eine Kugel von 812 m Durchmesser.
Tangential eingeschossen, kann sie einen sehr viel längeren Weg als ein Stück von 1 Liter Inhalt zurücklegen - denken wir daran, daß sie bei 300 km Höhe in allerdünnste Luft einschießt. (Der lange Wilhelm kam nur bis 50 km hoch). Nehmen wir zu diesem Fluge das Zehnfache der erzeugten Streuungslänge des Einschlages Bodensee - Oderberg, also 7000 km, so läge der Einschußpunkt, auf dem Globus abgegriffen, über Manaos am Amazonenstrom, nahe dem Zusammenfluß mit dem Rio Negro und dem Madeira (Abb. 15).
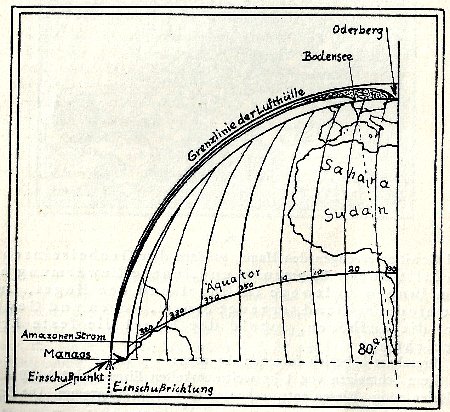
Abb.
15. Darstellung des
Zerfalls eines großen, tangential einschießenden
Grobeiskörpers in der irdischen Lufthülle.
Lufthülle und Erddurchmesser ungefähr maßstabsgerecht
zu einander. Großkörper IV vom 4. 7. 1929 hat
schätzungsweise einen Erdquadranten im Luftmantel durchlaufen und
dabei seine Energie durch Überwindung des Luftwiderstandes so weit
aufgezehrt, daß er in Stücke von Faustgröße und
kleiner zerfallen oder schon ganz zerschmolzen ist. Dafür
hat er eine große Luftmenge in höchst stürmische
Bewegung gesetzt und Kondensation sowie Gewitter erzeugt, auch
Induktionswirkungen in Kraft-, Licht-, Fern- und Funkapparatur
hervorgerufen.
Den 80°
langen Bogen des größten Kreises könnte der
Körper, wenn man ihm die relative Geschwindigkeit von 813 m
zubilligt, in 144 Minuten = 2 Stunden 24 Minuten zurückgelegt
haben - rechnen wir den eintretenden Geschwindigkeitsverlust roh
hierzu, in rund 3 Stunden. Dann ist er zur Mittagsstunde
eingeschossen, vielleicht hat er schon den Morgenwallkamm
angekratzt. Daß der Geschwindigkeitsverlust erst ganz am
Ende der Flugbahn hoch anwächst, erkennt man u. a. daran,
daß am Bodensee und in Württemberg noch
zusammenhängender, schwerer Hagel gefallen ist. In Bayern
und Böhmen haben, mit Ausnahme von Aibling - Deisenhofen, der
Krummau - Gemünder Gegend und Proßnitz, Regen und Sturm
vorgeherrscht. Dort sind also die Stücke der oberen
Sprengteile schon nach Geschwindigkeitsverlust in Regen zerschmolzen
und haben die Geschwindigkeit an die Luft übertragen, die, mit dem
Regen jäh niederrauschend, die Sturmschäden hervorgerufen
hat, nebenher die elektrischen Erscheinungen erzeugend.
Betrachten
wir nochmals Abb. 15, dann hat die Breitenstreuung von 20 km
schon gar nichts Auffallendes; erklärlich sind auch die
anscheinenden Lücken zwischen Haupteinschlägen, und die ganze
Flugstrecke ist wohl lang genug, um die Einschußgeschwindigkeit
so weit aufzuzehren, wie sie sich noch als
Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Einschlages auf dem Erdboden ergibt.
Greifen wir die Stelle der größten beobachteten Windgeschwindigkeit, bei Prossnitz 153 Stundenkilometer, heraus = 2,5 km minütlich = 43 m in der Sekunde, dann sind von 813 m Einschußgeschwindigkeit schätzungsweise 770 m schon verloren, dafür hat das Eis an inneren Kalorien reichlich gewonnen, und die bis Hühner- oder Taubeneigröße zerkleinerten Hagelstücke haben schon die Mehrzahl der zum Schmelzen erforderlichen 79 Kalorien in sich.
Greifen wir die Stelle der größten beobachteten Windgeschwindigkeit, bei Prossnitz 153 Stundenkilometer, heraus = 2,5 km minütlich = 43 m in der Sekunde, dann sind von 813 m Einschußgeschwindigkeit schätzungsweise 770 m schon verloren, dafür hat das Eis an inneren Kalorien reichlich gewonnen, und die bis Hühner- oder Taubeneigröße zerkleinerten Hagelstücke haben schon die Mehrzahl der zum Schmelzen erforderlichen 79 Kalorien in sich.
Was ist
Erstaunliches an der der Luft mitgeteilten Geschwindigkeit,
deren absteigende, kondensierend und elektrisch aufladende Richtung
Wolkenbruch und Gewitter als Nebenerscheinung erzeugt?
Eine Wirkung, wie früher beschrieben, sollte von nur 5 mm Druckanstieg ausgegangen sein?
Die Schlußfolgerung bleibt: nicht vordringende Kaltluftmassen haben Sturm und Hagel erzeugt, sondern Grobeiseinschüsse sind in Hagel zerfallen, und dieser hat Kaltluftmassen mit sich niedergerissen, Sturm und Gewitter erzeugt.
Eine Wirkung, wie früher beschrieben, sollte von nur 5 mm Druckanstieg ausgegangen sein?
Die Schlußfolgerung bleibt: nicht vordringende Kaltluftmassen haben Sturm und Hagel erzeugt, sondern Grobeiseinschüsse sind in Hagel zerfallen, und dieser hat Kaltluftmassen mit sich niedergerissen, Sturm und Gewitter erzeugt.
Generalmajor a. D. Haenichen
(Quelle: Monatszeitschrift "Zeitschrift für Welteislehre", Heft 6, S.161-186, Jahrg. 1933, Verlag Luken & Luken-Berlin)
****************************************
Die Auswirkungen eines Grobeiseinschusses auf der Erde
Die Wirkungen eines
Eiskörpereinschusses in die Atmosphäre
der Erde
sind recht mannigfacher Art. Allen derartigen Angliederungen
gemeinsam
ist die starke Aufwirbelung der durchflogenen Luftmasse. Die
Länge des
Weges, den eine eingefangene Sternschnuppe (Grobeisbolide) in der
Atmosphäre zurücklegt, ist dabei oft sehr groß.
Denn die weitaus
meisten derartigen Körper fallen ja nicht senkrecht ein, sondern
seitlich. Am häufigsten werden die von der Erde aus ihrer
Bahn
gelenkten Eislinge an ihr vorbeifliegen und zu einer weitausholenden
Ellipse gezwungen werden. Die Erde ist doch im Weltraum ein so
winziger Punkt, daß nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Zahl
der
direkten Treffer ganz verschwindend gering ist.
Daher kommen die eingefangenen Eiskörper fast stets ziemlich parallel der Erdoberfläche angebraust, so daß ihre Wirkung auf weite Strecken fühlbar ist. Diese Wirkung besteht nun zunächst mal darin, daß die entgegenstehende Luft vorhergeschoben wird. Hauptsächlich in den tieferen Luftschichten, die größere Dichte besitzen, entsteht selbstverständlich nicht unerhebliche Reibung und damit Erwärmung. Diese beträgt natürlich nicht mehrere hundert Grad, wie sie für die Rotglut nötig sind, sondern für den weltraumkalten Eisling genügt zunächst eine geringe Erwärmung seiner äußeren Schichten. Das erzeugt Spannungen, die den Eiskörper schalenweise zur Auflösung bringen. Die Zerkörnerung geht während des ganzen Weges weiter. Dabei wird die Oberfläche ungeheuer vervielfacht, was wiederum die Folge hat, daß die vorweg geschobenene Luftmasse immer größer wird.
In den oberen Wasserstoffschichten der Erdatmosphäre dürfte das Muttereis wohl erst nur leichten Eisdampf abstreifen, wie man ihn bei manchen geschweiften Sternschnuppen beobachten kann. Der eigentliche Zerfall der Muttereiskugel beginnt wahrscheinlich erst beim Erreichen der tieferen und dichteren Luftschichten unter 100 oder 80 km Höhe. Im Augenblick des Zerberstens dürfte also noch der größte Teil der ursprünglichen kosmischen Geschwindigkeit vorhanden sein, um den Orkan einzuleiten.
Daher kommen die eingefangenen Eiskörper fast stets ziemlich parallel der Erdoberfläche angebraust, so daß ihre Wirkung auf weite Strecken fühlbar ist. Diese Wirkung besteht nun zunächst mal darin, daß die entgegenstehende Luft vorhergeschoben wird. Hauptsächlich in den tieferen Luftschichten, die größere Dichte besitzen, entsteht selbstverständlich nicht unerhebliche Reibung und damit Erwärmung. Diese beträgt natürlich nicht mehrere hundert Grad, wie sie für die Rotglut nötig sind, sondern für den weltraumkalten Eisling genügt zunächst eine geringe Erwärmung seiner äußeren Schichten. Das erzeugt Spannungen, die den Eiskörper schalenweise zur Auflösung bringen. Die Zerkörnerung geht während des ganzen Weges weiter. Dabei wird die Oberfläche ungeheuer vervielfacht, was wiederum die Folge hat, daß die vorweg geschobenene Luftmasse immer größer wird.
In den oberen Wasserstoffschichten der Erdatmosphäre dürfte das Muttereis wohl erst nur leichten Eisdampf abstreifen, wie man ihn bei manchen geschweiften Sternschnuppen beobachten kann. Der eigentliche Zerfall der Muttereiskugel beginnt wahrscheinlich erst beim Erreichen der tieferen und dichteren Luftschichten unter 100 oder 80 km Höhe. Im Augenblick des Zerberstens dürfte also noch der größte Teil der ursprünglichen kosmischen Geschwindigkeit vorhanden sein, um den Orkan einzuleiten.
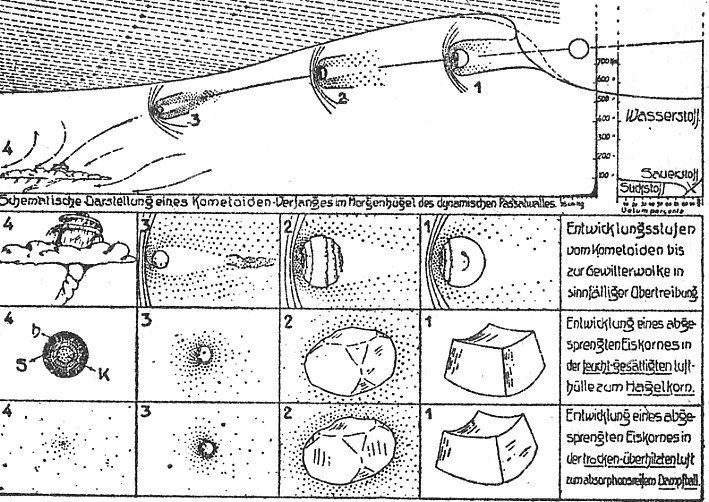
(Bildquelle- und text
aus dem Buch "Der Rhythmus des kosmischen Lebens" von Hanns Fischer,
1925)
Formelhafte Darstellung des Einschusses eines kosmischen Eislings in die Gashülle der Erde.
Formelhafte Darstellung des Einschusses eines kosmischen Eislings in die Gashülle der Erde.
Dieses Zerbersten des
spröden, weltraumkalten Muttereises ist
wegen der Schalleitungsfähigkeit der dichteren Luftschichten wohl
auch hörbar. Kämtz vergleicht das Geräusch, das
man vor dem Fall von großen Hagelkörnern hört, mit dem,
das man durch das Schütteln eines großen Bundes von
Schlüsseln hervorbringt: Man hört einfach das rauschende
Knattern der sich vom Muttereiskörper ringsum losschälenden
und zu Körnern zerberstenden Eiskugelschichten, vielleicht auch
vermischt mit dem Geknister überspringender elektrischer
Funken. Letztere können in der dichten Hagelwolke unsichtbar
bleiben und erst in ihrer energetischen Anhäufung als Blitz und
Donner in die Erscheinung treten.
Maxwell Hall sagt von Jamaika: "Obgleich der Hagel selten den Erdboden erreicht (weil er in der warmen Luft vorher schmilzt, der Verfasser), hört man ihn doch in der Luft. Das Geräusch ist ähnlich dem eines Eisenbahnzuges in einer Entfernung von etwa 1½ km."
Maxwell Hall sagt von Jamaika: "Obgleich der Hagel selten den Erdboden erreicht (weil er in der warmen Luft vorher schmilzt, der Verfasser), hört man ihn doch in der Luft. Das Geräusch ist ähnlich dem eines Eisenbahnzuges in einer Entfernung von etwa 1½ km."
Wie stark die Zerkleinerung der
Eismasse wird, hängt von ihrer
Größe ab, sowie von der Länge ihres Weges in der
Atmosphäre und nicht zuletzt von der Temperatur und Feuchtigkeit
der durcheilten Luftmassen. Die Erscheinungsformen solcher
Einschüsse sind also mannigfach, vom Großhagelwetter mit
größten Schloßen und elektrischen Entladungen nebst
Wirbelwinden bis zum kleinen Windstoß.
Sehr trockene und warme Luft kann außerordentlich viel Wasserdampf aufnehmen. So kommt es, daß an heißen Sommertagen die bekannten Schönwetterwolken, Cumuli genannt, gar nicht recht zur Ausbildung kommen wollen. Denn auch sie entstehen aus Eiseinschüssen in die Atmosphäre. Ihre massige Form zeigt deutlich die mit Gewalt emporgedrängte Luftmasse, wozu der aufsteigende Luftstrom gar nicht in der Lage ist.
Viel deutlicher als bei diesen harmlosen Schönwetterwolken sieht man bei Hagel- und Gewitterwolken die unbändige Gewalt des dahersausenden Eiskörpers. Die schnurgerade Bahn dieser Gebilde ist der beste Beweis für die außerirdische Herkunft des Menschen und Tiere vernichtenden Unwetters.
Sehr trockene und warme Luft kann außerordentlich viel Wasserdampf aufnehmen. So kommt es, daß an heißen Sommertagen die bekannten Schönwetterwolken, Cumuli genannt, gar nicht recht zur Ausbildung kommen wollen. Denn auch sie entstehen aus Eiseinschüssen in die Atmosphäre. Ihre massige Form zeigt deutlich die mit Gewalt emporgedrängte Luftmasse, wozu der aufsteigende Luftstrom gar nicht in der Lage ist.
Viel deutlicher als bei diesen harmlosen Schönwetterwolken sieht man bei Hagel- und Gewitterwolken die unbändige Gewalt des dahersausenden Eiskörpers. Die schnurgerade Bahn dieser Gebilde ist der beste Beweis für die außerirdische Herkunft des Menschen und Tiere vernichtenden Unwetters.
Die ungeheure Reibung der
Eismassen erzeugt nun nicht nur Wärme,
sondern auch Elektrizität, wie schon angedeutet wurde. Hier
ist also eine verblüffend einfache Quelle der
Gewitterelektrizität. Die Ladung der Eis- bzw.
Wasserteilchen ist dabei positiv. Nach allgemeiner Erfahrung
lädt sich bei Reibung, oder besser gesagt Berührung, die
Masse mit der höheren Dielektrizitätskonstante positiv
(Cöhnsches Ladungsgesetz). Da Wasser die
Dielektrizitätskonstante 80 verglichen mit Luft gleich 1 besitzt,
muß es sich bei derartigen Berührungen stets positiv
aufladen. Diese Ladungsart hat man ja auch als Ladung der
Niederschläge gefunden. Gleich hier sei aber gesagt,
daß auch noch eine zweite Quelle für die Niederschlags- bzw.
Gewitter- elektrizität besteht, nämlich das kosmische Feines
(s. hierzu die Aufsätze: "Wirkungen des Feineises auf die Erde"
u. "Über
Luftelektrizität").
Da die Oberfläche der Erde, aus noch zu erklärender Ursache negativ geladen ist, können sich bei dem schönen Isolationsmittel Luft ungeheure Spannungen zwischen Wolke und Erde entwickeln, die sich schließlich in ungeheuren Funken, den Blitzen, ausgleichen.
Da die Oberfläche der Erde, aus noch zu erklärender Ursache negativ geladen ist, können sich bei dem schönen Isolationsmittel Luft ungeheure Spannungen zwischen Wolke und Erde entwickeln, die sich schließlich in ungeheuren Funken, den Blitzen, ausgleichen.
Verheerender noch als
Hagelsturz und Wolkenbruch sind oft genug die mit
solchen Wettern einhergehenden Wirbelwinde. Hinter dem in eine
Wolke kleiner Stücke aufgelösten Eisling muß ein Raum
mit Unterdruck entstehen, in den die Luft mit großer
Geschwindigkeit einströmt. Dabei entstehen natürlich
Wirbel, wie man sie sehr schön an den Auspuffgasen eines fahrenden
Autos sehen kann. Solche Gebilde können lange
selbständig weiterleben, auch wenn die erzeugende
Eiskörnerwolke längst verzehrt, in Wasserdampf aufgelöst
ist.
Dann sieht man in der gefährlich daherjagenden schwarzen Wolke oft genug eine Wirbelbewegung. Aus dieser entsteht der sich langsam zur Erde herabsenkende gefürchtete Schlauch der Windhose. Wo, wie in Nordamerika hauptsächlich, große Temperaturgegensätze vorhanden sind, fördern diese die Wirbelbewegung ganz außerordentlich. Daher werden uns aus diesen Gegenden so besonders viele Wirbelsturmkatastrophen, Tornados, gemeldet.
Die ungeheuren Gewalten, die bei einem Orkan zutage treten, sind das beste Zeugnis für seine außerirdische Ursache. Denn nie und nimmer können Temperaturgegensätze derartiges leisten, abgesehen davon, daß sich solche Gegensätze nur unter ganz bestimmten, selten erfüllten Bedingungen halten oder gar steigern können. So will man auch die allbekannten Tiefdruckgebiete den Temperaturgegensätzen zuschreiben. Wohl sind in den Gebieten niedrigen Luftdruckes stets Grenzflächen warmer und kalter Luftmassen zu finden. Sie spielen auch in der Entwicklung des Wetters eine große Rolle. Aber man übersieht vollkommen die Tatsache, daß ja zuerst der tiefe Druck entsteht und erst später infolge der dadurch bedingten Strömungen Luftmassen verschiedener Temperaturen zueinander geführt werden.
Dann sieht man in der gefährlich daherjagenden schwarzen Wolke oft genug eine Wirbelbewegung. Aus dieser entsteht der sich langsam zur Erde herabsenkende gefürchtete Schlauch der Windhose. Wo, wie in Nordamerika hauptsächlich, große Temperaturgegensätze vorhanden sind, fördern diese die Wirbelbewegung ganz außerordentlich. Daher werden uns aus diesen Gegenden so besonders viele Wirbelsturmkatastrophen, Tornados, gemeldet.
Die ungeheuren Gewalten, die bei einem Orkan zutage treten, sind das beste Zeugnis für seine außerirdische Ursache. Denn nie und nimmer können Temperaturgegensätze derartiges leisten, abgesehen davon, daß sich solche Gegensätze nur unter ganz bestimmten, selten erfüllten Bedingungen halten oder gar steigern können. So will man auch die allbekannten Tiefdruckgebiete den Temperaturgegensätzen zuschreiben. Wohl sind in den Gebieten niedrigen Luftdruckes stets Grenzflächen warmer und kalter Luftmassen zu finden. Sie spielen auch in der Entwicklung des Wetters eine große Rolle. Aber man übersieht vollkommen die Tatsache, daß ja zuerst der tiefe Druck entsteht und erst später infolge der dadurch bedingten Strömungen Luftmassen verschiedener Temperaturen zueinander geführt werden.
Aus dem Zersplittern eines
Eiskörpers beim Eindringen in die
Atmosphäre als Ursache des Hagels erklären sich auch dessen
zuweilen beobachtete weltraumkalte Temperaturen und plattige
Formen. Gerade diese außergewöhnlichen Erscheinungen,
deren Erklärung durch den aufsteigenden Luftstrom unmöglich
ist, weisen auf die wahre Quelle des Hagels hin. Die
konzentrischen Schalen um den "schneeigen" Kern können
natürlich durch erneuten Ansatz auf dem Wege durch die Wolke
angefügt sein. Aber das Graupelkorn ist nicht Anfang der
Entwicklung zum Hagelstein, sondern schon fast das Endstadium der
Auflösung.
Überzeugend für die außerirdische Herkunft des meisten Hagels sind auch noch die großen, mehrere Pfund schweren Hagelsteine, die Dächer durchschlagen. Am häufigsten sind solche Fälle merkwürdigerweise in den Tropen. Dort kommen auch die kältesten Eisstücke herab. Die Ursache wird bei der Behandlung der Häufigkeitsschwankungen der Hagelfälle noch offenbar werden (s. hierzu die Schrift: "Die kosmischen Ursachen des Wetters", Kapitel 4 - "Die Änderungen des Grobeiszuflusses zur Erde" von Dr. phil. Karl Waitz, Jahrg. 1930, R. Voigtländers Verlag-Leipzig).
Überzeugend für die außerirdische Herkunft des meisten Hagels sind auch noch die großen, mehrere Pfund schweren Hagelsteine, die Dächer durchschlagen. Am häufigsten sind solche Fälle merkwürdigerweise in den Tropen. Dort kommen auch die kältesten Eisstücke herab. Die Ursache wird bei der Behandlung der Häufigkeitsschwankungen der Hagelfälle noch offenbar werden (s. hierzu die Schrift: "Die kosmischen Ursachen des Wetters", Kapitel 4 - "Die Änderungen des Grobeiszuflusses zur Erde" von Dr. phil. Karl Waitz, Jahrg. 1930, R. Voigtländers Verlag-Leipzig).
Die rasend schnelle Entstehung
und Abwicklung eines Hagelwetters wird
in einer Kölner Zeitung sehr anschaulich folgendermaßen
geschildert:
"Die Sonne strahlt mit aller Kraft hernieder und verspricht einen heißen Tag. Zwar das kleine Wetterhäuschen, das seitwärts an der Sternwarte hängt, kündet Gewitter an, aber warum sollen sich nicht auch mal Barometer und Feuchtigkeitsmesser irren. So denken wir denn, daß man heute ruhig wandern kann, Schirm und Wettermantel bleiben zu Hause. Unbehagen verursacht nur das drückende Wärmegefühl. Und tatsächlich ballen sich schon bald drüben über Ehrenfeld dichte Cumuluswolken zusammen, sie werden enger und schwärzer mit sonderbaren dunklen Grundflächen. Es scheint fast, als ob ein Gewitter herannahe, und als ob, wie gewöhnlich, der Wetteranzeiger doch recht behielte.
Noch immer dumpfe Wärme, die Luft ist feucht und heiß. Aber nur kurze Zeit, dann ist der Himmel dunkel, das Gewölk wird noch schwarzer und tiefer, ein Gewitter naht. Schnell werden alle Klappen geschlossen und der Drehturm gegen Sturm gesichert. Nichts ist zu früh getan. Schon prasselt ein starker Regen hernieder, und nicht lange danach gibts ein Trommelfeuer, ein anhaltendes Maschinengewehrgeknatter, wie man es in dieser Stärke und in dieser engen Geschlossenheit noch nicht erlebt hat.
Nicht taubeneigroße Schloßen dröhnen herunter, viele sind darunter, die die Größe eines Hühnereies haben. Andauernd schmettert der riesige Hagel auf die Zinkplatten des Turmes herunter. Und so dicht auch alles aneinander schließt, kleinere Hagelkörner, etwa in der Größe von "Ömmern", dringen durch Lücken und Dichtungen. Blitze zucken hernieder und man könnte fast ängstlich werden, weil ja der Sternwarteturm die ganze Gegend überragt. Glücklicherweise halten die Fenster den starken Schlägen stand. Während man aber jeden Augenblick deren Zersplitterung erwartet, denkt man darüber nach, ob diese schweren, fast ganz kugelförmigen Eisbomben nur erdatmosphärischen Ursprungs sind. Oder sollten sie nicht doch aus dem Weltenraum zu uns kommen?
Man nimmt einige zur Hand. Sie sind ähnlich den Glasklickern, womit die Kölner Jugend ihre Herbstferienzeit vertreibt, sie sind durchsichtig, fast mit schneeartigem Kern. Eins der Hagelkörner bringen wir herunter. Trotzdem es schon etwas in der Hand abgeschmolzen ist, wiegt es noch über 100 g! Aber noch viel größere senden die zerrissenen, graublauen Wolken unter tobendem Sturm herab. Unter weiterem Blitz und Donner knattern immer mehr Geschosse auf den Turm. Der Hof unten ist hoch mit weißen Eisgeschossen übersät. Längere Zeit dauert es, bis die letzten Spuren einer vielleicht außerirdischen Eisbildung vergangen sind."
Wie man sieht, drängt sich dem Beobachter dieses Hagelwetters schon die Vermutung auf, daß die große Menge von Eisgeschossen außerirdischen Ursprungs ist. ....
"Die Sonne strahlt mit aller Kraft hernieder und verspricht einen heißen Tag. Zwar das kleine Wetterhäuschen, das seitwärts an der Sternwarte hängt, kündet Gewitter an, aber warum sollen sich nicht auch mal Barometer und Feuchtigkeitsmesser irren. So denken wir denn, daß man heute ruhig wandern kann, Schirm und Wettermantel bleiben zu Hause. Unbehagen verursacht nur das drückende Wärmegefühl. Und tatsächlich ballen sich schon bald drüben über Ehrenfeld dichte Cumuluswolken zusammen, sie werden enger und schwärzer mit sonderbaren dunklen Grundflächen. Es scheint fast, als ob ein Gewitter herannahe, und als ob, wie gewöhnlich, der Wetteranzeiger doch recht behielte.
Noch immer dumpfe Wärme, die Luft ist feucht und heiß. Aber nur kurze Zeit, dann ist der Himmel dunkel, das Gewölk wird noch schwarzer und tiefer, ein Gewitter naht. Schnell werden alle Klappen geschlossen und der Drehturm gegen Sturm gesichert. Nichts ist zu früh getan. Schon prasselt ein starker Regen hernieder, und nicht lange danach gibts ein Trommelfeuer, ein anhaltendes Maschinengewehrgeknatter, wie man es in dieser Stärke und in dieser engen Geschlossenheit noch nicht erlebt hat.
Nicht taubeneigroße Schloßen dröhnen herunter, viele sind darunter, die die Größe eines Hühnereies haben. Andauernd schmettert der riesige Hagel auf die Zinkplatten des Turmes herunter. Und so dicht auch alles aneinander schließt, kleinere Hagelkörner, etwa in der Größe von "Ömmern", dringen durch Lücken und Dichtungen. Blitze zucken hernieder und man könnte fast ängstlich werden, weil ja der Sternwarteturm die ganze Gegend überragt. Glücklicherweise halten die Fenster den starken Schlägen stand. Während man aber jeden Augenblick deren Zersplitterung erwartet, denkt man darüber nach, ob diese schweren, fast ganz kugelförmigen Eisbomben nur erdatmosphärischen Ursprungs sind. Oder sollten sie nicht doch aus dem Weltenraum zu uns kommen?
Man nimmt einige zur Hand. Sie sind ähnlich den Glasklickern, womit die Kölner Jugend ihre Herbstferienzeit vertreibt, sie sind durchsichtig, fast mit schneeartigem Kern. Eins der Hagelkörner bringen wir herunter. Trotzdem es schon etwas in der Hand abgeschmolzen ist, wiegt es noch über 100 g! Aber noch viel größere senden die zerrissenen, graublauen Wolken unter tobendem Sturm herab. Unter weiterem Blitz und Donner knattern immer mehr Geschosse auf den Turm. Der Hof unten ist hoch mit weißen Eisgeschossen übersät. Längere Zeit dauert es, bis die letzten Spuren einer vielleicht außerirdischen Eisbildung vergangen sind."
Wie man sieht, drängt sich dem Beobachter dieses Hagelwetters schon die Vermutung auf, daß die große Menge von Eisgeschossen außerirdischen Ursprungs ist. ....
Die außerirdische
Herkunft des Hagels machen nicht so sehr die
kleinen örtlichen Hagelfälle wahrscheinlich als vielmehr die
großen Unwetterkatastrophen. Bei solchen fällt vor
allem die schnurgerade Bahn auf, die keine Hindernisse kennt. Das
überwältigendste Beispiel eines derartigen Unwetters ist
immer noch das vom 13. Juli 1788. Man beachte übrigens den
Monat Juli. Er ist der Monat, der stets die schwersten Unwetter
bringt. So war es im Jahre 1929 der 4. Juli, im Jahre 1928 der 5.
August (diese kleine Verschiebung bis in die ersten Tage des August
macht nichts), im Jahre 1927 war es der 9. Juli, im Jahre 1926 der 5.
Juli. 1925 blieb ohne Riesenkatastrophe. Die
Begründung dafür, daß gerade im Monat Juli die
größten Eiskörper eingefangen werden, findet man im
Abschnitt über die jährliche Änderung des
Grobeiszuflusses (s. hierzu die Schrift: "Die kosmischen Ursachen des Wetters",
Kapitel 4 - "Die Änderungen des
Grobeiszuflusses zur Erde" von Dr. phil. Karl Waitz, Jahrg.
1930, R. Voigtländers Verlag-Leipzig).
Das Hagelwetter vom 13. Juli 1788 zog sich durch ganz Frankreich von den Pyrenäen an bis nach Holland hinein in schnurgeradem schnellem Doppelstrich. Getrennt waren beide Striche von einem Regenstreifen. Die Breite des westlichen Hagelstriches hielt sich dabei auf ungefähr 4 Meilen (19 km), die des Regenstreifens auf 4-5 Meilen (19-24 km), die des östlichen Hagelstriches auf 2 Meilen (10 km). Die Zweiteilung spricht dafür, daß der erzeugende Eiskörper gleich beim Eindringen in die irdische Lufthülle in zwei Teile zersprang. Die kleinere von beiden blieb sofort hinter dem größeren zurück, da er den Widerstand der Luft stärker erfuhr. Und so setzte denn auch der Hagel auf dem schmaleren östlichen Striche erst zwei Stunden später als auf dem westlichen ein. Ersterer hatte auch nur 150 Meilen Länge, letzterer dagegen 200. Der Durchmesser des Eiskörpers mag dabei 1000 m betragen haben.
Trotz allem ist auch dieses Hagelwetter noch klein zu nennen gegen jenes, welches am 27. Mai 1834 Rußland vom Baltischen bis zum Schwarzen Meer, vom Dniester und Niemen bis zur Wolga, also in einer Ausdehnung von über 15 Längengraden und 10 Breitengraden verwüstete.
Das Hagelwetter vom 13. Juli 1788 zog sich durch ganz Frankreich von den Pyrenäen an bis nach Holland hinein in schnurgeradem schnellem Doppelstrich. Getrennt waren beide Striche von einem Regenstreifen. Die Breite des westlichen Hagelstriches hielt sich dabei auf ungefähr 4 Meilen (19 km), die des Regenstreifens auf 4-5 Meilen (19-24 km), die des östlichen Hagelstriches auf 2 Meilen (10 km). Die Zweiteilung spricht dafür, daß der erzeugende Eiskörper gleich beim Eindringen in die irdische Lufthülle in zwei Teile zersprang. Die kleinere von beiden blieb sofort hinter dem größeren zurück, da er den Widerstand der Luft stärker erfuhr. Und so setzte denn auch der Hagel auf dem schmaleren östlichen Striche erst zwei Stunden später als auf dem westlichen ein. Ersterer hatte auch nur 150 Meilen Länge, letzterer dagegen 200. Der Durchmesser des Eiskörpers mag dabei 1000 m betragen haben.
Trotz allem ist auch dieses Hagelwetter noch klein zu nennen gegen jenes, welches am 27. Mai 1834 Rußland vom Baltischen bis zum Schwarzen Meer, vom Dniester und Niemen bis zur Wolga, also in einer Ausdehnung von über 15 Längengraden und 10 Breitengraden verwüstete.
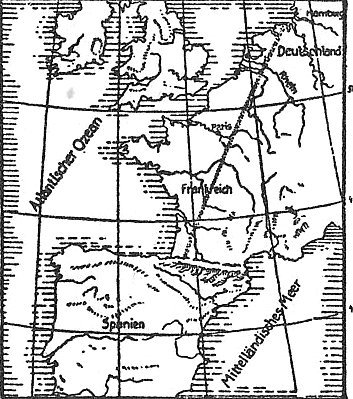
(Bildquelle- und text
aus dem Buch "Der Rhythmus des kosmischen Lebens" von Hanns Fischer,
1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Schnurgerader Bahnweg eines gewaltigen Hagelwetter, das von den Pyrenäen bis nach Nordholland in einer Breite von
etwa 50 km bei einer mehr als 1500 km langen Bahn alles verwüstete. (Zeichnung von Karl Wernicke)
Schnurgerader Bahnweg eines gewaltigen Hagelwetter, das von den Pyrenäen bis nach Nordholland in einer Breite von
etwa 50 km bei einer mehr als 1500 km langen Bahn alles verwüstete. (Zeichnung von Karl Wernicke)
Die in den obigen Beispielen
angeführte ungeheure
Längserstreckung der Hagelwetter steht doch ganz entschieden in
einem schreienden Mißverhältnis zu der winzigen
Quererstreckung. Das ist ein Umstand, der den Glauben an die
Entstehung aus dem aufsteigenden Luftstrom sehr schwer erschüttern
muß. Ganz gestürzt wird diese Ansicht durch die
Beobachtungstatsachen des 21. August 1890.
An jenem Tage wurde die Gegend von Graz von drei Hagelwettern innerhalb zweier Stunden heimgesucht. Eine 70 km lange Strecke von Graz bis zur ungarischen Grenze liegt in der Bahn aller drei Hagelwetter. Dabei bildeten die Eismassen, die vom ersten Hagelsturm hinterlassen wurden und naturgemäß starke Abkühlung hervorriefen, kein Hindernis für den zweiten, und die ungeheuren mit Eis bedeckten Flächen konnten nicht verhindern, daß der auch dritte Hagelzug seinen Weg über dieselbe Gegend nahm.
An jenem Tage wurde die Gegend von Graz von drei Hagelwettern innerhalb zweier Stunden heimgesucht. Eine 70 km lange Strecke von Graz bis zur ungarischen Grenze liegt in der Bahn aller drei Hagelwetter. Dabei bildeten die Eismassen, die vom ersten Hagelsturm hinterlassen wurden und naturgemäß starke Abkühlung hervorriefen, kein Hindernis für den zweiten, und die ungeheuren mit Eis bedeckten Flächen konnten nicht verhindern, daß der auch dritte Hagelzug seinen Weg über dieselbe Gegend nahm.
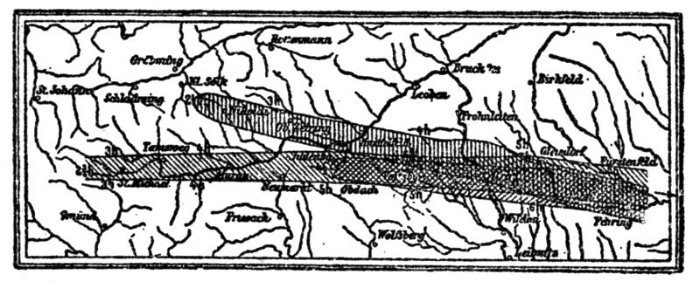
(Bildquelle- u. text aus
dem Buch "Aberglaube oder Volksweisheit?" von Hanns Fischer, 1935,
Verlag Carl Milde-Leipzig)
Dreifache Behagelung der nämlichen stark gebirgigen Strecke in Steiermark am 21. August 1890.
Dreifache Behagelung der nämlichen stark gebirgigen Strecke in Steiermark am 21. August 1890.
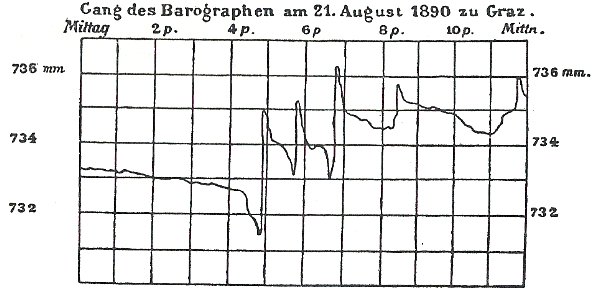
(Bildquelle- u. text aus
dem Buch "Die kosmischen Ursachen des Wetters" von Dr. phil. Karl
Waitz, 1930, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Gang des Barometers am 21. August 1890 zu Graz (nach Hann-Süring) gelegentlich des ebenfalls schon genannten dreifachen Hagelwetters.
Die nach den drei großen Gewitternasen noch zu bemerkenden beiden kleineren zeigen, daß den drei großen Trümmerstücken noch
weitere kleinere gefolgt sind, die aber eben wegen ihrer Kleinheit nur noch als Böen, nicht mehr als Hagel auftraten.
Gang des Barometers am 21. August 1890 zu Graz (nach Hann-Süring) gelegentlich des ebenfalls schon genannten dreifachen Hagelwetters.
Die nach den drei großen Gewitternasen noch zu bemerkenden beiden kleineren zeigen, daß den drei großen Trümmerstücken noch
weitere kleinere gefolgt sind, die aber eben wegen ihrer Kleinheit nur noch als Böen, nicht mehr als Hagel auftraten.
Man kommt bei der genaueren
Betrachtung der Hagelwetter zu dem
Schluß, "daß ein
Hagelwetter, das sich in einer bestimmten Richtung in Bewegung gesetzt
hat, diese beibehält, ohne Rücksicht darauf, ob
Gebirgszüge und Talrichtungen mit derselben übereinstimmen
oder nicht. Mehrere
Hagelzüge des gleichen Tages verfolgen meist die gleiche Richtung
oder sind parallel oder geradlinig angeordnet, so daß zuweilen
auch der eine Hagelzug als die spätere Fortsetzung eines
früheren erscheint. Vorausgegangene Hagelwetter, mit starker
Abkühlung, welche die Erdoberfläche mit Eis bedeckt
hinterlassen haben, verhindern nicht, daß ein zweites und drittes
Hagelwetter den gleichen Weg einschlägt."
Wie könnte man bei solchen Ereignissen die Behauptung von der Entstehung des Hagel durch den aufsteigenden Luftstrom aufrecht erhalten, zumal ausdrücklich festgestellt wurde, daß ein Einfluß der Gebirge durchaus nicht zu erkennen war. Vielmehr gingen die Züge geradelinig über 2000 bis 2400 m hohe Bergzüge hinweg.
Wie könnte man bei solchen Ereignissen die Behauptung von der Entstehung des Hagel durch den aufsteigenden Luftstrom aufrecht erhalten, zumal ausdrücklich festgestellt wurde, daß ein Einfluß der Gebirge durchaus nicht zu erkennen war. Vielmehr gingen die Züge geradelinig über 2000 bis 2400 m hohe Bergzüge hinweg.
Von den neueren
Unwetterkatastrophen liegen leider keine brauchbaren
Bearbeitungen vor, so daß man gezwungen ist, auf ältere
Ereignisse zurückzugreifen. In der Darstellung des Sturmes
in Norddeutschland vom 4. Juli 1928 durch v. Ficker ist für unsere
Betrachtungsweise einzig die Karte der Niederschlagsmengen vom 3. Juli
morgens bis 5. Juli morgens brauchbar. Auf ihr kann man sehr gut
das geradlinige Fortschreiten der erzeugenden
Eiskörpertrümmer verfolgen. Das Gebiet mit über 20
mm Niederschlag zieht sich quer durch ganz Norddeutschland von WSW nach
ONO. In diesem, an Breite aus naheliegenden Gründen
schwankenden Streifen liegen auffällig geradlinig und parallel
angeordnet mehr oder weniger große, d. h. in diesem Falle
langgezogene Inseln mit über 30 mm Niederschlag. Sie
beweisen den Einschuß als Ursache.
Die anderen Vorgänge, hauptsächlich die mit dem Einschuß verbundene starke Luftbewegung, sind für uns von untergeordneter Wichtigkeit. In der Fickerschen Darstellung spielt die Luftbewegung die Hauptrolle. Daher müssen auch die wahren Ursachen verborgen bleiben. Denn die Luftbewegung ist nicht Ursache, sondern Folge des Hagels!
Die anderen Vorgänge, hauptsächlich die mit dem Einschuß verbundene starke Luftbewegung, sind für uns von untergeordneter Wichtigkeit. In der Fickerschen Darstellung spielt die Luftbewegung die Hauptrolle. Daher müssen auch die wahren Ursachen verborgen bleiben. Denn die Luftbewegung ist nicht Ursache, sondern Folge des Hagels!
Einen Beweis gegen die
Behauptung, daß der Hagel durch den
aufsteigenden Luftstrom entsteht, bildet die wiederholte Beobachtung nächtlicher
Hagelfälle. Sie sind zwar verhältnismäßig
selten, ... aber doch nicht ganz ungewöhnlich. In der Nacht
kann sich doch niemals ein durch Überhitzung der untersten
Luftschichten entstehender aufsteigender Luftstrom bilden. Im
Gegenteil wird infolge der stets eintretenden nächtlichen
Abkühlung die Schichtung der Luft stabiler als am Tage.
Geradezu gefährlich
für das Ansehen mancher Wissenschaftler
ist deren Ansicht vom Entstehen großer Hagelsteine. Sie
folgern nämlich so: Die Größe des Hagelkornes ist von
der Länge des Weges abhängig, den die erstmalig gebildeten
Eiskugeln in der Hagelwolke zurücklegen. Letztere stellt man
sich aus unterkühlten Wassertröpfchen bestehend vor.
Bei der Berührung mit dem die Wolke durchfallenden Hagelkorn
frieren sie sofort auf ihm nieder. So bildet sich das schalige
Aussehen heraus. Genügt diese erste Durcheilung noch nicht zur
Erlangung der notwendigen Größe, so kann man sich vorstellen
- oder nicht (der Verfasser), daß der aufsteigende Luftstrom die
Hagelkörner wieder emporhebt und diese den Weg durch die
unterkühlte Wolke wiederholen können! Das kann mehrmals
geschehen, so daß schließlich sogar kilogrammschwere
Hagelsteine entstehen! (?)
Abgesehen davon, daß man sich einen in regelmäßigen Abständen an- und abschwellenden aufsteigenden Luftstrom dynamisch kaum möglich vorstellen kann, ist es doch ganz abwegig, daß dieser aufsteigende Luftstrom mit Eiskugeln so groß wie Kegelkugeln Fangball spielt.
Bleiben wir also lieber bei der Hörbigerschen Deutung der Hagelentstehung. Sie ist zwar etwas gewaltsamer, aber viel besser vorstellbar.
Abgesehen davon, daß man sich einen in regelmäßigen Abständen an- und abschwellenden aufsteigenden Luftstrom dynamisch kaum möglich vorstellen kann, ist es doch ganz abwegig, daß dieser aufsteigende Luftstrom mit Eiskugeln so groß wie Kegelkugeln Fangball spielt.
Bleiben wir also lieber bei der Hörbigerschen Deutung der Hagelentstehung. Sie ist zwar etwas gewaltsamer, aber viel besser vorstellbar.
Gewaltsam sind aber auch
zuweilen die Hagelunwetter selber. Das
mögen einige Berichte erläutern, deren ersten wir dem
Schöpfer der schönen deutschen Sprache, Hans Wolfgang von
Goethe, verdanken. In seiner Übersetzung des Lebenslaufes
von Benvenuto Cellini kann man im ersten Kapitel des vierten Buches
folgendes lesen:
"Als wir uns etwa eine Tagreise von Lyon befanden - es war ungefähr zwei Stunden vor Sonnenuntergang - that es bei ganz klarem Himmel einige trockene Donnerschläge. Ich war wol den Schuß einer Armbrust weit vor meinen Gesellen hergeritten. Nach dem Donnern entstand am Himmel ein so großer fürchterlicher Lärm, daß ich dachte, das jüngste Gericht sei nahe; als ich ein wenig stille hielt, fielen Schloßen ohne einen Tropfen Wasser ungefähr in der Größe der Bohnen, die mir sehr wehe thaten, als sie auf mich fielen. Nach und nach wurden sie größer, wie Armbrustkugeln, und da mein Pferd sehr scheu ward, so wendete ich es um und ritt mit großer Hast bis ich wieder zu meiner Gesellschaft kam, die, um sich zu schützen, in einem Fichtenwalde gehalten hatte. Die Schloßen wurden immer größer und endlich wie dicke Citronen. Ich sang eine Misere, und indessen ich mich andächtig zu Gott wendete, schlug der Hagel einen sehr starken Ast der Fichte herunter, wo ich mich in Sicherheit glaubte. Mein Pferd wurde auf den Kopf getroffen, so daß es beinah zur Erde gefallen wäre; mich streifte ein solches Stück und hätte mich todtgeschlagen, wenn es mich völlig getroffen hätte; auch der gute Leonhard Tedaldi empfing einen Schlag, daß er, der wie ich auf den Knien lag, vor sich hin mit den Händen auf die Erde fiel. Da begriff ich wol, daß der Ast weder mich noch andere mehr beschützen könne und daß nebst dem Misere man auch thätig sein müsse. Ich fing daher an, mir die Kleider über den Kopf zu ziehen, und sagte zu Leonharden, der immer nur 'Jesus! Jesus' schrie, Gott werde ihm helfen, wenn er sich selbst hülfe; und ich hatte mehr Noth ihn als mich zu retten.
Als das Wetter eine Zeit lang gedauert hatte, hörte es auf, und wir, die wie alle zerstoßen waren, setzten uns, so gut es gehen wollte, zu Pferde, und als wir nach unsern Quartieren ritten und einander die Wunden und Beulen zeigten, fanden wir eine Meile vorwärts ein viel größeres Unheil als das, was wir erduldet hatten, so daß es unmöglich scheint, es zu beschreiben. Denn alle Bäume waren zerschmettert, alle Thiere erschlagen, so viel es nur angetroffen hatte. Auch Schäfer waren todt geblieben, und wir fanden genug solches Hagels, den man nicht mit zwei Händen umspannt hätte. Da sahen wir, wie wohlfeil wir noch davongekommen waren, und daß unser Gebet und unser Misere wirksamer gewesen war als Alles, was wir zu unserer Rettung hätten thun können; so dankten wir Gott und kamen nach Lyon."
"Als wir uns etwa eine Tagreise von Lyon befanden - es war ungefähr zwei Stunden vor Sonnenuntergang - that es bei ganz klarem Himmel einige trockene Donnerschläge. Ich war wol den Schuß einer Armbrust weit vor meinen Gesellen hergeritten. Nach dem Donnern entstand am Himmel ein so großer fürchterlicher Lärm, daß ich dachte, das jüngste Gericht sei nahe; als ich ein wenig stille hielt, fielen Schloßen ohne einen Tropfen Wasser ungefähr in der Größe der Bohnen, die mir sehr wehe thaten, als sie auf mich fielen. Nach und nach wurden sie größer, wie Armbrustkugeln, und da mein Pferd sehr scheu ward, so wendete ich es um und ritt mit großer Hast bis ich wieder zu meiner Gesellschaft kam, die, um sich zu schützen, in einem Fichtenwalde gehalten hatte. Die Schloßen wurden immer größer und endlich wie dicke Citronen. Ich sang eine Misere, und indessen ich mich andächtig zu Gott wendete, schlug der Hagel einen sehr starken Ast der Fichte herunter, wo ich mich in Sicherheit glaubte. Mein Pferd wurde auf den Kopf getroffen, so daß es beinah zur Erde gefallen wäre; mich streifte ein solches Stück und hätte mich todtgeschlagen, wenn es mich völlig getroffen hätte; auch der gute Leonhard Tedaldi empfing einen Schlag, daß er, der wie ich auf den Knien lag, vor sich hin mit den Händen auf die Erde fiel. Da begriff ich wol, daß der Ast weder mich noch andere mehr beschützen könne und daß nebst dem Misere man auch thätig sein müsse. Ich fing daher an, mir die Kleider über den Kopf zu ziehen, und sagte zu Leonharden, der immer nur 'Jesus! Jesus' schrie, Gott werde ihm helfen, wenn er sich selbst hülfe; und ich hatte mehr Noth ihn als mich zu retten.
Als das Wetter eine Zeit lang gedauert hatte, hörte es auf, und wir, die wie alle zerstoßen waren, setzten uns, so gut es gehen wollte, zu Pferde, und als wir nach unsern Quartieren ritten und einander die Wunden und Beulen zeigten, fanden wir eine Meile vorwärts ein viel größeres Unheil als das, was wir erduldet hatten, so daß es unmöglich scheint, es zu beschreiben. Denn alle Bäume waren zerschmettert, alle Thiere erschlagen, so viel es nur angetroffen hatte. Auch Schäfer waren todt geblieben, und wir fanden genug solches Hagels, den man nicht mit zwei Händen umspannt hätte. Da sahen wir, wie wohlfeil wir noch davongekommen waren, und daß unser Gebet und unser Misere wirksamer gewesen war als Alles, was wir zu unserer Rettung hätten thun können; so dankten wir Gott und kamen nach Lyon."
Drei weitere Berichte, die die
außerirdische Herkunft des Hagels
besonders durch die Eigentümlichkeiten einzelner Hagelsteine
erhärten, verdanken wir der Vermittlung von Herrn Dr. H. Voigt,
Kassel.
1) Am 1. Juli 1890 - so
schreibt Geheimrat Prof. Dr. Ing. L.
Hotopp, Hannover - ging ein ungewöhnlich schweres Hagelwetter von
Hameln und Hildesheim heranziehend über Braunschweig hinweg, das
in beiderseits scharf begrenzter Breite von vielleicht 5-6 km die
Felder mit den daraufstehenden Früchten innerhalb jener Grenzen
völlig vernichtete, außerhalb derselben völlig
unbeschädigt ließ. Bei Beginn des Hagelschauers
an einer bestimmten Stelle in der Stadt Braunschweig befand ich mich
dort vor einem hohen Schulgebäude, auf dessen Ziegeldach ich mit
deutlichem Krachen einen Gegenstand fallen hörte, der nach wenigen
Sekunden vor mir auf dem Straßenpflaster lag. Ein
Eisstück von ungefähr ein Kubikdezimeter Größe mit
scharfkantigem kristallinischem Bruch war es, dessen Herkunft als aus
einem größeren Eisblock durch Abbröckelung entstanden
kenntlich war. Jener große Eisblock hat sich unter der
Wirkung seiner Masse trotz des herrschenden Sturmes in der in die
Erscheinung getretenen Kurve bewegen können.
2) Des weiteren berichtet H.
Pohle, Köln-Nippes: Vor einiger Zeit
habe ich die Familie Heckelsberg noch einmal aufgesucht und in
Gegenwart der beiden Söhne der Frau Heckelsberg, die heute 48 bzw.
52 Jahre sind, beide Gutsbesitzer, mir die Schilderung des
Naturereignisses wiederholen lassen, das nach Meinung der Söhne
1872 das Erstaunen der Bevölkerung von Wippenhohn bei Hennef
(Sieg) veranlaßte. Die Darstellung des Geschehnisses war
den Söhnen so geläufig, daß sie mir den Wortlaut des
Berichtes übereinstimmend wiedergeben konnten. Mir selbst
gab die nunmehr Verstorbene 1924 die gleiche Darstellung, ohne
daß sie in ihrer ländlichen Abgeschiedenheit etwas von der
Welteislehre gehört hatte. Die Erzählung lautet:
"Gegen Gottes Gewalt kann keiner an. Denn in meiner Jugend habe ich es erlebt, daß es im Sommer, bei ganz wolkenlosem, klarem Himmel und hellem Sonnenschein stark blitzte und die Eisstücke mit starkem Getöse niederrasselten. Nachher fanden wir auf dem Speicher zwei große Eisstücke."
Leider konnte ich nachträglich über die Größe der Stücke keine zuverlässigen Angaben mehr aufbringen. Es ist aber anzunehmen, daß die Stücke schon eine beachtliche Größe gehabt haben müssen, da sie das Dach durchschlugen, nach einiger Zeit erst, trotz Schmelzverlustes, noch gefunden wurden und sogar als groß bezeichnet werden konnten. Man hatte angenommen, daß es im Hause eingeschlagen habe und war deshalb auf den Boden gestiegen, um Brandgefahr festzustellen.
"Gegen Gottes Gewalt kann keiner an. Denn in meiner Jugend habe ich es erlebt, daß es im Sommer, bei ganz wolkenlosem, klarem Himmel und hellem Sonnenschein stark blitzte und die Eisstücke mit starkem Getöse niederrasselten. Nachher fanden wir auf dem Speicher zwei große Eisstücke."
Leider konnte ich nachträglich über die Größe der Stücke keine zuverlässigen Angaben mehr aufbringen. Es ist aber anzunehmen, daß die Stücke schon eine beachtliche Größe gehabt haben müssen, da sie das Dach durchschlugen, nach einiger Zeit erst, trotz Schmelzverlustes, noch gefunden wurden und sogar als groß bezeichnet werden konnten. Man hatte angenommen, daß es im Hause eingeschlagen habe und war deshalb auf den Boden gestiegen, um Brandgefahr festzustellen.
3) Der dritte Bericht, der von
Frau Gräfin Larisch auf
Schloß Wolftitz bei Frohburg stammt, wurde bereits von H. Fischer
in seinem "Rhythmus des kosmischen Lebens" auf S. 36/37 gebracht.
Er lautet also:
"Im Jahre 1909 oder 1910 mittags gegen 1 Uhr zur Fliederblüte fuhr ich mit der elektrischen Bahn nach dem Rittergute Dölitz. Der Himmel in dieser Richtung war blauschwarz. Es zeigte sich ein leichter Schleier schwefelgelber Flecken über den Wolken. Auf dem Rittergute angekommen, sah ich kurz nach 2 Uhr große weiße Kloben vom Himmel herunterfallen. Sie gingen nicht alle senkrecht nieder, sondern kreuzten sich und hatten zum Teil, wie es schien, eine fast horizontale Flugbahn. Die außer mir anwesenden Gäste nahmen weniger Notiz, wohl aber der Hausherr, Herr Major von Winkler, welcher ausrief: 'Meine Dächer!' Mit Gewehrschußgetöse trafen die Eisstücke auf die Dächer auf. Anscheinend durch die rotierende Bewegung schien es, als ob die Ziegel zermalmt, nicht nur zerschlagen würden. Der Ziegelstaub spritzte hoch auf. Bald waren auch die im Hofe innerhalb der Scheune stehenden Wagen der Gäste mit dem Ziegelstaub überzogen, sie sahen aus wie rot angestrichen. In der Richtung nach dem Orte fielen die Schloßen reichlicher, anscheinend weniger auf der anderen Seite. Die Gärtnereien im Orte hatten schwer gelitten. Wohl drei Viertelstunden nach Beginn des Wetters brachte der Schloßgärtner ein Eisstück, das einen Desertteller voll bedeckte. Auffallend war, wie langsam das Eis schmolz. Ich sah Stücke wie aus Kristall, auch kristallinische Gebilde, auch zackig wie um einen Kegel geformt; meist ähnelten sie einem abgeschlagenen Stein. Erwähnen möchte ich besonders, daß ein Eisstück durch eine offene Fensterscheibe der kleinen Wohnstube bis in die entlegenste Ecke geschleudert war. Dieses Eisstück muß eine ziemlich horizontale Flugbahn gehabt haben und stark rotierende Bewegung, denn es hatte sich um dasselbe ein Pack Blätter von Efeu, Rüster und Eiche geballt, die von Bäumen stammten, deren Äste es auf seinem Wege der Reihe nach durchschlagen hatte. Das Laubwerk lag schichtenweise. Der Efeu mußte von der Außenmauer seitlich von einer langen Ranke abgetrennt worden sein. Noch zwei Stunden nach dem Fall, der nur kurze Minuten dauerte, grub ich tief aus einem Beet, auf dem Azaleen standen, ein Eisstück wie zwei Männerfäuste groß aus. Dabei war es ein sehr warmer Frühlingstag."
"Im Jahre 1909 oder 1910 mittags gegen 1 Uhr zur Fliederblüte fuhr ich mit der elektrischen Bahn nach dem Rittergute Dölitz. Der Himmel in dieser Richtung war blauschwarz. Es zeigte sich ein leichter Schleier schwefelgelber Flecken über den Wolken. Auf dem Rittergute angekommen, sah ich kurz nach 2 Uhr große weiße Kloben vom Himmel herunterfallen. Sie gingen nicht alle senkrecht nieder, sondern kreuzten sich und hatten zum Teil, wie es schien, eine fast horizontale Flugbahn. Die außer mir anwesenden Gäste nahmen weniger Notiz, wohl aber der Hausherr, Herr Major von Winkler, welcher ausrief: 'Meine Dächer!' Mit Gewehrschußgetöse trafen die Eisstücke auf die Dächer auf. Anscheinend durch die rotierende Bewegung schien es, als ob die Ziegel zermalmt, nicht nur zerschlagen würden. Der Ziegelstaub spritzte hoch auf. Bald waren auch die im Hofe innerhalb der Scheune stehenden Wagen der Gäste mit dem Ziegelstaub überzogen, sie sahen aus wie rot angestrichen. In der Richtung nach dem Orte fielen die Schloßen reichlicher, anscheinend weniger auf der anderen Seite. Die Gärtnereien im Orte hatten schwer gelitten. Wohl drei Viertelstunden nach Beginn des Wetters brachte der Schloßgärtner ein Eisstück, das einen Desertteller voll bedeckte. Auffallend war, wie langsam das Eis schmolz. Ich sah Stücke wie aus Kristall, auch kristallinische Gebilde, auch zackig wie um einen Kegel geformt; meist ähnelten sie einem abgeschlagenen Stein. Erwähnen möchte ich besonders, daß ein Eisstück durch eine offene Fensterscheibe der kleinen Wohnstube bis in die entlegenste Ecke geschleudert war. Dieses Eisstück muß eine ziemlich horizontale Flugbahn gehabt haben und stark rotierende Bewegung, denn es hatte sich um dasselbe ein Pack Blätter von Efeu, Rüster und Eiche geballt, die von Bäumen stammten, deren Äste es auf seinem Wege der Reihe nach durchschlagen hatte. Das Laubwerk lag schichtenweise. Der Efeu mußte von der Außenmauer seitlich von einer langen Ranke abgetrennt worden sein. Noch zwei Stunden nach dem Fall, der nur kurze Minuten dauerte, grub ich tief aus einem Beet, auf dem Azaleen standen, ein Eisstück wie zwei Männerfäuste groß aus. Dabei war es ein sehr warmer Frühlingstag."
Zur Vervollständigung des
Bildes der irdischen Auswirkungen des
zur Sonne strebenden Grobeises wollen wir noch einiges über die
bei Hagelwettern auftretenden elektrischen Erscheinungen sagen.
Zunächst hören wir, was Hann-Süring dazu zu sagen haben:
"Der Hagel fällt fast ausnahmslos bei Gewittern, das wird überall hervorgehoben. Doch sind die elektrischen Entladungen meist von eigentümlichem Charakter. Die Blitze sind äußerst zahlreich, ja fast unaufhörlich, der Donner dagegen schwach, ein gleichmäßiges Rollen mit geringen Modulationen. Die Entladungen scheinen nur zwischen den Wolken vor sich zu gehen und von geringer Intensität zu sein. Die Hagelkörner sollen auch zuweilen mit einer starken elektrischen Ladung auf der Erde ankommen, man hat sie auch schwach leuchten sehen!"
"Der Hagel fällt fast ausnahmslos bei Gewittern, das wird überall hervorgehoben. Doch sind die elektrischen Entladungen meist von eigentümlichem Charakter. Die Blitze sind äußerst zahlreich, ja fast unaufhörlich, der Donner dagegen schwach, ein gleichmäßiges Rollen mit geringen Modulationen. Die Entladungen scheinen nur zwischen den Wolken vor sich zu gehen und von geringer Intensität zu sein. Die Hagelkörner sollen auch zuweilen mit einer starken elektrischen Ladung auf der Erde ankommen, man hat sie auch schwach leuchten sehen!"
Die Entstehung der
Luftelektrizität und besonders der
Gewitterelektrizität kann man sich mit rein irdischen Ursachen
beim besten Willen nicht erklären. Aber die beim
Einschießen eines Grobeiskörpers entstehende Reibung kann
unermeßliche Mengen Elektrizität liefern. Da sich der
Sitz der Gewitterelektrizität in solchen Fällen dicht
über der Erdoberfläche befindet, erklärt sich auch die
Eigenart des Donners: Dadurch gehen die Entladungen in kurzer
Entfernung vom Beobachter vor sich, auch ist die ganze Erscheinung auf
einen engen Raum beschränkt. Im Gegensatz dazu stehen die
sogenannten Wärmegewitter, über deren aber erst spätere
Abschnitte Aufklärung geben werden (s. hierzu: "Über
Luftelektrizität" von Hanns Hörbiger).
Die von Hagelkörnern mitgebrachte elektrische Ladung brauch nach obigem nicht mehr zu verwundern. Ebensowenig die elektrische Phosphoreszenz der Hagelkörner, die u. a. Colladon bei dem Hagelfall am 7.-8. Juli 1875 zu Genf beobachtete.
Die von Hagelkörnern mitgebrachte elektrische Ladung brauch nach obigem nicht mehr zu verwundern. Ebensowenig die elektrische Phosphoreszenz der Hagelkörner, die u. a. Colladon bei dem Hagelfall am 7.-8. Juli 1875 zu Genf beobachtete.
"In den meisten Fällen
fällt beim Ausbruche des Gewitters der Hagel zuerst und der Regen
folgt nach, doch wiederholen sich auch die Hagelfälle bei
demselben Gewitter, und die Hagelkörner haben dann auch oft eine
verschiedene Form." Das ist bei der Entstehung des Hagels
durch Zerkörnerung eines in die Atmosphäre eingedrungenen
Milchstraßenkörpers nur natürlich. Zuerst kommt
der massige Hagel herunter und zuletzt der in Wasser aufgelöste
Teil des Eindringlings. Zerspringt er aber schon in
größeren Höhen in mehrere Teile, so kommen wiederholte
Hagelfälle zustande. Ist der Milchstraßenkörper
durch Zusammenbacken verschiedener kleiner Eisballungen entstanden,
deren Bau etwas verschieden war, so werden die Bestandteile auch
verschieden zerfallen. Denn natürlich teilt sich der
Eindringling zunächst einmal wieder in seine Baustücke, da an
den Verkittungsflächen die Reibungswärmespannungen am ehesten
zum Bruch führen müssen.
"Wenn auch der Hagel zugleich mit dem
Gewitter auftritt, so begleitet
er dasselbe doch durchaus nicht immer auf seinem ganzen Wege und hat
auch zumeist eine viel kleinere Breiteerstreckung als das Gewitter
selbst. Es ist bekannt, daß der Hagel zumeist in schmalen
Streifen fällt, die dem Gewitterzuge parallel verlaufen, aber viel
schmäler als dieser. Zuweilen begleiten zwei oder selbst
mehrere schmale Hagelstreifen dasselbe Gewitter. Bisher haben
sich niemals Hagelfronten gezeigt, die sich wie Regenfronten eines
Gewitters fortpflanzen." Nur über schmalen, aber oft
sehr langen Gebieten hagelt es. Dies ist uns nunmehr schon ganz
selbstverständlich geworden. Nur die Verschiedenheit der
Breiteerstreckung von Gewitter und Hagel erfordert noch einige
Erklärungen.
Die mit Hagel verbundenen
Gewitter sind fast stets sogenannte
Frontgewitter, selten Wärmegewitter. D. h., sie treten bei
einem Kaltlufteinbruch auf. Dabei sind sie aber gewöhnlich
so zahlreich, daß die Fülle der Gesichte auf die Beobachter
etwas verwirrend wirkt. Wer aber einmal Gelegenheit gehabt hat,
bei abflauender Gewitterbildung einzelne Stücke solcher
Erscheinungen zu beobachten, wird zu einer sehr merkwürdigen
Auffassung gekommen sein. Verfasser wenigstens konnte
feststellen, daß derartige Gewitter von vorn gesehen, solange sie
noch tief am Horizont stehen, den Eindruck erwecken, als sei ein
gewaltiges Geschoß in einen Wassertümpel gesaust, dessen
Wasser nach allen Seiten auseinanderspritzt.
Von der Seite sieht man deutlich, daß unter den seitlich entweichenden, feuchten, also wolkenbildenden Luftmassen nach vorn ein gewaltiger Wulst aufgeworfen wird. Dieser macht sich in unheimlich geballten, dicken Gewitterwolken (Cumulo-Nimbus) bemerkbar. Nach hinten erstreckt sich ein feineres Wolkengebilde, nachgeschleppter Wasserdampf. Kurz gesagt, man sieht, wie durch die Gewalt des Einsturzes die Atmosphäre aufgewühlt und in weitem Umkreise mit Wasserdampf gesättigt wird - und Regen bringt. Das Eis dagegen splittert nur auf schmaler Bahn daher. Daß die nach den Seiten gedrängten Wolkenmassen auch Reibungselektrizität des einstürzenden Eises enthalten, ist selbstverständlich. So hat denn auch die Erscheinung des Gewitters eine größere Breiteerstreckung als der Hagel.
Von der Seite sieht man deutlich, daß unter den seitlich entweichenden, feuchten, also wolkenbildenden Luftmassen nach vorn ein gewaltiger Wulst aufgeworfen wird. Dieser macht sich in unheimlich geballten, dicken Gewitterwolken (Cumulo-Nimbus) bemerkbar. Nach hinten erstreckt sich ein feineres Wolkengebilde, nachgeschleppter Wasserdampf. Kurz gesagt, man sieht, wie durch die Gewalt des Einsturzes die Atmosphäre aufgewühlt und in weitem Umkreise mit Wasserdampf gesättigt wird - und Regen bringt. Das Eis dagegen splittert nur auf schmaler Bahn daher. Daß die nach den Seiten gedrängten Wolkenmassen auch Reibungselektrizität des einstürzenden Eises enthalten, ist selbstverständlich. So hat denn auch die Erscheinung des Gewitters eine größere Breiteerstreckung als der Hagel.
Angesichts der von Hagelwettern
erreichten Geschwindigkeiten
müßte man ratlos bleiben, wenn man als alleinige Ursache
aufsteigenden Luftstrom gelten ließe. Denn wie sollte er
sich mit 71 km/st (6. Juli 1905, Ostalpen) oder gar 94 km/st (13. Juli
1788, Frankreich - Holland), 100 - 170 (!), im Mittel 111 km/st (25.
August 1890, Italien-Mähren) aus Gründen der
Temperaturunterschiede fortpflanzen können? Betrachtet man
all diese Umstände recht, so wird man sich der Hörbigerschen
Erklärung des Hagels nicht verschließen können.
Nachdenklich wird man auch beim
Lesen Danckelmannscher
Forschungsergebnisse. A. v. Danckelmann hat die in den
Bordjournalen im Indischen Ozean zwischen 36 und 5° südlicher
Breite und 20-120° östlicher Länge aufgezeichneten
Hagelfälle gesammelt. In Prozenten der Beobachtungstage
entfallen auf den Winter 1,6,
Frühling 1,3, Sommer 0,4,
Herbst 0,9%. Im Sommer, der heißesten Jahreszeit,
fällt über dem Indischen Ozean also am wenigsten Hagel,
dagegen im Winter, der kühlsten Jahreszeit am meisten! Das
ist doch der beste Beweis, daß die im Sommer stärkere
Erwärmung der bodennahen Luftschichten nicht ausschlaggebend für die
Hagelbildung ist. Das in unseren Breiten auftretende Julimaximum
des Hagelfalles müßte man demnach auch anders als durch die
große Luftanwärmung erklären können (s.
jährliche Häufigkeitsschwankung des Grobeises zur Erde - "Aufruhr im
Luftozean" oder das Buch "Die kosmischen Ursachen des Wetters" von
Dr. phil. Karl Waitz, S. 26-41, Jahrg. 1930, R. Voigtländers
Verlag).
Zum Schluß dieses
Abschnittes sei nun noch etwa über den Bau der Hagelkörner
und -steine gesagt. Die Form der Hagelschloßen ist
außerordentlich mannigfaltig. Die sonderbarsten Gebilde
kommen vor. Gewöhnlich sind die Eisstücke kugel- oder
eiförmig, weshalb man kurz nur von Hagelkörnern
spricht. Daneben kommen noch sehr häufig kegelförmige
Eiskörper vor, deren Basis abgerundet konvex ist, eine Art
Kugelpyramide, als wenn der Hagel durch Zerspringen einer Eiskugel
entstanden wäre (vgl. obige Erklärungen).
Außerdem fallen auch linsen- oder plattenförmige Eisgebilde
oder ganz unregelmäßige Stücke Eis (vgl.
dasselbe). Alle Größen kommen vor, von
Erbsengröße bis zur Größe von Orangen oder selbst
Melonen, oder von Eisplatten oder Klötzen von ähnlichem
Gewichte!
Wenn man dann noch von den zuweilen gemessenen Temperaturen des Hagels hört, so wird man von seiner Weltraumherkunft restlos überzeugt sein. Denn die Temperatur der Hagelkörner unmittelbar nach ihrem Fallen ist zuweilen erheblich unter 0° und kann - 5° bis - 15° betragen! Hätte sich das Eis erst während des Falles des ersten "Keimes" gebildet, indem das unterkühlte Wolkenwasser sich auf diesem niederschlug, so könnte die Temperatur der Hagelkörner doch kaum wesentlich unter 0° liegen. Denn beim plötzlichen Gefrieren unterkühlten Wassers steigt seine Temperatur ebenso plötzlich auf 0°. Die Schmelzwärme wird frei.
Nach Verlassen der unterkühlten Wolke durchfällt der Hagelstein ja wohl zunächst auch noch Luftschichten mit negativen Temperaturen, doch ist die Abkühlung dabei nicht sehr erheblich, da ja die Reibung wieder Wärme erzeugt. Wo anders als im Weltraum kann der Hagel also wirklich tiefe Temperaturen erhalten?
Wenn man dann noch von den zuweilen gemessenen Temperaturen des Hagels hört, so wird man von seiner Weltraumherkunft restlos überzeugt sein. Denn die Temperatur der Hagelkörner unmittelbar nach ihrem Fallen ist zuweilen erheblich unter 0° und kann - 5° bis - 15° betragen! Hätte sich das Eis erst während des Falles des ersten "Keimes" gebildet, indem das unterkühlte Wolkenwasser sich auf diesem niederschlug, so könnte die Temperatur der Hagelkörner doch kaum wesentlich unter 0° liegen. Denn beim plötzlichen Gefrieren unterkühlten Wassers steigt seine Temperatur ebenso plötzlich auf 0°. Die Schmelzwärme wird frei.
Nach Verlassen der unterkühlten Wolke durchfällt der Hagelstein ja wohl zunächst auch noch Luftschichten mit negativen Temperaturen, doch ist die Abkühlung dabei nicht sehr erheblich, da ja die Reibung wieder Wärme erzeugt. Wo anders als im Weltraum kann der Hagel also wirklich tiefe Temperaturen erhalten?
Fachmeteorologe Dr. phil. Karl Waitz
(Quelle: Buch "Die kosmischen Ursachen des Wetters" von Dr. phil. Karl Waitz, S. 11-22, Jahrg. 1930, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)