| Zurück |
Impressum
Datenschutz
Gepeinigt
von den Sorgen des Alltags, hin und her geworfen zwischen
nichtigen Dingen, oft mutlos verzweifelt aus eigener oder fremder
Schuld - so ziehen gar viele ihre Straße des Lebens.
Eingezwängt zwischen Mietskasernen mit gedunkelten Fassaden
grauenhafter Lieblosigkeit, umtobt von tausend schrillen
Geräuschen vom heißgesengten und schmutzigblank gefahrenen
Asphalt her, wenig Sonne, keine Sicht und sehr viel Staub und Ruß
und widrige Gerüche,- wo bleiben da schon die freundlichen Boten,
die zur inneren Einkehr mahnen?
Gewiß erst kommt das tägliche Brot, es will erkämpft, errungen sein, und nicht alles im Entwicklungsgang der Menschheit kann von Rosen begleitet und von der Unschuld kindlichen Lächelns behütet sein. Es ist das Los des Lebens, das Schicksal vieler Menschen, die Heiterkeit einer natürlichen Umwelt entbehren zu müssen und es dem Stampfen einer mechanisch arbeitenden Maschine gleichzutun.
Und weil dem so ist, hat der Mensch in großen Teilen vergessen, daß es Sterne gibt, und das helle Geflunker der mächtigen Großstadt schaltet den Sternenhimmel allenthalben aus. Und nur noch wie eine verzerrte Karikatur der ewigen Wahrheit, daß in den Sternen sehr viel geschrieben steht, mutet ein Heftchen an, das irgendein Eckensteher für ein paar Pfennige anzubieten wagt. "Die Botschaft Saturns" oder irgendwie ähnlich steht darauf zu lesen, und mehr aus Mitleid denn aus Wißbegierde wird der Verkäufer, die Toren aller Toren ausgenommen, solch ein Heftchen los. Es wandert irgendwo in eine Ecke und hat nicht zum mindesten erreicht, die Sehnsucht nach dem Befragen einer höheren Welt über uns zu wecken. Die Erde ist rund, Eisenbahnen und Ozeandampfer finden überallhin, und das genügt. Und dennoch: mögen Sorge, Gleichmut und Alltagsnot regieren, es glüht dennoch etwas Heiliges in der Brust jedes Menschen. Er war schon immer der Wanderer zwischen zwei Welten, der über die Enge der Erde hinaus nach dem Silber der Sterne tastet, und es bleibt nur übrig, den versteckt glimmenden Funken einer höheren Schau wieder zu wecken. Die Erkenntniswissenschaft der tausend Möglichkeiten hat ihn mit müde gemacht, so daß er schließlich selbst nur noch glauben konnte, ein blind gestoßenes Atom einer ebenso blind wütenden Gesamtwelt zu sein. Und hatte man nicht gerade die Milchstraße in Weiten gerückt, wo jedes Befragen um sie eigentlich zwecklos sein mußte und nicht viel mehr als eine Gelehrtenspielerei übrigblieb?
Gewiß erst kommt das tägliche Brot, es will erkämpft, errungen sein, und nicht alles im Entwicklungsgang der Menschheit kann von Rosen begleitet und von der Unschuld kindlichen Lächelns behütet sein. Es ist das Los des Lebens, das Schicksal vieler Menschen, die Heiterkeit einer natürlichen Umwelt entbehren zu müssen und es dem Stampfen einer mechanisch arbeitenden Maschine gleichzutun.
Und weil dem so ist, hat der Mensch in großen Teilen vergessen, daß es Sterne gibt, und das helle Geflunker der mächtigen Großstadt schaltet den Sternenhimmel allenthalben aus. Und nur noch wie eine verzerrte Karikatur der ewigen Wahrheit, daß in den Sternen sehr viel geschrieben steht, mutet ein Heftchen an, das irgendein Eckensteher für ein paar Pfennige anzubieten wagt. "Die Botschaft Saturns" oder irgendwie ähnlich steht darauf zu lesen, und mehr aus Mitleid denn aus Wißbegierde wird der Verkäufer, die Toren aller Toren ausgenommen, solch ein Heftchen los. Es wandert irgendwo in eine Ecke und hat nicht zum mindesten erreicht, die Sehnsucht nach dem Befragen einer höheren Welt über uns zu wecken. Die Erde ist rund, Eisenbahnen und Ozeandampfer finden überallhin, und das genügt. Und dennoch: mögen Sorge, Gleichmut und Alltagsnot regieren, es glüht dennoch etwas Heiliges in der Brust jedes Menschen. Er war schon immer der Wanderer zwischen zwei Welten, der über die Enge der Erde hinaus nach dem Silber der Sterne tastet, und es bleibt nur übrig, den versteckt glimmenden Funken einer höheren Schau wieder zu wecken. Die Erkenntniswissenschaft der tausend Möglichkeiten hat ihn mit müde gemacht, so daß er schließlich selbst nur noch glauben konnte, ein blind gestoßenes Atom einer ebenso blind wütenden Gesamtwelt zu sein. Und hatte man nicht gerade die Milchstraße in Weiten gerückt, wo jedes Befragen um sie eigentlich zwecklos sein mußte und nicht viel mehr als eine Gelehrtenspielerei übrigblieb?
Nun, wir haben ihr mehr
abgelesen und sie als ein Mitglied im organisch
gegliederten Haushalt des Sonnenreiches erkannt. Wir können
nur jeden dorthin bitten, wo der Sternenhimmel in seiner ganzen
Reinheit erstrahlt und wo das glitzernde Band darin schon
augenscheinlich den Eindruck erweckt, uns zugekehrt, demnach unter und
nicht über den Sternen zu stehen.
Nur etwa 50 Neptunweiten, das heißt die Strecke Sonne-Neptun einhalbhundertmal nebeneinander gelegt, ist das ringartig gestaltete Eisgewölk von uns entfernt. Im großen und ganzen ist ihm noch eine gewisse Geschlossenheit verblieben, und die Eiskörper werden nach wie vor schwerkraftbedingt zusammengehalten. Unendlich viel Eis ist aber im Laufe der Zeit trotz allem schon herausgelockert worden und hat sich zum großen Teil im Weltraum verzettelt.
Was aber in den Anziehungsbereich der Sonne geriet, war diesem verfallen, landete allenthalben noch unaufgelöst im Glutball der Sonne oder brachte auch die Atmosphäre der Erde in Aufruhr. So geschieht es noch heute, und es sind noch genügend Eisreserven aufgespart und aufgetürmt, so daß sich der Strom der vom Weltraumwiderstand abgebremsten und von der nacheilenden Sonne aufgeholten Eisrückbleiber auf weite Sicht hinaus nicht erschöpft.
Nur etwa 50 Neptunweiten, das heißt die Strecke Sonne-Neptun einhalbhundertmal nebeneinander gelegt, ist das ringartig gestaltete Eisgewölk von uns entfernt. Im großen und ganzen ist ihm noch eine gewisse Geschlossenheit verblieben, und die Eiskörper werden nach wie vor schwerkraftbedingt zusammengehalten. Unendlich viel Eis ist aber im Laufe der Zeit trotz allem schon herausgelockert worden und hat sich zum großen Teil im Weltraum verzettelt.
Was aber in den Anziehungsbereich der Sonne geriet, war diesem verfallen, landete allenthalben noch unaufgelöst im Glutball der Sonne oder brachte auch die Atmosphäre der Erde in Aufruhr. So geschieht es noch heute, und es sind noch genügend Eisreserven aufgespart und aufgetürmt, so daß sich der Strom der vom Weltraumwiderstand abgebremsten und von der nacheilenden Sonne aufgeholten Eisrückbleiber auf weite Sicht hinaus nicht erschöpft.
Etwa inmitten des
Milchstraßenringes schwebt unsere Sonne, und da
sie samt dem Ring durchs Weltall stürmt, können abgebremste
Eiskörper nur aus jenem Ringteil in ihren Anziehungs- oder
Schwerebereich geraten, der im Sinne der Flugrichtung vor der Sonne
liegt bzw. ihr vorauseilt. Teilt man den Milchstraßenring
in vier Teilstücke oder Quadranten auf und bezeichnet man den hier
in Frage kommenden Ringteil als vorderen Quadranten, so leuchtet ohne
weiteres ein, daß von den seitlich der Sonne gelegenen Quadranten
allenfalls nur wenig und von dem hinteren Quadranten überhaupt
kein Eis zu unserem Tagesgestirn gelangen kann. Was hier
herausgelockert wurde und wird, geht in den weiten Weltraum ein.
Es speist also im großen und ganzen nur der vordere
Milchstraßenquadrant unser engeres Sonnenreich mit Eis, und die
hier herausgelockerten Körper haben sehr verschiedene
Größen, können nur wenige, aber auch tausend Meter im
Durchmesser betragen.
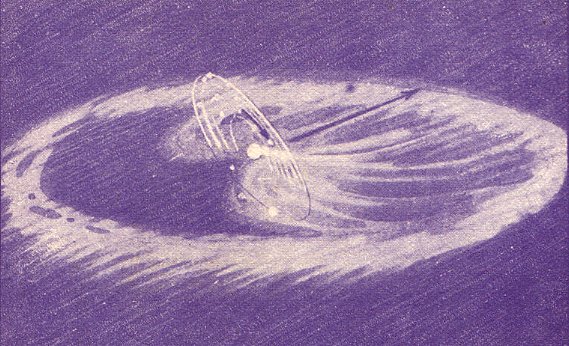
(Bildquelle: Buch
"Welteis und Weltentwicklung" von H.W. Behm, 1926)
Unsere Sonnenwelt und Grobeiszufluß aus der ringförmigen (hier aus Raumgründen verengert gezeichnet) Eismilchstraße
(Zeichnung Alfred Hörbiger).
Unsere Sonnenwelt und Grobeiszufluß aus der ringförmigen (hier aus Raumgründen verengert gezeichnet) Eismilchstraße
(Zeichnung Alfred Hörbiger).
Diese verschiedenen
Größenverhältnisse sind
wohlverstanden (abgesehen von noch anderen Faktoren) von sehr
wesentlicher Bedeutung für die Wanderwege kosmischen Eises.
Die von der Schwerkraft der Sonne erfaßten Eiskörper flitzen
nicht irgendwie planlos im Raum umher, sondern unterliegen
Gesetzmäßigkeiten, die darin ankern, daß
Anziehungswirkung (Gravitation oder Schwerkraft) und
Körpergröße in einem bestimmten Verhältnis
zueinander stehen. Demzufolge hat jeder Eiskörper eine
seiner Größe entsprechende mehr oder minder gekrümmte
Fallbahn. Größere und hauptsächlich
mittelgroße Eiskörper müssen die Sonne auf jener Seite
treffen, die der Flugrichtung, oder wie man auch sagen kann, dem
Flugzielpunkt zugekehrt ist, indessen Kleinkörper vorwiegend auf
der entgegengesetzten Sonnenseite landen werden. Man kann am
besten von zwei Eiskörperschwärmen bzw. von zwei mit
Eiskörpern reich besetzten Raumzonen sprechen, deren Enden in die
Sonne münden. Weil aber diese Schwarmzonen sich der Sonne zu
naturnotwendig immer mehr verengern müssen, so können wir sie
(um die räumliche Vorstellung zu erleichtern) gleichsam mit dicken
Wänden eines Trichtergebildes vergleichen, das, sich ständig
verjüngend, die Sonne erreicht. Der Innenraum dieses
"Eistrichters" wäre allenthalben eisfrei.
Würden
Milchstraßenring, Sonne und Planeten noch insgesamt
in einer Ebene (Flugbahnebene) liegen, so würden vor allem unsere
Planeten zugleich auch ständig in Schwarmzonen von Eiskörpern
kreisen. Wir deuteten aber schon an, daß die Planetenbahnen
bereits stark aufgeneigt zu dieser Ebene verlaufen, und daraus
resultiert, daß sie bei ihrer Wanderung um die Sonne und im
Hinblick auf ihre Sonnennähe Eiskörperschwarmzonen
während eines jeweiligen Sonnenumlaufes nur zeitweise
durchkreuzen. Ein Planet, und nicht zuletzt unsere Erde, wird
also mit anderen Worten (um im Vergleichsbilde des "Eistrichters" zu
bleiben) die eine "Trichterwand" zu gegebener Zeit erreichen, das
heißt den Eisschwarm durchfurchen, dann den allenthalben
eisfreien "Trichterinnenraum" und schließlich die andere
"Trichterwand" (Eisschwarm) durchmessen. Aber selbst die
elementarste Darstellung des Eiszuzugs zur Sonne ist damit noch nicht
erschöpft.
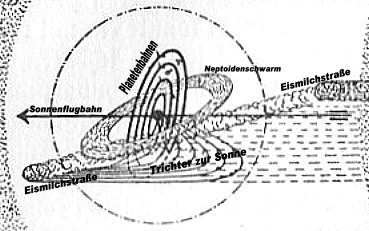
(Bildquelle und -text:
Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)
Die Beschriftung der obigen Zeichnung wurde zur einfacheren Erklärung, von den Mitarbeitern der WFG, hinzugefügt.
Wir sehen die außerhalb mit uns schwebende Eismilchstraße als einen Eiskörperring und innerhalb der Sonnenschwere den transneptunischen Neptoidenschwarm schematisch angedeutet. Die infolge des Weltraumwiderstandes aus der Eismilchstraße zurückbleibenden kleinsten Eiskörper werden, soweit sie in das Sonnenschweregebiet eindringen, zirkuszeltdachartig zusammengerafft zu einem Bahngebilde, das dann trichterförmig in die Sonne mündet. Dieser Eisschleiertrichter sehen wir im unteren Bild vergrößert herausgehoben. (Zeichnung nach Hörbigers).
Die Beschriftung der obigen Zeichnung wurde zur einfacheren Erklärung, von den Mitarbeitern der WFG, hinzugefügt.
Wir sehen die außerhalb mit uns schwebende Eismilchstraße als einen Eiskörperring und innerhalb der Sonnenschwere den transneptunischen Neptoidenschwarm schematisch angedeutet. Die infolge des Weltraumwiderstandes aus der Eismilchstraße zurückbleibenden kleinsten Eiskörper werden, soweit sie in das Sonnenschweregebiet eindringen, zirkuszeltdachartig zusammengerafft zu einem Bahngebilde, das dann trichterförmig in die Sonne mündet. Dieser Eisschleiertrichter sehen wir im unteren Bild vergrößert herausgehoben. (Zeichnung nach Hörbigers).
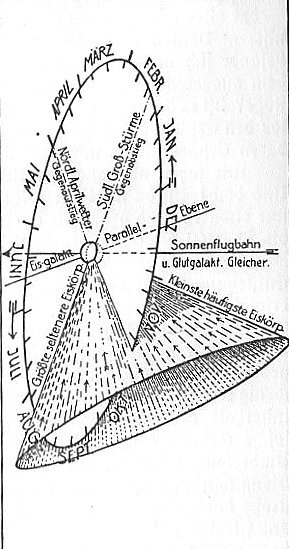
(Bildquelle und -text:
Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)
Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)
Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)
Unsere Planeten müssen
(zumal wenn sie sich
Eiskörperschwärmen nähern) selbst wieder in mehr oder
minder hohem Grade die Fallbahnen von Eiskörpern stören,
ablenken, sozusagen in andere Geleise drängen, so daß sich
dadurch auch die Ankunftszeiten bei der Sonne verschieben.
Bestimmte Eiskörper werden bei der Anwirkung von
Großplaneten mitunter geradezu aus dem Geleise gerissen,
verfehlen die Sonne, bzw. erreichen sie erst weit später nach
vielen spiralelliptischen Umläufen. Die Sonne wird dann
zeitweise weniger Eis empfangen, doch umgekehrt kann sich der
Planeteneinfluß wieder in einer beschleunigten Zufuhr von
kosmischen Eis zur Sonne hin geltend machen.
Während unser ideal konstruiertes "Trichtergebilde" gleichsam nur die Ankunftsbahnen ungestörter Eiskörper charakterisiert, die der Sonne örtlich bestimmt begrenzt zufallen müssen, führen die Planetenstörungen bei abgeänderten oder gestörten Fallbahnen auch zu entsprechend abgeänderten Einschußorten. Diese liegen, gesetzmäßig erfaßt, den Einschußorten ungestörter Eiskörper genau gegenüber, so daß man allenfalls von der Herausbildung eines "Gegentrichters" sprechen kann, der seinem Wesen nach dem oben beschriebenen "Eistrichter" ähnelt, auch von Planeten entsprechend durchfahren werden kann, der aber aus guten Gründen doch mehr labil ist. Man halte sich vor Augen, daß das unaufhörlich anflutende Milchstraßeneis je nach der gegebenen Stellung der Planeten zueinander und zu dem Eiszuzug an sich in außerordentlich verschiedener Weise gestört werden kann, daß aber wieder angesichts der verschiedenen Umlaufszeiten der Planeten solche Störungen nie ganz ausgeschaltet sind. Schon hatten wir diese Planeten als Wächter und Schutzgeister der Erde gegen zu starke Eisbeschickung kennengelernt, nunmehr entpuppen sie sich uns gleichsam als gigantische Weichensteller im Sonnenreich, und es mag dem Leser dämmern, welche Mühe und Arbeit es kostete, das gesamte Weichenstellwerk mit seinen tausend und aber tausend Möglichkeiten und doch wieder rhythmisch geordneten Periodizitäten und Wiederholungen zu durchschauen.
Während unser ideal konstruiertes "Trichtergebilde" gleichsam nur die Ankunftsbahnen ungestörter Eiskörper charakterisiert, die der Sonne örtlich bestimmt begrenzt zufallen müssen, führen die Planetenstörungen bei abgeänderten oder gestörten Fallbahnen auch zu entsprechend abgeänderten Einschußorten. Diese liegen, gesetzmäßig erfaßt, den Einschußorten ungestörter Eiskörper genau gegenüber, so daß man allenfalls von der Herausbildung eines "Gegentrichters" sprechen kann, der seinem Wesen nach dem oben beschriebenen "Eistrichter" ähnelt, auch von Planeten entsprechend durchfahren werden kann, der aber aus guten Gründen doch mehr labil ist. Man halte sich vor Augen, daß das unaufhörlich anflutende Milchstraßeneis je nach der gegebenen Stellung der Planeten zueinander und zu dem Eiszuzug an sich in außerordentlich verschiedener Weise gestört werden kann, daß aber wieder angesichts der verschiedenen Umlaufszeiten der Planeten solche Störungen nie ganz ausgeschaltet sind. Schon hatten wir diese Planeten als Wächter und Schutzgeister der Erde gegen zu starke Eisbeschickung kennengelernt, nunmehr entpuppen sie sich uns gleichsam als gigantische Weichensteller im Sonnenreich, und es mag dem Leser dämmern, welche Mühe und Arbeit es kostete, das gesamte Weichenstellwerk mit seinen tausend und aber tausend Möglichkeiten und doch wieder rhythmisch geordneten Periodizitäten und Wiederholungen zu durchschauen.
Die für ungestörte
und gestörte Eiskörper in Frage
kommenden Einschußorte decken sich nun allen Berechnungen
gemäß mit den bevorzugten Lagen von Sonnenflecken auf
unserem Tagesgestirn, und damit ist ein Rätsel geklärt, das,
wie gezeigt wurde, bisher unlösbar schien. Haben uns
Eiskörper die Natur der Sonnenflecken erraten lassen, so
entschleiert ihre fallbahnbedingte Angliederung gleichsam die
Geographie der Flecken. Ebensowohl will aber auch das Problem
ihrer Periodizität nicht mehr problematisch erscheinen, denn diese
wird aus der Weichenstellerarbeit der Planeten verständlich, die
den Eisstrom bald stoppen, bald beschleunigen, was eine bald schwach
oder bald stark befleckte Sonne zur Folge hat. Und Jupiter ist
der Hauptdirigent hierbei, der bei seiner
verhältnismäßigen Sonnennähe und seiner Masse
notwendig am meisten stören muß!
Jupiter ist unter allen
Planeten bei weitem der größte und
wird zuweilen im astronomischen Schrifttum gar als Nebensonne unseres
Systems bezeichnet, obwohl hier an eine sonnengeartete Natur nicht zu
denken ist. Eine Berechnung der durch seine Anziehungskraft
gegebenen Störewirkung läßt erkennen, daß er im
verminderten Maß auch dann noch stört, wenn er sich auf
einem abseits der Eiskörperzonen befindlichen Bahnabschnitte um
die Sonne befindet. Jupiters Umlaufszeit beträgt 11,86
Erdenjahre, was sich bestimmt nicht zufällig mit der ebenfalls
über elf Jahre währenden Hauptperiode im rhythmischen Gang
der Sonnenbefleckung deckt! Aber wir haben recht eigentlich den
Zufall schon ausgeschaltet und haben keine sonderliche Mühe mehr,
auch diesen "Zusammenklang" zu verstehen.
Sobald sich Jupiter dem "Eistrichter" nähert, wirkt er in hohem Grade auf die zur Sonne strömenden Eiskörper ein, reißt sie buchstäblich aus dem Geleise, so daß diese die Sonne verfehlen bzw. sie erst weit später als unter normalen Verhältnissen erreichen. Die Sonne und im gewissen Sinne auch die Erde stehen jetzt im Zeichen eines verminderten Eiseinfanges, und auf unserem Tagesgestirn selbst prägt sich das als ausgesprochenes Sonnenfleckenminimum aus. Das ändert sich erst wieder, wenn Jupiter auf seiner Bahn schon ein geraumes Stück weitergewandert ist, dem "Eistrichter" absteigend, unterfahrend und aufsteigend begegnet. Zunächst wirkt seine Zugkraft gleichgerichtet der Schwerewirkung der Sonne. Die Ablenkung der Eiskörper schwindet, und diese erfahren vielmehr eine Beschleunigung. Da unser Planet vornehmlich auf zahlreiche kleinere Eiskörper fallbeschleunigend einwirkt, werden sich diese besonders dicht zur Sonne hindrängen und in diese einschießen. Das Resultat ist uns in einer stark vermehrten Zahl von kleinen Sonnenflecken sichtbar, wobei allerdings bei allen derartigen Betrachtungen der Faktor der Fallzeiten der Eiskörper mit berücksichtigt werden muß, demzufolge der eigentliche Einschuß in die Sonne (und damit wieder das Auftauchen von Sonnenflecken) zeitlich erst viel später (2 1/2 bis 3 Jahre) erfolgen kann. Wiederum vermag Jupiter bestimmte seltenere große Körper nicht fallbeschleunigend, sondern fallablenkend zu dirigieren. Im allgemeinen werden seine den Eisozean entfernteren Stellungen am Himmel aber dazu beitragen, eine mittelstarke Befleckung der Sonne zu belassen.
Nicht im entferntesten kann hier daran gedacht werden, den Verlauf eines einmaligen Umschwunges Jupiters um die Sonne mit allen seinen etappenweise sehr komplizierten Ablenkungs-, Fallbeschleunigungs- und Eiskörperraffungsmöglichkeiten darzustellen. Es muß abschließend die Feststellung genügen, daß Jupiter die Fleckentätigkeit der Sonne wesentlich bestimmt und somit auch den Takt für zyklisch-periodische Erscheinungen auf Erden schlägt, die von der Fleckenwirkung abhängig sind. Infolge seiner Masse besitzt Jupiter eben eine erheblich größere Schwerewirkung als etwa der ihm benachbarte Saturn oder gar die noch kleineren Planeten Uranus und Neptun.
Sobald sich Jupiter dem "Eistrichter" nähert, wirkt er in hohem Grade auf die zur Sonne strömenden Eiskörper ein, reißt sie buchstäblich aus dem Geleise, so daß diese die Sonne verfehlen bzw. sie erst weit später als unter normalen Verhältnissen erreichen. Die Sonne und im gewissen Sinne auch die Erde stehen jetzt im Zeichen eines verminderten Eiseinfanges, und auf unserem Tagesgestirn selbst prägt sich das als ausgesprochenes Sonnenfleckenminimum aus. Das ändert sich erst wieder, wenn Jupiter auf seiner Bahn schon ein geraumes Stück weitergewandert ist, dem "Eistrichter" absteigend, unterfahrend und aufsteigend begegnet. Zunächst wirkt seine Zugkraft gleichgerichtet der Schwerewirkung der Sonne. Die Ablenkung der Eiskörper schwindet, und diese erfahren vielmehr eine Beschleunigung. Da unser Planet vornehmlich auf zahlreiche kleinere Eiskörper fallbeschleunigend einwirkt, werden sich diese besonders dicht zur Sonne hindrängen und in diese einschießen. Das Resultat ist uns in einer stark vermehrten Zahl von kleinen Sonnenflecken sichtbar, wobei allerdings bei allen derartigen Betrachtungen der Faktor der Fallzeiten der Eiskörper mit berücksichtigt werden muß, demzufolge der eigentliche Einschuß in die Sonne (und damit wieder das Auftauchen von Sonnenflecken) zeitlich erst viel später (2 1/2 bis 3 Jahre) erfolgen kann. Wiederum vermag Jupiter bestimmte seltenere große Körper nicht fallbeschleunigend, sondern fallablenkend zu dirigieren. Im allgemeinen werden seine den Eisozean entfernteren Stellungen am Himmel aber dazu beitragen, eine mittelstarke Befleckung der Sonne zu belassen.
Nicht im entferntesten kann hier daran gedacht werden, den Verlauf eines einmaligen Umschwunges Jupiters um die Sonne mit allen seinen etappenweise sehr komplizierten Ablenkungs-, Fallbeschleunigungs- und Eiskörperraffungsmöglichkeiten darzustellen. Es muß abschließend die Feststellung genügen, daß Jupiter die Fleckentätigkeit der Sonne wesentlich bestimmt und somit auch den Takt für zyklisch-periodische Erscheinungen auf Erden schlägt, die von der Fleckenwirkung abhängig sind. Infolge seiner Masse besitzt Jupiter eben eine erheblich größere Schwerewirkung als etwa der ihm benachbarte Saturn oder gar die noch kleineren Planeten Uranus und Neptun.
Wir haben auch zu
berücksichtigen, daß die Umlaufszeiten der
Planeten verschieden sind, Neptun beispielsweise angenähert 165
Erdenjahre für einen Sonnenumlauf benötigt, so daß er
Jahrzehnte hindurch kaum merklich stört, daß er aber, sobald
seine Schwerewirkung sich Eiskörpern gegenüber mehr und mehr
geltend macht, deren Wanderwege zur Sonne entsprechend
beeinflußt. Uranus vermag auch noch erhebliche Teile seiner
Bahn zu durchlaufen, ohne die wandernden
Milchstraßeneisblöcke zu behelligen, bei Saturn ist das
schon nicht mehr der Fall. Endlich muß es auch Zeiten
geben, da sich Störungen bestimmter Planeten je nach der Bahnlage,
die sie zueinander einnehmen, aufsummen. Befinden sich
beispielsweise Jupiter und Saturn gemeinsam im Sternbild
Wassermann-Fische, so beschleunigen sie den Eisanfall zur Sonne mit
besonderer Gewalt, stehen sie dagegen im Stier oder Skorpion, so
bremsen sie die Eisrückbleiber der Milchstraße stark ab,
verzetteln sie rund um die Sonne, was sich durch ziemliche
Fleckenreinheit der Sonne kundgeben muß. So läßt
sich in Anbetracht der verschiedenen Umlaufszeiten der Planeten
gewissermaßen ein generelles Störungssystem ausarbeiten, was
zum Teil schon geschehen ist, das aber erschöpfend erst in
Hunderten von Diagrammen festgelegt werden kann, die sich auf
Jahrhunderte ausdehnen.
So viel läßt sich schon sagen, daß aus allen diesen Verhältnissen sich auch erklären läßt, warum die erkannte und durch Jupiter hauptsächlich betonte Hauptperiode im Rhythmus der Sonnenbefleckung Unregelmäßigkeiten aufweist, warum Verschiebungen, Überschneidungen und dergleichen mehr festzustellen sind. Damit zusammenhängend wird es auch der Forschung in Zukunft leichter fallen, System und Klärung in gewisse und zweifellos richtig erkannte Hauptwetterperioden der Erde hineinzutragen, zumal wir folgern werden, daß die Gesamttätigkeit der Sonne die allgemeine Wetterlage der Erde bestimmt.
Es gab Zeiten, da die Menschheit im astrologischen Ahnen befangen zum mindesten verspürte, daß es bei den Sternen liege, ob Stürme das Meer aufpeitschen, Riesenluftwirbel blühende Fluren vernichten oder Flüsse periodisch steigen! Eine wissenschaftliche, aus der Astrologie selbst wieder geborene Nachfolgezeit hat das alles grundsätzlich verneint und verneint es im allgemeinen heute noch.
Aber, so möchten wir fragen, sollte es nicht so sein, daß neuzeitliches Forschen mehr und mehr nach den noch ungeordnet sprudelnden Quellen uralten Weistums greifen muß, um mit den heutigen Forschungsmitteln hier klärend weiterzukommen, um überhaupt noch erkenntniskritisch arbeiten zu können?
Wenn Gelehrte zugeben, daß sich die Befleckung der Sonne im Baumstamm widerspiegelt, daß bestimmte Befleckung Polarlichter, magnetische Variationen oder gar Zirruswolken (!) am irdischen Himmel zeitigt, und wenn man dann nur noch hinzuzufügen braucht, daß Planeten hier dirigierend tätig sind - werden die dunklen und heiteren Lose irdischen Schicksals wirklich nur "hienieden" geworfen?
So viel läßt sich schon sagen, daß aus allen diesen Verhältnissen sich auch erklären läßt, warum die erkannte und durch Jupiter hauptsächlich betonte Hauptperiode im Rhythmus der Sonnenbefleckung Unregelmäßigkeiten aufweist, warum Verschiebungen, Überschneidungen und dergleichen mehr festzustellen sind. Damit zusammenhängend wird es auch der Forschung in Zukunft leichter fallen, System und Klärung in gewisse und zweifellos richtig erkannte Hauptwetterperioden der Erde hineinzutragen, zumal wir folgern werden, daß die Gesamttätigkeit der Sonne die allgemeine Wetterlage der Erde bestimmt.
Es gab Zeiten, da die Menschheit im astrologischen Ahnen befangen zum mindesten verspürte, daß es bei den Sternen liege, ob Stürme das Meer aufpeitschen, Riesenluftwirbel blühende Fluren vernichten oder Flüsse periodisch steigen! Eine wissenschaftliche, aus der Astrologie selbst wieder geborene Nachfolgezeit hat das alles grundsätzlich verneint und verneint es im allgemeinen heute noch.
Aber, so möchten wir fragen, sollte es nicht so sein, daß neuzeitliches Forschen mehr und mehr nach den noch ungeordnet sprudelnden Quellen uralten Weistums greifen muß, um mit den heutigen Forschungsmitteln hier klärend weiterzukommen, um überhaupt noch erkenntniskritisch arbeiten zu können?
Wenn Gelehrte zugeben, daß sich die Befleckung der Sonne im Baumstamm widerspiegelt, daß bestimmte Befleckung Polarlichter, magnetische Variationen oder gar Zirruswolken (!) am irdischen Himmel zeitigt, und wenn man dann nur noch hinzuzufügen braucht, daß Planeten hier dirigierend tätig sind - werden die dunklen und heiteren Lose irdischen Schicksals wirklich nur "hienieden" geworfen?
Aus unserer Darstellung der
Eiskörperfallbahnen geht hervor,
daß unsere Erde während ihres jährlichen Umschwunges um
die Sonne solche mit Eiskörpern besonders besetzte Gebiete
mehrmals durchfahren muß. Sie wandert einmal durch die
beiden "Wände" des "Eistrichters" hindurch, was sich etwa von
Mitte August bis Anfang November ereignet. Von Februar bis April
hatte sie bereits die zwei "Wände" des der Vorstellung zuliebe
idealisiert entworfenen "Gegentrichters" durchlaufen. Daß
auch die übrigen Monate nicht ganz frei von nahe vorbeiziehenden
Eiskörpern sind, läßt sich ebenfalls aus den
Störewirkungen der Planeten wie auch der
Eiskörpergröße ableiten, und es bleibt einzusehen,
daß dieses hier nur grobschlächtig gezeichnete Bild im
Wechsel der Jahre variieren muß. Jedenfalls hat die Erde
bald mehr, bald minder Gelegenheit, Eiskörper selbst einzufangen
und an sich zu reißen.
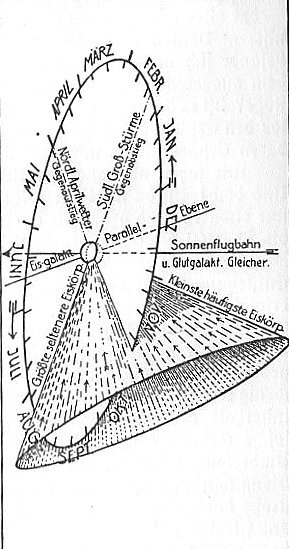
(Bildquelle und -text:
Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)
Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)
Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)
Sobald wir nach diesen
notwendig weit ausholenden Vorbereitungen das
Geschehen der zur Erde stürzenden Eiskörper erst schildern,
wird es sich zeigen, wie wesentlich eine Kenntnis der hier waltenden
Zusammenhänge ist. Es wird uns der Beweis gelingen,
gewaltige Sturmkatastrophen und anderes mehr auf eine starke
Eisanreicherung unseres Planeten zurückführen und eine
Häufigkeit von Sternschnuppenfällen damit in Parallele
bringen zu können. Haben wir doch bereits ausgesprochen,
daß die durch das Sonnenreich ziehenden Eiskörper nichts
anderes als Sternschnuppen sind. Das führt im Augenblick zu
der berechtigten Vermutung, daß Sternschnuppenbeobachtungen
unsere Ableitung des Eiskörperverhaltens bestätigen
müßten! Wie steht es damit?
Als der treffliche J.J. von
Littrow noch lebte, dessen nachgelassenes
Werk von den Wundern des Himmels ständig neue gelehrte Bearbeiter
findet, hielt er es zum mindesten für "sehr sonderbar", daß
sich bestimmte Sternschnuppenschwärme ("Laurentiusstrom" im August
und "Leoniden" im November) noch in jedem Jahr regelmäßig
einstellen. Er glaubte, die Schwärme als Sandwolke auffassen
zu dürfen, denen wir jährlich "nahe um dieselbe Zeit begegnen
und vielleicht sogar durch den Rand derselben mit unserem großen
Erdenschiff durchfahren". Das war zu einer Zeit, als sich noch
weniger die Astronomen, sondern vorherrschend die Wetterforscher der
"nebensächlichen" Sternschnuppen erbarmten und die Schnuppen noch
allenthalben für Produkte der irdischen Atmosphäre hielten.
Und es will wie eine eigenartige Verkettung der Dinge erscheinen, daß gerade derart im Irrtum befangene Meteorologen, wie beispielsweise der Franzose Coulvier-Gravier, sehr wertvolles Beobachtungsmaterial hinterlassen haben, das der Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) in gewissen Dingen nicht unbequem erscheinen kann. Unterzieht man sich einmal der Mühe, diesbezügliche Werke aus der Mitte des verflossenen Jahrhunderts zu studieren, so ist man über die fabelhafte Beobachtungsgabe und Beobachtungstechnik ihrer Verfasser nicht wenig erstaunt. Doch wir sind älter geworden, die Sternforschung hat inzwischen die Schnuppen mit Beschlag belegt und in das ferne Reich des Himmels versetzt, wohin aber wiederum der Wetterforscher heute schauen sollte, um sein wetterlaunisches Handwerk meistern zu können.
Wohl lehrt die gegenwärtige Sternforschung, daß es solche und wiederum solche Schnuppen gibt. Sie unterscheidet Größenklassen und macht auch noch sonstige Unterschiede. Die einen sollen alteingesessene Bürger des Sonnenreichs sein, die anderen als mehr unstete Wanderer dem viel weiteren Weltenraum entstammen. Das würde sich mit der Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) insofern decken, als Meteore in ihrem Sinne (wie das schon erwähnt wurde) bei der Sonnenreichentstehung vorausgeeiltes Kleinglutzeug sind, Sternschnuppen dagegen als Eiskörper der Eismilchstraße entstammen. Aber hinsichtlich einer derartigen stofflichen Unterscheidung gehen die Ansichten heute noch auseinander. Die Forschung arbeitet noch heute mit einem Meteorbegriff, dem alles untergeordnet und eingegliedert erscheint, und sie spricht als Feuerkugeln oder Meteore im engeren Sinne Körper an, die vom Weltraum her in die Erdatmosphäre eindringen, die dort durch den Luftwiderstand zur Auflösung gebracht werden, oder auch bei hinreichend großer Masse zur Erdoberfläche herabgelangen können. Es ist auch allgemein bekannt, daß solche "Weltensplitter" die Erde dauernd bestürmen und zuweilen über eine verhältnismäßig große Körpermasse verfügen.
Und es will wie eine eigenartige Verkettung der Dinge erscheinen, daß gerade derart im Irrtum befangene Meteorologen, wie beispielsweise der Franzose Coulvier-Gravier, sehr wertvolles Beobachtungsmaterial hinterlassen haben, das der Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) in gewissen Dingen nicht unbequem erscheinen kann. Unterzieht man sich einmal der Mühe, diesbezügliche Werke aus der Mitte des verflossenen Jahrhunderts zu studieren, so ist man über die fabelhafte Beobachtungsgabe und Beobachtungstechnik ihrer Verfasser nicht wenig erstaunt. Doch wir sind älter geworden, die Sternforschung hat inzwischen die Schnuppen mit Beschlag belegt und in das ferne Reich des Himmels versetzt, wohin aber wiederum der Wetterforscher heute schauen sollte, um sein wetterlaunisches Handwerk meistern zu können.
Wohl lehrt die gegenwärtige Sternforschung, daß es solche und wiederum solche Schnuppen gibt. Sie unterscheidet Größenklassen und macht auch noch sonstige Unterschiede. Die einen sollen alteingesessene Bürger des Sonnenreichs sein, die anderen als mehr unstete Wanderer dem viel weiteren Weltenraum entstammen. Das würde sich mit der Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) insofern decken, als Meteore in ihrem Sinne (wie das schon erwähnt wurde) bei der Sonnenreichentstehung vorausgeeiltes Kleinglutzeug sind, Sternschnuppen dagegen als Eiskörper der Eismilchstraße entstammen. Aber hinsichtlich einer derartigen stofflichen Unterscheidung gehen die Ansichten heute noch auseinander. Die Forschung arbeitet noch heute mit einem Meteorbegriff, dem alles untergeordnet und eingegliedert erscheint, und sie spricht als Feuerkugeln oder Meteore im engeren Sinne Körper an, die vom Weltraum her in die Erdatmosphäre eindringen, die dort durch den Luftwiderstand zur Auflösung gebracht werden, oder auch bei hinreichend großer Masse zur Erdoberfläche herabgelangen können. Es ist auch allgemein bekannt, daß solche "Weltensplitter" die Erde dauernd bestürmen und zuweilen über eine verhältnismäßig große Körpermasse verfügen.
Es sei in diesem Zusammenhang
an den ungewöhnlich großen
Meteorblock erinnert, der in vorgeschichtlicher Zeit einmal im
westlichen Nordamerika (Arizona) niederging, und der einen
kraterähnlichen Ausschlag von 1000 Meter Durchmesser als
Erinnerung hinterließ. Noch liegen vereinzelte
Metallbruchstücke viele Kilometer weit um den eigentlichen Krater
verstreut, was aber irgendwie zu greifen war, ist seines Wertes wegen
längst verschleppt und verschachert worden.
Ein Neunzentnerstück davon hatte das Nationalmuseum zu Washington in letzter Minute zu retten verstanden. Das metallene Hauptstück davon steckt noch tief unter dem Kratergrund verborgen, und alle bisher unternommenen Versuche, diesen Schatz heraufzubefördern, sind gescheitert. Schätzungsweise sollen allein 90 000 Kilogramm Platin und Iridium im Erdreich lagern, was einer Edelmetallmenge von siebenfachen Werte des Goldes entspricht und die ein Zwanzigfaches von der jährlichen Goldausbeute der ganzen Erde beträgt. Vor etlichen Jahren wurden in einem Geländestreifen in Südkarolina Kratergebilde bis zu drei Kilometer Durchmesser entdeckt, die ebenfalls für Meteorfälle zeugen. Am Finke River im mittleren Australien liegt ein ähnliches Trichtergebilde, das den vergnüglichen Namen "Double Punsh Bowl" (doppelter Punschnapf) trägt. Zahlreiche Krater bis zu 200 Meter Durchmesser sind als Aufschlagsstellen von Meteorbruchstücken erkannt worden, die beim Niederbruch Sandgestein zum Schmelzen brachten und ganze Gesteinsschichten in Falten legten. Das Schicksal meint es wohl gnädig mit uns, daß es uns im Laufe der Zeiten nicht allzuoft mit derartigen Gewalten beschickt, die selbst bei viel mäßigerer Größe schon genügten, eine Weltstadt in Trümmer zu legen. Im allgemeinen fallen nur verhältnismäßig kleine steineisen- und glasartige Meteore der Erde zu, und nur verhältnismäßig selten ist ein Meteorkörper massig genug, um die ihn zersetzende Wirkung des Luftwiderstandes zu überdauern und nach dem Aufglühen überhaupt noch den Erdboden zu erreichen.
Ein Neunzentnerstück davon hatte das Nationalmuseum zu Washington in letzter Minute zu retten verstanden. Das metallene Hauptstück davon steckt noch tief unter dem Kratergrund verborgen, und alle bisher unternommenen Versuche, diesen Schatz heraufzubefördern, sind gescheitert. Schätzungsweise sollen allein 90 000 Kilogramm Platin und Iridium im Erdreich lagern, was einer Edelmetallmenge von siebenfachen Werte des Goldes entspricht und die ein Zwanzigfaches von der jährlichen Goldausbeute der ganzen Erde beträgt. Vor etlichen Jahren wurden in einem Geländestreifen in Südkarolina Kratergebilde bis zu drei Kilometer Durchmesser entdeckt, die ebenfalls für Meteorfälle zeugen. Am Finke River im mittleren Australien liegt ein ähnliches Trichtergebilde, das den vergnüglichen Namen "Double Punsh Bowl" (doppelter Punschnapf) trägt. Zahlreiche Krater bis zu 200 Meter Durchmesser sind als Aufschlagsstellen von Meteorbruchstücken erkannt worden, die beim Niederbruch Sandgestein zum Schmelzen brachten und ganze Gesteinsschichten in Falten legten. Das Schicksal meint es wohl gnädig mit uns, daß es uns im Laufe der Zeiten nicht allzuoft mit derartigen Gewalten beschickt, die selbst bei viel mäßigerer Größe schon genügten, eine Weltstadt in Trümmer zu legen. Im allgemeinen fallen nur verhältnismäßig kleine steineisen- und glasartige Meteore der Erde zu, und nur verhältnismäßig selten ist ein Meteorkörper massig genug, um die ihn zersetzende Wirkung des Luftwiderstandes zu überdauern und nach dem Aufglühen überhaupt noch den Erdboden zu erreichen.
Damit ist aber auch der
Unterschied zwischen Meteoren und
Sternschnuppen gekennzeichnet. Meteore zerprasseln und
verglühen beim Eintritt in die Lufthülle, indessen
Sternschnuppen als im reflektierten Sonnenlicht leuchtende
Eiskörper ganz andere Erscheinungen auf Erden auslösen
müssen, wenn sie die Erde abfängt und ihren Weiterflug zur
Sonne hin unterbindet. Dieser Unterschied offenbart sich aber
schon dem freien Auge. Echte Sternschnuppen oder, wie wir jetzt
besser sagen können, Eisschnuppen erscheinen stets nur rein
weiß oder lassen allenfalls einen Stich ins Bläuliche oder
Gelbliche erkennen, indessen alle im Luftraum aufleuchtenden
Feuerkugeln in den grellen Reinfarben des Regenbogens, und demzufolge
bald rot, grün, blau usw. erstrahlen können. Ein
derartiger Wechsel der Farbe ist bei Eisschnuppen während des nur
Sekunden dauernden Fluges nicht zu erkennen.
Nehmen wir die Höhe der Atmosphäre nach zuverlässiger Schätzung mit etwa 600 Kilometer an, wobei die letzten 100 Kilometer allenthalben den Übergang zum Weltraum kennzeichnen, so ist noch jede Sicht eines Beobachters erheblich eingeschränkt, was für die Beobachtung der in Erdnähe vorbeihuschenden Kleinkörper nicht bedeutungslos ist. Die Verminderung der Sichtbarkeit hängt damit zusammen, daß die Luft in unmittelbarer Nähe der Erdoberfläche nicht mehr rein und folglich durchsichtig genug ist. Das führt zu einem gewissermaßen trichterartig gestalteten Schauraum als Produkt des ihn umlagernden Dunstes.
Je nach dem Standort eines Beobachters, wie etwa in Industriegebieten oder Großstadtnähe, kann der nutzbare Schauraum weiterhin vermindert sein.
Setzen wir nun - im Sinne der Sternforschung gesehen! - die höchste Aufleuchthöhe für Schnuppen mit 150 Kilometer an, so ergibt eine Berechnung des Durchmessers und der Oberfläche des überblickten Gebietes, daß ein Beobachter bei uns durchschnittlich nur 1/10 000 der 150 Kilometer um den Erdball geschlagenen Kugelfläche überblickt. Nun ist der Jahresdurchschnitt der von diesem Beobachter allein schon bemerkten Schnuppen erstaunlich groß und muß in Wirklichkeit ein Vieltausendfaches für den ganzen Erdball gerechnet ergeben, selbst wenn wir berücksichtigen, daß Schnuppen die Erde nicht überall gleichmäßig umstürmen.
Wenn aber (und so muß man zwangsläufig folgern) die Sternschnuppen wirklich meteorartige Körper wären, deren Eindringen in die Atmosphäre erst ihr Sichtbarwerden (sei es durch Luftreibung, sei es durch Leuchteffekte der vor ihnen hergeschobenen Luft) verbürgt, dann müßte folgendes Tatsache sein:
Bei dem beobachtungsgemäß erheblichen Schnuppenfall müßte sich der tägliche Massenzuwachs der Erde in einer merklich wahrnehmbaren Veränderung der Tageslänge und einer verhältnismäßig sehr wesentlichen Beschleunigung des Mondumlaufes bemerkbar gemacht haben. Die Erde müßte wohlverstanden einen jährlich Millionen Tonnen betragenden Massenzuwachs erhalten haben und dauernd erhalten.
Um aus dieser Verlegenheit herauszukommen, haben viele Himmelsforscher von jeher auf kleine Schnuppenmassen hingearbeitet. Sie haben sogar nachzuweisen versucht, daß Schnuppenkörper von nur 1/10 Gramm Gewicht aufzublinken vermögen. Daß dies technisch-physikalisch unmöglich ist und nur vom grünen Tisch aus sich "rechnerisch" gestalten läßt, steht außer Frage. Derart winzige Körper können in verhältnismäßig großer Entfernung unmöglich Leuchteffekte erzeugen, die erfaß- und wahrnehmbar sind, auch wenn wir zugeben wollten, daß sie aus Metall bestünden. Wir benötigen derart kleine Schnuppen um so weniger, weil es sich eben um verhältnismäßig viel größere Eiskörper bei ihnen handelt. Demzufolge sind sie auch noch als jenseits der Lufthülle vorbeiziehende Körper der Beobachtung zugänglich, und ohne Zweifel ziehen die meisten der sichtbar werdenden Eisschnuppen an der Erde vorbei, und nur ein geringer Prozentsatz aller Schnuppen gelangt überhaupt in die irdische Lufthülle, um anschließend bei genügender Größe die Erdoberfläche zu erreichen und sich dort - um es kurz vorwegzunehmen - als Hagel und Wasser mitzuteilen.
Nehmen wir die Höhe der Atmosphäre nach zuverlässiger Schätzung mit etwa 600 Kilometer an, wobei die letzten 100 Kilometer allenthalben den Übergang zum Weltraum kennzeichnen, so ist noch jede Sicht eines Beobachters erheblich eingeschränkt, was für die Beobachtung der in Erdnähe vorbeihuschenden Kleinkörper nicht bedeutungslos ist. Die Verminderung der Sichtbarkeit hängt damit zusammen, daß die Luft in unmittelbarer Nähe der Erdoberfläche nicht mehr rein und folglich durchsichtig genug ist. Das führt zu einem gewissermaßen trichterartig gestalteten Schauraum als Produkt des ihn umlagernden Dunstes.
Je nach dem Standort eines Beobachters, wie etwa in Industriegebieten oder Großstadtnähe, kann der nutzbare Schauraum weiterhin vermindert sein.
Setzen wir nun - im Sinne der Sternforschung gesehen! - die höchste Aufleuchthöhe für Schnuppen mit 150 Kilometer an, so ergibt eine Berechnung des Durchmessers und der Oberfläche des überblickten Gebietes, daß ein Beobachter bei uns durchschnittlich nur 1/10 000 der 150 Kilometer um den Erdball geschlagenen Kugelfläche überblickt. Nun ist der Jahresdurchschnitt der von diesem Beobachter allein schon bemerkten Schnuppen erstaunlich groß und muß in Wirklichkeit ein Vieltausendfaches für den ganzen Erdball gerechnet ergeben, selbst wenn wir berücksichtigen, daß Schnuppen die Erde nicht überall gleichmäßig umstürmen.
Wenn aber (und so muß man zwangsläufig folgern) die Sternschnuppen wirklich meteorartige Körper wären, deren Eindringen in die Atmosphäre erst ihr Sichtbarwerden (sei es durch Luftreibung, sei es durch Leuchteffekte der vor ihnen hergeschobenen Luft) verbürgt, dann müßte folgendes Tatsache sein:
Bei dem beobachtungsgemäß erheblichen Schnuppenfall müßte sich der tägliche Massenzuwachs der Erde in einer merklich wahrnehmbaren Veränderung der Tageslänge und einer verhältnismäßig sehr wesentlichen Beschleunigung des Mondumlaufes bemerkbar gemacht haben. Die Erde müßte wohlverstanden einen jährlich Millionen Tonnen betragenden Massenzuwachs erhalten haben und dauernd erhalten.
Um aus dieser Verlegenheit herauszukommen, haben viele Himmelsforscher von jeher auf kleine Schnuppenmassen hingearbeitet. Sie haben sogar nachzuweisen versucht, daß Schnuppenkörper von nur 1/10 Gramm Gewicht aufzublinken vermögen. Daß dies technisch-physikalisch unmöglich ist und nur vom grünen Tisch aus sich "rechnerisch" gestalten läßt, steht außer Frage. Derart winzige Körper können in verhältnismäßig großer Entfernung unmöglich Leuchteffekte erzeugen, die erfaß- und wahrnehmbar sind, auch wenn wir zugeben wollten, daß sie aus Metall bestünden. Wir benötigen derart kleine Schnuppen um so weniger, weil es sich eben um verhältnismäßig viel größere Eiskörper bei ihnen handelt. Demzufolge sind sie auch noch als jenseits der Lufthülle vorbeiziehende Körper der Beobachtung zugänglich, und ohne Zweifel ziehen die meisten der sichtbar werdenden Eisschnuppen an der Erde vorbei, und nur ein geringer Prozentsatz aller Schnuppen gelangt überhaupt in die irdische Lufthülle, um anschließend bei genügender Größe die Erdoberfläche zu erreichen und sich dort - um es kurz vorwegzunehmen - als Hagel und Wasser mitzuteilen.
Der Behauptung, daß
Sternschnuppen nichts anderes als Sonnenlicht
reflektierende Eiskörper sind, liegt aber noch im Zusammenhang
damit eine besondere Überlegung zugrunde. Wird ein
Körper, der nur mehr fremdes Licht widerspiegelt, von einem
anderen überschattet, so kann er natürlich nicht mehr
leuchtend in Erscheinung treten, wie das beispielsweise bei
Mondfinsternissen (Mond gelangt in den Schatten der Erde) der Fall zu
sein pflegt. Demzufolge muß es in allerdings stark
verkleinertem Maße auch Schnuppenverfinsterungen geben, sobald
nämlich zur Nachtzeit eine Schnuppe in den Erdschatten
gerät. Man kann diesen Erdschatten räumlich als
gewaltiges Schattenrohr auffassen, dessen Achse naturgemäß
der Sonnenrichtung entgegengesetzt in den Raum weist. Eine
augenblickliche Richtung dieser Achse bzw. die Lage des Schattenrohrs
ist für Tag und Stunde durch die jeweils gegebenen
Bahnverhältnisse der Erde zur Sonne (Erdumlauf, eigene Erddrehung,
Stellung der Erdachse auf ihrer Bahnebene) genau bestimmt, und diese
Verhältnisse gestatten erst, den Gang der Schnuppen für jeden
Ort der Erde im Verlaufe jeder Nacht und im Zeitraum eines Jahres zu
durchschauen. Mit anderen Worten ist die Lage des Erdschattens
zwangsläufig abhängig vom Standort des Beobachters sowie von
der Jahres- und Tageszeit.
Schnuppen müssen beim Eintritt in den Erdschatten unsichtbar werden und gegebenenfalls beim Austritt aus dem Schatten wieder aufleuchten.
Laufen Schnuppen jedoch in der Richtung des Schattens weiter oder findet der Austritt an einer Stelle statt, da Undurchsichtigkeit des Horizontes eine Schau verbietet, kann eine Schnuppe auch nicht mehr erneut sichtbar werden. Es ist auch nur natürlich, daß die jeweilige Lage des Erdschattens bald mehr, bald weniger Schnuppen zu beobachten gestattet. Beobachtet man beispielsweise bei uns zulande (fixierter Standort +50° geographische Breite, Zeit 12 Uhr nachts) Schnuppen zur Wintersonnenwende, so ist der Erdschatten derart gelagert, daß Schnuppen sowohl vor dem Eintritt als auch nach dem Austritt aus dem Schatten sichtbar sind. Zur Sommersonnenwende hindert der Erdschatten so gut wie gar nicht, und in der Zeit der Tag- und Nachtgleichen sind Schnuppen vor allem vor dem Verschwinden im Schatten bei einer erheblichen unbeschatteten Raumweite zu beobachten. Das Beobachtungsmaterial der Schnuppenforschung bestätigt geradezu diesen Verlauf der Dinge, aber da sie die Natur der Sternschnuppen nicht erkannt hat, sie für solche erst in der Lufthülle aufleuchtende Körper hält, und da ihr Schnuppenverfinsterungen fremd geblieben sind, kann sie auch keine irgendwie befriedigende Deutung geben, kann ihre Beobachtungen gar nicht richtig auswerten und muß sich mit Annahmen, Möglichkeiten und grauen Hypothesen mühen. Wiederum ist die bisherige Forschung um die Deutung einer sehr wesentlichen Tatsache verlegen, die wir klären können und die unsere Frage, ob Sternschnuppenbeobachtungen unsere Eiskörperverteilungen im Raum beweisen, zur abschließenden Beantwortung führt.
Schnuppen müssen beim Eintritt in den Erdschatten unsichtbar werden und gegebenenfalls beim Austritt aus dem Schatten wieder aufleuchten.
Laufen Schnuppen jedoch in der Richtung des Schattens weiter oder findet der Austritt an einer Stelle statt, da Undurchsichtigkeit des Horizontes eine Schau verbietet, kann eine Schnuppe auch nicht mehr erneut sichtbar werden. Es ist auch nur natürlich, daß die jeweilige Lage des Erdschattens bald mehr, bald weniger Schnuppen zu beobachten gestattet. Beobachtet man beispielsweise bei uns zulande (fixierter Standort +50° geographische Breite, Zeit 12 Uhr nachts) Schnuppen zur Wintersonnenwende, so ist der Erdschatten derart gelagert, daß Schnuppen sowohl vor dem Eintritt als auch nach dem Austritt aus dem Schatten sichtbar sind. Zur Sommersonnenwende hindert der Erdschatten so gut wie gar nicht, und in der Zeit der Tag- und Nachtgleichen sind Schnuppen vor allem vor dem Verschwinden im Schatten bei einer erheblichen unbeschatteten Raumweite zu beobachten. Das Beobachtungsmaterial der Schnuppenforschung bestätigt geradezu diesen Verlauf der Dinge, aber da sie die Natur der Sternschnuppen nicht erkannt hat, sie für solche erst in der Lufthülle aufleuchtende Körper hält, und da ihr Schnuppenverfinsterungen fremd geblieben sind, kann sie auch keine irgendwie befriedigende Deutung geben, kann ihre Beobachtungen gar nicht richtig auswerten und muß sich mit Annahmen, Möglichkeiten und grauen Hypothesen mühen. Wiederum ist die bisherige Forschung um die Deutung einer sehr wesentlichen Tatsache verlegen, die wir klären können und die unsere Frage, ob Sternschnuppenbeobachtungen unsere Eiskörperverteilungen im Raum beweisen, zur abschließenden Beantwortung führt.
Man weiß, daß die
erste Jahreshälfte weniger reich an
Schnuppenfällen ist als die zweite. Das stimmt mit unserer
Ableitung überein, daß die Erde im Herbst den stärksten
Eiskörperschwärmen ("Eistrichter-Durchfahrung") ausgesetzt
ist und folglich auch mehr Schnuppenfälle registriert werden
müssen.
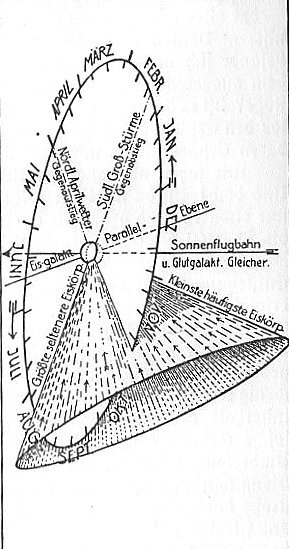
(Bildquelle und -text:
Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von H. Fischer, 1924)
Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)
Man sieht, daß die Erde diesen Eisschleiertrichter um den 10. bis 20. August absteigend und um Ende Oktober und Anfang November herum aufsteigend durchwandert, zu welchen Zeiten wir auch die beiden jährlichen Hauptzeiten der Sternschnuppen beobachten können, die als Eiskörper im widergespiegelten Sonnenlicht außerhalb der irdischen Lufthülle aufleuchten. (Zeichnung nach Hörbiger.)
Die Schnuppenhäufung zur
zweiten Jahreshälfte hat der
französische Astronom Coulvier-Gravier bereits vor langen
Jahrzehnten nachgewiesen, aber er hat auch schon damals viel
weitgehendere Einzelheiten festgestellt. Er hat mehrere Jahre
hindurch die Schnuppenfälle ausgezählt und verzeichnet und im
Mittel herausgefunden, daß in der zweiten Jahreshälfte
(abgesehen vom allgemeinen Mehr an Schnuppen) ein Maximum oder ein
Häufigkeitswert zwischen August und November liegt. Ferner
blieb es ihm auch nicht verborgen, daß dieser
Häufigkeitswert eine Schwächung um die Septemberzeit
aufweist! Erinnern wir uns des Gesagten, daß unsere Erde
beim Hindurchschlich durch den idealisierten "Eistrichter" dessen
"Wände" (starke Eiskörperzonen) passiert und der
"Trichterinnenraum" weniger mit Eis gespeist sein kann, so ist auch
diese Überreinstimmung, zumal auch die Zeitverhältnisse
stimmen, geradezu schlagend! Auch bei der im Mittel
schnuppenärmeren ersten Jahreshälfte tritt
beobachtungsgemäß zwischen Februar bis April ein
Häufigkeitswert mit deutlicher Schwächung im März auf,
was wiederum den Verhältnissen unseres "Gegentrichters"
entspricht. Daß der Frühjahrshäufigkeitswert weit
hinter dem herbstlichen steht, deckt sich ebenfalls mit unserer
Gegentrichterableitung.
Die Tatsachen sprechen, und sie sprechen ebenso deutlich zu uns bei weiteren Vergleichen unserer "Eistrichter" mit dem von der Forschung seit Jahrzehnten aufbereiteten Beobachtungsmaterial über die jährliche Variation von Sternschnuppen und Schnuppenschwärmen. Und der aus der Fallbahnableitung sich ergebende Eisblockzuzug (Eisboliden) stimmt deshalb auch nicht nur zufällig mit dem altbekannten Perseidenschwarm zur Augustzeit, dem Leonidenschwarm zur Novemberzeit oder etwa dem Lyridenschwarm im April überein.
Auch über die Sternschnuppen konnten wir ebensowenig wie über die Milchstraße mit drei Worten hinweggleiten. Wir mußten zum mindesten andeuten, welche Wege gegeben sind, die Eisnatur zu ergründen und auf welcher Linie die Beweismittel sich bewegen. An diesen Eisschnuppen hängt ja im Grunde das ganze Schicksal der Erde, und bestünden sie aus Metall oder Stein, existierte kein Leben auf Erden. Würden sie aber plötzlich zu solcher Stofflichkeit überwechseln, sähe es in ein paar Jahrtausenden schon gar böse aus. Eine ausgedörrte Erdenwüste wäre schlimmer als die mit der Eisanreicherung an die Erde gebundenen Gefahren. Diesen Beweis wird und die Erde noch selbst liefern.
Die Tatsachen sprechen, und sie sprechen ebenso deutlich zu uns bei weiteren Vergleichen unserer "Eistrichter" mit dem von der Forschung seit Jahrzehnten aufbereiteten Beobachtungsmaterial über die jährliche Variation von Sternschnuppen und Schnuppenschwärmen. Und der aus der Fallbahnableitung sich ergebende Eisblockzuzug (Eisboliden) stimmt deshalb auch nicht nur zufällig mit dem altbekannten Perseidenschwarm zur Augustzeit, dem Leonidenschwarm zur Novemberzeit oder etwa dem Lyridenschwarm im April überein.
Auch über die Sternschnuppen konnten wir ebensowenig wie über die Milchstraße mit drei Worten hinweggleiten. Wir mußten zum mindesten andeuten, welche Wege gegeben sind, die Eisnatur zu ergründen und auf welcher Linie die Beweismittel sich bewegen. An diesen Eisschnuppen hängt ja im Grunde das ganze Schicksal der Erde, und bestünden sie aus Metall oder Stein, existierte kein Leben auf Erden. Würden sie aber plötzlich zu solcher Stofflichkeit überwechseln, sähe es in ein paar Jahrtausenden schon gar böse aus. Eine ausgedörrte Erdenwüste wäre schlimmer als die mit der Eisanreicherung an die Erde gebundenen Gefahren. Diesen Beweis wird und die Erde noch selbst liefern.
Drei Jahrdutzende (dies im Jahr
1936 zurürckgerechnet) sind
verstrichen, seit von der von Hörbiger verteidigten Eisnatur der
Schnuppen erstmals etwas in die Öffentlichkeit drang. Der
"Pester Lloyd" hatte es "gewagt", in seiner Abendausgabe vom 15.
November 1899 ein kurzes Referat über einen Vortrag Hörbigers
zu bringen, den dieser auf Betreiben des ordentlichen Professors J. von
Radinger an der Wiener Technischen Hochschule gehalten hatte. Das
war die überhaupt erste Veröffentlichung
über eine der vielen zur Welteislehre (Glacial-Kosmogonie)
drängenden Perspektiven, und den Anstoß zu dem Vortrage
selbst hatte eine Pressefehde über die "Leoniden" gegeben, die von
zwei Sterngelehrten, Professor Palisa und dem Berliner Wilhelm Meyer
(Uraniameyer) ausgetragen wurde. Meyer hatte schon Jahre zuvor
mit Hörbiger in Briefwechsel gestanden, glaubte anfänglich
kosmisches Eis als Hirngespinst verurteilen zu sollen und wollte den
Lesern des "Neuen Wiener Tageblattes" nun plötzlich klarmachen,
daß die Beobachtung
eines Gewitters in den Alpen für einen kosmischen Eiseinfluß
spräche. Palisa glaubte wiederum in der "Neuen Freien
Presse" behaupten zu müssen, daß in solchem Falle der Himmel
glühend werden müßte. Das hatte in Anbetracht des
bevorstehenden Leonidenfalles auch recht viele der gemütlichsten
Wiener auf die Beine gebracht, und ein ganzes Heer von Neugierigen
hielt damals den Semmering oder den Kahlenberg besetzt.
Glüht der Himmel wirklich oder glüht er nicht, das schien der
Volksmeinung nach eine wirklich interessante und schließlich auch
nicht ganz ungefährliche Sache zu sein.
Professor J. von Radinger hatte noch vor seinem früh erfolgten Ableben (1903) Gelegenheit genommen, einem Festvortrag (anläßlich einer Jubiläumsfeier deutschösterreichischer Ingenieure und Wissenschaftler) Hörbigersche Ideen zugrunde zu legen, um, wie er es selbst ausspricht, "zu zeigen, daß unsere Augen über die Alltagsgrenzen hinauswachsen" müssen. Sein an Hörbiger selbst gerichtetes Wort aber: "Seien Sie beruhigt in der Überzeugung und dem Bewußtsein, durch Ihren Genius die Welt verpflichtet zu haben", steht damals schon wie eine spezifische Warnung vor allen, die sich berufen fühlen, durch forschende Erkenntnis Licht in das Dunkel der irdisch-kosmischen Zusammenhänge zu tragen. Aber seltsamerweise ist die Wissenschaft nur allzu beruhigt in alten und längst ausgefahrenen Gleisen weitergegangen. Jahrzehnte sollten jedenfalls verstreichen, bis sich in den letzten Jahren und gegenwärtig zum mindesten vereinzelte Gelehrte (und nicht zuletzt aus dem Kreise der Wetterforschung) finden, um das kosmische Eis zögernd aufzugreifen und ihren Ideengängen einzuflechten (dies geschrieben und gehofft im Jahre 1936).
Wir bringen das sehr bewußt zum Ausdruck, um zu zeigen, wieviel Zeit es kostet, bis ein gewaltiger Schrittmacher Verständnis bei jenen findet, die dem konstruktiven Rohbau seiner Gesamtschau feingeschliffene Steine einsetzen.
Professor J. von Radinger hatte noch vor seinem früh erfolgten Ableben (1903) Gelegenheit genommen, einem Festvortrag (anläßlich einer Jubiläumsfeier deutschösterreichischer Ingenieure und Wissenschaftler) Hörbigersche Ideen zugrunde zu legen, um, wie er es selbst ausspricht, "zu zeigen, daß unsere Augen über die Alltagsgrenzen hinauswachsen" müssen. Sein an Hörbiger selbst gerichtetes Wort aber: "Seien Sie beruhigt in der Überzeugung und dem Bewußtsein, durch Ihren Genius die Welt verpflichtet zu haben", steht damals schon wie eine spezifische Warnung vor allen, die sich berufen fühlen, durch forschende Erkenntnis Licht in das Dunkel der irdisch-kosmischen Zusammenhänge zu tragen. Aber seltsamerweise ist die Wissenschaft nur allzu beruhigt in alten und längst ausgefahrenen Gleisen weitergegangen. Jahrzehnte sollten jedenfalls verstreichen, bis sich in den letzten Jahren und gegenwärtig zum mindesten vereinzelte Gelehrte (und nicht zuletzt aus dem Kreise der Wetterforschung) finden, um das kosmische Eis zögernd aufzugreifen und ihren Ideengängen einzuflechten (dies geschrieben und gehofft im Jahre 1936).
Wir bringen das sehr bewußt zum Ausdruck, um zu zeigen, wieviel Zeit es kostet, bis ein gewaltiger Schrittmacher Verständnis bei jenen findet, die dem konstruktiven Rohbau seiner Gesamtschau feingeschliffene Steine einsetzen.
Da spürt, um nur dieses
Beispiel hierherzusetzen, der bekannte
Meteorologe Otto Myrbach von der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik in Wien seit einer Reihe von Jahren der Frage nach,
welchen möglichen Einfluß Sternschnuppen, insbesondere die
Leoniden, auf das Wetter haben, und er hat seine vorläufigen
Forschungserkenntnisse darüber in verschiedenen Fachorganen
niedergelegt. Ohne seine feinsinnigen Versuchsanstellungen hier
referierend darstellen zu können, greifen wir nur das heraus, was
wichtig zu unterbreiten ist: "Angeregt
wurde ich zu der vorliegenden Untersuchung (über Leoniden) durch
eine Wetterkatastrophe, welche in ganz überraschender
Weise weite Teile von Mittel-
und Südeuropa am 12. November 1925 heimsuchte. Ein
Schneesturm wütete im Eulen- und Riesengebirge und in Mähren,
in Wien fielen innerhalb 14 Stunden 54,6 Millimeter Regen, und es kam
zu katastrophalen Überschwemmungen in Steiermark, Kärnten,
Krain, Bosnien, Montenegro, Dalmatien, Ungarn, Italien und Spanien; bei
den britischen Flottenmanövern fiel ein U-Boot einem Unwetter mit
Sturm zum Opfer und an der Malabarküste in Indien tobte ein Zyklon
(Wirbelsturm). Die Gleichzeitigkeit der Katastrophen, ihre
Ausdehnung und das Überraschende ihres Eintritts legte mir den
Gedanken nahe, daß eine kosmische Einwirkung vorliegen könnte. Ein
günstiger Zufall wollte es, daß ich kurz vor jenem
Unglückstag in einem Brief darauf aufmerksam gemacht worden war,
daß die Erde um den 12. November herum die Bahn des
Meteorschwarms (Sternschnuppen) der Leoniden kreuzt. Sonst
wären mir die Leoniden als gut terrestrisch (erdergeben) erzogenem
Meteorologen wohl ziemlich fern gelegen. So aber war meine
Aufmerksamkeit erregt und es lag nicht fern, zwischen diesen
gleichzeitigen Ereignissen, der Kreuzung des Leonidenschwarmes und den
Wetterkatastrophen, auch eine kausale Beziehung zu vermuten!"
Als Ergebnis seiner angestellten Untersuchungen lesen wir, daß "beim Durchgang der Erde durch Verdichtungsstellen des Leonidenschwarmes stellenweise verstärkte Niederschläge fallen können, und daß der ganze Wasserhaushalt der Erde in den einander folgenden Jahren dieser Durchgänge in nachhaltiger und einschneidender Weise angeregt wird". Ohne Zweifel ist dieser Gelehrte auf dem Weg, zu erkennen, daß in Zeiten der Sternschnuppenschwärme auch die Erde reichlich Gelegenheit findet, Eiskörper daraus einzufangen. Mehr allgemeiner Natur sind uns einige sehr wichtig erscheinende Bemerkungen: "Trotz der herrschenden tiefen Abneigung gegen etwa noch weitergehende kosmische Einflüsse glaube ich, daß es auch notwendig wird, vorurteilslos die Frage planetarischer Einflüsse (!) zu untersuchen, und schließlich wird man sogar auch die Sternschnuppen nicht ganz vergessen dürfen, wenn man ernstlich alle Wetterfaktoren erfassen will. Ich zweifle nicht daran, daß es außer diesen genannten noch viele andere gibt, von deren Mitwirkung wir heute noch gar nichts ahnen (wenn man an der Welteislehre vorbeisieht, Verf.)! Man hört von den grundsätzlichen Gegnern kosmischer Wettereinflüsse immer wieder den Einwand, es sei unwissenschaftlich, sich um kosmische Einflüsse zu kümmern, bevor die rein irdischen Zusammenhänge geklärt seien (was ohne kosmischen Hineinbezug eben niemals gelingen kann! Verf.). Ich muß diesem Einwand hier begegnen, weil er meines Erachtens viel Unheil anrichtet. Ich erachte es nämlich als unsere erste Pflicht, vor allem alle jene unabhängigen Variablen festzustellen, von denen das Wetter abhängt, und als solche stehen kosmische Kräfte mindestens im stärksten Verdacht, mitzuwirken....
Ich wage die Behauptung, daß das grundsätzliche Ignorieren kosmischer Einflüsse unwissenschaftlich ist."
Als Ergebnis seiner angestellten Untersuchungen lesen wir, daß "beim Durchgang der Erde durch Verdichtungsstellen des Leonidenschwarmes stellenweise verstärkte Niederschläge fallen können, und daß der ganze Wasserhaushalt der Erde in den einander folgenden Jahren dieser Durchgänge in nachhaltiger und einschneidender Weise angeregt wird". Ohne Zweifel ist dieser Gelehrte auf dem Weg, zu erkennen, daß in Zeiten der Sternschnuppenschwärme auch die Erde reichlich Gelegenheit findet, Eiskörper daraus einzufangen. Mehr allgemeiner Natur sind uns einige sehr wichtig erscheinende Bemerkungen: "Trotz der herrschenden tiefen Abneigung gegen etwa noch weitergehende kosmische Einflüsse glaube ich, daß es auch notwendig wird, vorurteilslos die Frage planetarischer Einflüsse (!) zu untersuchen, und schließlich wird man sogar auch die Sternschnuppen nicht ganz vergessen dürfen, wenn man ernstlich alle Wetterfaktoren erfassen will. Ich zweifle nicht daran, daß es außer diesen genannten noch viele andere gibt, von deren Mitwirkung wir heute noch gar nichts ahnen (wenn man an der Welteislehre vorbeisieht, Verf.)! Man hört von den grundsätzlichen Gegnern kosmischer Wettereinflüsse immer wieder den Einwand, es sei unwissenschaftlich, sich um kosmische Einflüsse zu kümmern, bevor die rein irdischen Zusammenhänge geklärt seien (was ohne kosmischen Hineinbezug eben niemals gelingen kann! Verf.). Ich muß diesem Einwand hier begegnen, weil er meines Erachtens viel Unheil anrichtet. Ich erachte es nämlich als unsere erste Pflicht, vor allem alle jene unabhängigen Variablen festzustellen, von denen das Wetter abhängt, und als solche stehen kosmische Kräfte mindestens im stärksten Verdacht, mitzuwirken....
Ich wage die Behauptung, daß das grundsätzliche Ignorieren kosmischer Einflüsse unwissenschaftlich ist."
Wir brauchen dieser eindeutigen
Erklärung nichts Ergänzendes
hinzuzusetzen, wir haben das immer behauptet, und wir wiederholen noch
einmal kurz in ein paar klaren Sätzen die inzwischen schon
verfeinert dargestellten Zusammenhänge:
Kosmische und der Milchstraße vom Weltraumwiderstand ausgelockerte Eisblöcke gelangen in das Innere des Sonnenreiches. Wir sehen sie als Eisschnuppen (Grobeis) ziehen. Ein geringer Bruchteil dieser Blöcke fällt in zeitweise verstärktem Grade der Erde zu und löst dort bestimmte Erscheinungen aus. Die Erde wird auf diese Weise auf direktem Weg mit kosmischem Wasser gespeist. Eine zweite kosmische Wasserspeisung geht von den Sonnenflecken aus, die das Ergebnis der bis zur Sonne gelangten und in sie gestürzten Eisblöcke sind. Das von den Fleckentrichtern schußartig abgetriebene und in seinem Abtrieb vom Strahlungsdruck noch beflügelte Feineis (Eisstaub) dringt bis zur Erde und noch darüber hinaus bis in die Marsgegend vor, hüllt die Erde gewissermaßen ein und wird auch in der irdischen Lufthülle entsprechend wirksam. Die Vorgänge bei beiden Wasserspeisungen der Erde laufen naturgemäß nicht vollkommen getrennt nebeneinander her, sondern müssen sich überschneiden, durchdringen und ergänzen. Die Wirkungen dieser Vorgänge sind vielgestaltig, sie beeinflussen nicht nur die Luft-, sondern auch die Gesteinshülle (feste Krustenoberfläche) der Erde und im Zusammenhang damit das irdische Leben einschließlich des Menschen.
Es gelingt, sowohl das Milchstraßen- als auch das ihr entstammende Schnuppeneis nachzuweisen. An jedem nicht mit Wolken bedeckten Nachthimmel haben wir dieses Eis sichtbar vor uns, und wir hätten dies auch für das freie Auge am Tage, würde die Lichtflut der Sonne die Beobachtung dann nicht verwehren.
Es bleibt aber noch eine letzte Frage zu klären übrig, und diese lautet: Können wir das sonnenflüchtige Feineis ebenfalls sehen? Ist diese Frage beantwortet, können wir um so gefestigter und ohne voraussetzungslos erscheinen zu müssen die Auswirkungen vom Grob- und vom Feineis auf Erden uns näher besehen.
Kosmische und der Milchstraße vom Weltraumwiderstand ausgelockerte Eisblöcke gelangen in das Innere des Sonnenreiches. Wir sehen sie als Eisschnuppen (Grobeis) ziehen. Ein geringer Bruchteil dieser Blöcke fällt in zeitweise verstärktem Grade der Erde zu und löst dort bestimmte Erscheinungen aus. Die Erde wird auf diese Weise auf direktem Weg mit kosmischem Wasser gespeist. Eine zweite kosmische Wasserspeisung geht von den Sonnenflecken aus, die das Ergebnis der bis zur Sonne gelangten und in sie gestürzten Eisblöcke sind. Das von den Fleckentrichtern schußartig abgetriebene und in seinem Abtrieb vom Strahlungsdruck noch beflügelte Feineis (Eisstaub) dringt bis zur Erde und noch darüber hinaus bis in die Marsgegend vor, hüllt die Erde gewissermaßen ein und wird auch in der irdischen Lufthülle entsprechend wirksam. Die Vorgänge bei beiden Wasserspeisungen der Erde laufen naturgemäß nicht vollkommen getrennt nebeneinander her, sondern müssen sich überschneiden, durchdringen und ergänzen. Die Wirkungen dieser Vorgänge sind vielgestaltig, sie beeinflussen nicht nur die Luft-, sondern auch die Gesteinshülle (feste Krustenoberfläche) der Erde und im Zusammenhang damit das irdische Leben einschließlich des Menschen.
Es gelingt, sowohl das Milchstraßen- als auch das ihr entstammende Schnuppeneis nachzuweisen. An jedem nicht mit Wolken bedeckten Nachthimmel haben wir dieses Eis sichtbar vor uns, und wir hätten dies auch für das freie Auge am Tage, würde die Lichtflut der Sonne die Beobachtung dann nicht verwehren.
Es bleibt aber noch eine letzte Frage zu klären übrig, und diese lautet: Können wir das sonnenflüchtige Feineis ebenfalls sehen? Ist diese Frage beantwortet, können wir um so gefestigter und ohne voraussetzungslos erscheinen zu müssen die Auswirkungen vom Grob- und vom Feineis auf Erden uns näher besehen.
Wer einige Übung im
Beobachten der Himmelswunder besitzt und
seinen Blick regelmäßiger zum Dämmerungs- oder
Nachthimmel kehrt, dem bleibt auch ein zart weißlich schimmerndes
Gebilde nicht verborgen, das sich in unseren Breiten vor allem in
schönen Winternächten zeigt. Der seltsame, zu dieser
Zeit am abendlichen Westhimmel aufleuchtende und dort seine breiteste
Stelle aufweisende Schein verengt sich bis zu einer gewissen Höhe
mehr und mehr, erinnert seiner Form nach an eine Halbellipse und wird
in der Regel als Lichtkegel beschrieben. Da dieses Gebilde
ausgesprochen den Sternbildern des Tierkreises
(= Zodiakus) folgt, wird es mit Tierkreis- oder Zodiakallicht bezeichnet. Man hat auch längst herausgefunden, daß aus der Spitze des Zodiakalkegels bisweilen ein äußerst zartes Band (Lichtbrücke) weiterverläuft, das, den Lichtschein verlängernd, über das ganze Himmelsgewölbe verfolgt werden kann und das am Gegenpunkt des Hauptlichtes eine Lichtsteigerung (Gegenschein) erfährt.
Wer sich über die jeweilige Sichtbarkeit und die Beobachtungsmethoden des Zodiakallichtes näher unterrichten will, mag sich Aufklärung darüber in dem mit Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft herausgegebenen Werk über das Zodiakallicht (Bd. 11 der "Probleme der kosmischen Physik") verschaffen. Hier hat der derzeit (im Jahre 1936) gründlichste Beobachter des Zodiakallichtes, F. Schmid, einen sich auf Jahrzehnte hindurch erstreckenden Beobachtungsstoff ausgearbeitet und auch ziemlich erschöpfend die verschiedenen Mußmaßungen über das Wesen dieser Erscheinungen vorgetragen.
Wir heben das ausdrücklich hervor, weil im allgemeinen das Zodiakallicht ziemlich stiefmütterlich abgetan wird und noch gegenwärtig in der Neuauflage eines bekannten und äußerst umfangreichen Lehrbuches der Meteorologie lediglich der Vermerk zu entdecken ist, daß es, dem Gebiete der Wetterkunde ferner liegend, "vorläufig noch beiseitegelassen werden kann". (!) Nun ging und geht der Streit um diesen rätselhaften Lichtschimmer noch immer darum, ob es als eine der irdischen Lufthülle entsprungene Erscheinung oder kosmisch zu deuten ist. Die meisten Ansichten neigen dahin, das Zodiakallicht als eine gegen die Sonne hin verdichtende Materie aufzufassen, die in Form einer flachen Linse bis über die Erdbahn hinausreicht, und die allenfalls nur eine Fortsetzung des Sonnenkronlichtes sein könnte!
Damit kommt uns die Forschung sehr entgegen, denn unserer Ableitung gemäß, daß das Kronlicht in der Fleckentätigkeit der Sonne wurzelt, und beiderseits vom Sonnenäquator die durchschnittlich meisten Auspufftrichter tätig sind, muß sich bei genauerem Verfolg der Dinge ein solches Bild ergeben. Der Haupt- und der Gegenschein des Zodiakallichtes aber sind Zeugen dafür, daß die Erde beim Durchfurchen sonnenflüchtiger Feineismassen Feineisverdichtungen infolge ihrer elektromagnetischen Raffwirkung herbeiführt, die auf der Mittagsseite der Erde verstärkt (Hauptschein oder Zodiakalkopf) erscheinen, indessen auf der sonnenabgewandten Seite eine Art Kielwasser im Feineisabfluß (Gegenschein oder Zodiakalschweif) entstehen muß. Eine genauere Darstellung der hier bestehenden Verhältnisse (die "Lichtbrücke" beispielsweise als sich notwendig ergebende Perspektiverscheinung der bis über die Marsbahn hinausreichenden Zodiakallinse erklärt) würde zeigen, daß gerade erst die Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) erstaunliche Klarheit in das hypothetisch umwobene Gesamtbild hineinträgt und sich nirgends in Widerspruch mit allgemein festgestellten Beobachtungsergebnissen befindet.
Man gibt auch allgemein zu, daß das Zodiakallicht aus sonnenbeleuchteten Partikeln besteht und spricht sogar von festen Körperchen von 1 Millimeter Durchmesser, wobei eine durchschnittliche Entfernung der Teilchen von 8 Kilometer genügen würde, die Helligkeit des Zodiakallichtes zu erklären.
Die Körperchen werden ihrer Natur nach bald als sonnenflüchtiger "Sonnenstaub" oder als irgendein kosmischer Staub gedeutet, und dann und wann stößt man gar noch auf die Meinung, es handle sich um übriggebliebene Reste jenes Urnebels, aus dem sich unser Sonnenreich vermeintlich gebildet haben könnte.
Wiederholt wurde dieser mysteriöse Staub auch schon mit der Sonnenfleckentätigkeit in Zusammenhang gebracht, weil man feststellen konnte, daß das Tierkreislicht zu Zeiten verminderter Sonnentätigkeit eine entsprechende Einbuße seines Lichtschimmers erfährt, im umgekehrten Falle aber wieder heller erstrahlt! Das registrieren wir um so lieber, als wir entdecken konnten, daß bereits der große Naturforscher Alexander von Humboldt (gest. 1859), der das in den Tropen viel wundervoller ausgeprägte Zodiakallicht dort studieren konnte, in seinem berühmten Reisewerk über die Äquinoktialgegenden einen entsprechenden Hinweis gibt. Er teilt uns mit, nach des Gelehrten Dominic Cassinis Meinung sollte "das Zodiakallicht in manchen Jahren schwächer und dann wieder so stark werden wie anfangs". Als Grund für diesen Lichtwechsel würde Cassini (dessen Name übrigens im Begriff Cassinische Teilung beim Saturnring fortlebt) annehmen, daß es "mit denselben Emanationen (Ausstrahlungen) zusammenhänge, in deren Folge auf der Sonnenscheibe periodisch Flecken und Fackeln erscheinen". Wenn neuerdings der erwähnte Zodiakalspezialist Schmid betont, "daß die Möglichkeit eines Zusammenhanges des Zodiakallichtes mit der Periodizität der Sonnenflecken erneut eine sorgfältige Prüfung fordert und im Moment keineswegs abgelehnt werden darf", so zeigt das nur, daß hundert und mehr Jahre nicht hinreichen, eine richtig aufgenommene Fährte zu verfolgen und restlos zu klären.
(= Zodiakus) folgt, wird es mit Tierkreis- oder Zodiakallicht bezeichnet. Man hat auch längst herausgefunden, daß aus der Spitze des Zodiakalkegels bisweilen ein äußerst zartes Band (Lichtbrücke) weiterverläuft, das, den Lichtschein verlängernd, über das ganze Himmelsgewölbe verfolgt werden kann und das am Gegenpunkt des Hauptlichtes eine Lichtsteigerung (Gegenschein) erfährt.
Wer sich über die jeweilige Sichtbarkeit und die Beobachtungsmethoden des Zodiakallichtes näher unterrichten will, mag sich Aufklärung darüber in dem mit Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft herausgegebenen Werk über das Zodiakallicht (Bd. 11 der "Probleme der kosmischen Physik") verschaffen. Hier hat der derzeit (im Jahre 1936) gründlichste Beobachter des Zodiakallichtes, F. Schmid, einen sich auf Jahrzehnte hindurch erstreckenden Beobachtungsstoff ausgearbeitet und auch ziemlich erschöpfend die verschiedenen Mußmaßungen über das Wesen dieser Erscheinungen vorgetragen.
Wir heben das ausdrücklich hervor, weil im allgemeinen das Zodiakallicht ziemlich stiefmütterlich abgetan wird und noch gegenwärtig in der Neuauflage eines bekannten und äußerst umfangreichen Lehrbuches der Meteorologie lediglich der Vermerk zu entdecken ist, daß es, dem Gebiete der Wetterkunde ferner liegend, "vorläufig noch beiseitegelassen werden kann". (!) Nun ging und geht der Streit um diesen rätselhaften Lichtschimmer noch immer darum, ob es als eine der irdischen Lufthülle entsprungene Erscheinung oder kosmisch zu deuten ist. Die meisten Ansichten neigen dahin, das Zodiakallicht als eine gegen die Sonne hin verdichtende Materie aufzufassen, die in Form einer flachen Linse bis über die Erdbahn hinausreicht, und die allenfalls nur eine Fortsetzung des Sonnenkronlichtes sein könnte!
Damit kommt uns die Forschung sehr entgegen, denn unserer Ableitung gemäß, daß das Kronlicht in der Fleckentätigkeit der Sonne wurzelt, und beiderseits vom Sonnenäquator die durchschnittlich meisten Auspufftrichter tätig sind, muß sich bei genauerem Verfolg der Dinge ein solches Bild ergeben. Der Haupt- und der Gegenschein des Zodiakallichtes aber sind Zeugen dafür, daß die Erde beim Durchfurchen sonnenflüchtiger Feineismassen Feineisverdichtungen infolge ihrer elektromagnetischen Raffwirkung herbeiführt, die auf der Mittagsseite der Erde verstärkt (Hauptschein oder Zodiakalkopf) erscheinen, indessen auf der sonnenabgewandten Seite eine Art Kielwasser im Feineisabfluß (Gegenschein oder Zodiakalschweif) entstehen muß. Eine genauere Darstellung der hier bestehenden Verhältnisse (die "Lichtbrücke" beispielsweise als sich notwendig ergebende Perspektiverscheinung der bis über die Marsbahn hinausreichenden Zodiakallinse erklärt) würde zeigen, daß gerade erst die Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) erstaunliche Klarheit in das hypothetisch umwobene Gesamtbild hineinträgt und sich nirgends in Widerspruch mit allgemein festgestellten Beobachtungsergebnissen befindet.
Man gibt auch allgemein zu, daß das Zodiakallicht aus sonnenbeleuchteten Partikeln besteht und spricht sogar von festen Körperchen von 1 Millimeter Durchmesser, wobei eine durchschnittliche Entfernung der Teilchen von 8 Kilometer genügen würde, die Helligkeit des Zodiakallichtes zu erklären.
Die Körperchen werden ihrer Natur nach bald als sonnenflüchtiger "Sonnenstaub" oder als irgendein kosmischer Staub gedeutet, und dann und wann stößt man gar noch auf die Meinung, es handle sich um übriggebliebene Reste jenes Urnebels, aus dem sich unser Sonnenreich vermeintlich gebildet haben könnte.
Wiederholt wurde dieser mysteriöse Staub auch schon mit der Sonnenfleckentätigkeit in Zusammenhang gebracht, weil man feststellen konnte, daß das Tierkreislicht zu Zeiten verminderter Sonnentätigkeit eine entsprechende Einbuße seines Lichtschimmers erfährt, im umgekehrten Falle aber wieder heller erstrahlt! Das registrieren wir um so lieber, als wir entdecken konnten, daß bereits der große Naturforscher Alexander von Humboldt (gest. 1859), der das in den Tropen viel wundervoller ausgeprägte Zodiakallicht dort studieren konnte, in seinem berühmten Reisewerk über die Äquinoktialgegenden einen entsprechenden Hinweis gibt. Er teilt uns mit, nach des Gelehrten Dominic Cassinis Meinung sollte "das Zodiakallicht in manchen Jahren schwächer und dann wieder so stark werden wie anfangs". Als Grund für diesen Lichtwechsel würde Cassini (dessen Name übrigens im Begriff Cassinische Teilung beim Saturnring fortlebt) annehmen, daß es "mit denselben Emanationen (Ausstrahlungen) zusammenhänge, in deren Folge auf der Sonnenscheibe periodisch Flecken und Fackeln erscheinen". Wenn neuerdings der erwähnte Zodiakalspezialist Schmid betont, "daß die Möglichkeit eines Zusammenhanges des Zodiakallichtes mit der Periodizität der Sonnenflecken erneut eine sorgfältige Prüfung fordert und im Moment keineswegs abgelehnt werden darf", so zeigt das nur, daß hundert und mehr Jahre nicht hinreichen, eine richtig aufgenommene Fährte zu verfolgen und restlos zu klären.
Inzwischen ist von
Hörbiger die "sorgfältige Prüfung"
längst gemacht und das Problem geklärt worden, und an
vereinzelten Stimmen, die die Zodiakalpartikelchen für Eisgebilde
hielten, hat es auch nicht gefehlt. Selbst Schmid weiß zu
sagen: "Während solchen Perioden
(besondere Helligkeit des Lichtschimmers) liegt die Vermutung nahe,
daß in diesen Zeiten mikroskopische
Eiskristalle in höheren Schichten der Troposphäre die
vermehrten Dämmerungseffekte hervorrufen." Das soll,
unbeschadet des Umstandes, daß Schmid das Zodiakallicht als
irdisch bewirkte und sich dennoch wieder in höchsten Luftschichten
(!) abspielende Erscheinung deutet, besonders festgehalten sein.
Er sucht als Meteorologe dem Rätsel auf die Spur zu kommen,
während es andere Meteorologen wieder dem Astronomen
überlassen und dadurch ein Weiterkommen ausgeschaltet bleiben
muß. Alle tasten richtig und können sich nicht finden,
und so wird gerade das Zodiakallicht zum schlagenden Beweis dafür,
wie nötig es ist, daß sich der Wetterforscher auch
sternkundlich und der Sternforscher wetterkundlich orientiert.
Dann mag es sich auch nicht mehr ereignen, daß ein durch die
Welteislehre (Glacial-Kosmogonie) abgeschreckter Astronom schreiben
kann, daß sich bei Eisanreicherung von außen her zum
mindesten ein schwacher Lichtschimmer am Himmel bemerkbar machen
müsse, aber - "noch niemand
jemals davon etwas gesehen habe". Nun, er saß (zur
Entschuldigung sei es gesagt) Jahre hindurch in einem astronomischen
Recheninstitut und konnte deshalb auch nicht den zodiakalen
Lichtschimmer in Augenschein nehmen, der bereits Tycho Brahe gegen Ende
des sechzehnten Jahrhunderts aufgefallen war, über den sich in der
Nachfolgezeit Hunderte den Kopf zerbrochen haben, der jedem Reisenden
in tropischen Wüsten und Steppen und wiederum jedem Seefahrer als
Nichtfachmann bekannt geworden ist.
Man kann den Schimmer selbst am wolkenlos hellen Tage von Gebirgshöhe aus entdecken, sobald man eine (an einer entsprechenden Handhabe befestigte) Pappscheibe derart zwischen das Auge und die Sonne bringt, daß diese gut zentrisch bedeckt und somit abgeblendet ist. Man wird dann bei günstigen Sichtverhältnissen einen eigenartigen dunstigen Schleier um die Sonne erblicken, der schleppenartig zum Gesichtskreis herabwallt, und der den Eindruck erweckt, daß er über die Erdbahn noch hinausreichen muß.
Man kann den Schimmer selbst am wolkenlos hellen Tage von Gebirgshöhe aus entdecken, sobald man eine (an einer entsprechenden Handhabe befestigte) Pappscheibe derart zwischen das Auge und die Sonne bringt, daß diese gut zentrisch bedeckt und somit abgeblendet ist. Man wird dann bei günstigen Sichtverhältnissen einen eigenartigen dunstigen Schleier um die Sonne erblicken, der schleppenartig zum Gesichtskreis herabwallt, und der den Eindruck erweckt, daß er über die Erdbahn noch hinausreichen muß.
Die Natur will nicht nur aus
Lehrbüchern erlernt, sondern in
erster Linie beobachtet sein, und erst erworbene Kenntnisse und
Beobachtungen zusammen führen zu einer dann auch um so
erlebnisstärkeren Deutung der Dinge. Daß bei dem
Feineisabtrieb der Sonne auch allerlei Glutteilchen mitgerissen und
gezwungen werden können, den Abtrieb mitzumachen, erscheint
selbstverständlich. In dieser Hinsicht mögen wir zu
Recht von kosmischem Staube sprechen, und dieser wird sich auch in mehr
oder minder hohem Maße der Erde anreichern können. So
ist jedenfalls die wiederholt ausgesprochene Vermutung nicht von der
Hand zu weisen, daß beträchtliche Mengen der roten
Tiefseetone, deren Hauptsitz im Stillen Ozean liegt, kosmischer
Herkunft sind.
Alles in allem dürfte auch unsere äußerst roh skizzierte Zodiakalbetrachtung ergeben haben, wie außerordentlich innig doch der "Zusammenklang der Welten" ist, dem nur noch der Zusammenklang der Forschung selbst folgen sollte. Guten Gewissens dürfen wir auch hiervor ein "Kepler redivivus" auf die Flagge schreiben, die auf der Hochburg menschenmöglichen Erkennens flattert.
Alles in allem dürfte auch unsere äußerst roh skizzierte Zodiakalbetrachtung ergeben haben, wie außerordentlich innig doch der "Zusammenklang der Welten" ist, dem nur noch der Zusammenklang der Forschung selbst folgen sollte. Guten Gewissens dürfen wir auch hiervor ein "Kepler redivivus" auf die Flagge schreiben, die auf der Hochburg menschenmöglichen Erkennens flattert.
H.W. Behm
(Quellenschriftauszug aus dem Buch: "Die kosmischen Mächte und Wir" von H.W. Behm, 1936, Wegweiser-Verlag G.m.b.H., Berlin;
Bildquellen: Aus dem Buch "Welteis und Weltentwicklung" von H.W. Behm, 1926 und aus dem Buch "Der Mars, ein uferloser Eisozean" von Hanns Fischer, 1924,
R. Voigtländer Verlag, Leipzig)