| Zurück |
Impressum
Datenschutz
EINLEITUNG
Ich will betrachten, wie sich
Planet und Mond zwischen Mondeinfang und
Mond-Ende gegenseitig zueinander verhalten.
Denn bei aller Mißhandlung, die der kleinere erfährt, prägt er dem größeren doch Züge seiner Wirksamkeit auf. Es wird sich ergeben, ob und inwieweit dabei ruckartige Veränderungen auftreten. Maßstabsgerechte Darstellungen sind unentbehrlich, ebenso Rechnung, doch sollen Differential- und Integralrechnung vermieden werden.
Denn bei aller Mißhandlung, die der kleinere erfährt, prägt er dem größeren doch Züge seiner Wirksamkeit auf. Es wird sich ergeben, ob und inwieweit dabei ruckartige Veränderungen auftreten. Maßstabsgerechte Darstellungen sind unentbehrlich, ebenso Rechnung, doch sollen Differential- und Integralrechnung vermieden werden.

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 97, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 1
Abbildung 1
Eine Übersicht über die Gegenseitigkeit der Einwirkungen während einer Mond-Ära mag vorangehen.
| Zeiten
des Mondlebens |
Mond |
Erde |
Einfang. Lange Erholungszeit. Vor-, Haupt-, Nach- Stationäres Stadium. Langes, wenn auch im Vergleich zum Einholungsstadium geringeres Vor- eilungstadium. Annäherung an das Zerfallsstadium. Zerreißungszeit. Ringzeit. Absinken. |
Einfangs- und Dauerfluten, Sphäroidform. Zerklüftung des Eismantels. a) Verstärkung der Sphäroidform, Durchwalkung des Eismantels bei noch fortdauernder Rotation. b) Langsame Bremsung der Rotation, Zunehmen der Dicke des Eismantels. c) Ersterben der Rotation im Eismantel unter Übergang zur Eiform, Durchtreten von Wasser, Auftreten der "Meere", "Atmen" bei Erd-Nähe und -Ferne unter Kraterbildung, Erlahmen auch der Kernrotation. d) Letztere kommt zum Stillstand, Kern sinkt in die Eiform ein, völliges Ausfrieren des Innen- wassers, Mondtag und Mondumlauf werden gleich. Aufrichtung der Mondachse beginnt. Schwach wachsende Länge der Eiform, sonst flutlos, wachsende Achsenaufrichtung und Herabholung der Mondbahnebene in die Gleicherebene (= Äquatorebene) der Erde, mindestens jetzt stark beginnend. Weitere Eiverzerrung. Weitere Eiverzerrungen, Mondbahn sinkt ganz in die Gleicherebene der Erde. Auseinanderfallen, Kippbewegungen, Durchwalkung, Ringform. Ausschweben, gleichmäßige Zerstreuung in der Ringzone. Allmähliche Bremsung, immer stärkere Spiralbahnen der Trümmer, Einstürze rund um die Erde. |
Einfangs- und Dauerfluten, Sphäroidform. Sehr langsames Anwachsen der Fluten. Allmähliche Aufrichtung der Erdachse. Beginn rückschreitender Präzession. Immer stärkere Sphäroidform. Allmählich anwachsende noch zurück- bleibende Gürtelhochflut sobald der Mond sich nähert und der Monat sich stark verkürzt. Erhebung der Zenit- und Nadirflut, Rückverzerrung in der Kruste, Erhebung zur Eiform, Vorbewegungen in Magma und Kruste, langsames Vorwandern der Eiform und Kruste. Dies sind die Zeiten der stärksten Gebirgsbildungen, Gebirgs- Schleppenzüge u.s.w. Fortsetzung der Achsenaufrichtung. Während des Vorstadiums Zunahme, während des Nachstadiums wieder Abnahme der Tageslänge. Rücksinken in die Sphäroidform, fortschreitende Achsenaufrichtung, Beginn vorschreitender Präzession, vorschreitender Gürtelhochflut. Immer stärkere Linsenform, hohe Gürtelflut, Ausgleich der Mondbahn- und Gleicherebene. Ruhiges Ausrollen der bisherigen Entwicklung. Stärkste Linsenform, Luftlinse dehnt sich weit aus. Zurückgehen der Luftlinse, Auseinanderfallen der Gürtelflut, Zurücksinken in die Kugelgestalt (nur noch Aufbauchung durch Umschwung). Ausgleichende Hauptverschiebungen und Achsenschwankungen. |
MONDEINFANG
Die Bahne von Neptun und Pluto - siehe Abbildung 2 - letztere in erstere hinabgekippt, kennzeichnen den Mondeinfang.

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 100, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 2
Abbildung 2
Beim Vorrücken von a1-a2
nach b1-b2, worüber 165/4 = 41 Jahre
vergehen, gewinnt Pluto nur wenig mehr Tangentialgeschwindigkeit, als
Neptun schon besitzt, und muß, von diesem mitgenommen, die
S-förmige Bahn einschlagen. Auf Erde und Mond
übertragen, ginge das in rund ¼ Jahr vor sich. Der
erste Mondumlauf, der vielleicht 6 Wochen gedauert hat, ist jetzt bei
fortgeschrittener Annäherung schon auf 27 Tage siderische, 29 Tage
synodische Umlaufszeit zusammengeschrumpft. Der erste
"ruckartige" Anstoß zur Umsetzung aus der Kugel zum Sphäroid
hätte also 13 + 6 Wochen = 133 Tage gedauert, in den ersten 13
Wochen von fast 0 bis zu etwa jetziger Stärke ansteigend, um sich
dann gleichmäßig zu halten.
Die Erschütterung und Umsetzung aus der Kugel zum Sphäroid löste auf der Erde die Atlantisflut aus. Spuren ähnlicher Wirkung des Tertiärmondes kennen wir nicht. An Polverschiebung glaube ich nicht, die Einleitung rückschreitender Präzession wird nur sehr allmählich erfolgt sein, da der weit entfernte, kleine (Quatär-) Mond die Erde nur als Ganzes anpackt.
Auf dem Mond bewirkte die Erdanziehung bei der Aufzwingung der Sphäroidgestalt bei noch vorhandener Rotation und hoch aufrauschender Einfangsflut eine starke Zerklüftung der Eisschale, vielleicht bei starker Schollenverschiebung, wobei Wasser, die "Unebenheiten" ausfüllend, ausfror, Bildung der "Meere" beginnend.
Die Achsenaufrichtung des Mondes mag schwach begonnen haben. Bei 70 Erdradien Abstand (446 600 km) beträgt die Erdanziehung, g bei 45° = 9,806 m, erst 0,00201 m, bei 60 Erdradien (382 800 km) 0,00343 m und erfaßt erdnahe und erdferne Seite des Mondes noch fast gleich. Bei größerer Annäherung wächst das allerdings stark an, während die Mondanziehung auf der Erde selbst bei großer Annäherung über Dezimalstellen nicht hinauskommt.
Die Erschütterung und Umsetzung aus der Kugel zum Sphäroid löste auf der Erde die Atlantisflut aus. Spuren ähnlicher Wirkung des Tertiärmondes kennen wir nicht. An Polverschiebung glaube ich nicht, die Einleitung rückschreitender Präzession wird nur sehr allmählich erfolgt sein, da der weit entfernte, kleine (Quatär-) Mond die Erde nur als Ganzes anpackt.
Auf dem Mond bewirkte die Erdanziehung bei der Aufzwingung der Sphäroidgestalt bei noch vorhandener Rotation und hoch aufrauschender Einfangsflut eine starke Zerklüftung der Eisschale, vielleicht bei starker Schollenverschiebung, wobei Wasser, die "Unebenheiten" ausfüllend, ausfror, Bildung der "Meere" beginnend.
Die Achsenaufrichtung des Mondes mag schwach begonnen haben. Bei 70 Erdradien Abstand (446 600 km) beträgt die Erdanziehung, g bei 45° = 9,806 m, erst 0,00201 m, bei 60 Erdradien (382 800 km) 0,00343 m und erfaßt erdnahe und erdferne Seite des Mondes noch fast gleich. Bei größerer Annäherung wächst das allerdings stark an, während die Mondanziehung auf der Erde selbst bei großer Annäherung über Dezimalstellen nicht hinauskommt.
LANGE EINHOLUNGSZEIT
Darum hat einstweilen die Erde
schwache rückschreitende
Präzession und recht mäßige Sphäroidform, auch
noch mäßige Fluterscheinungen; doch auch diese durchzittern
schon die Gesteinskruste und die Magmaschale, und ich glaube, das ist
schuld, daß wir selbst in ganz wagerecht liegenden Schichten
keine unzerklüftete Gesteinsbank kennen. Das wird sich aber
erst in langer Zeit verstärken, wenn sich der Mond der Erde erst
stark nähert.
Wirkt aber die Flut schon jetzt
bei uns bremsend, so ist das beim Mond
erst recht der Fall. Die Erdflut wirkt bei ihm wie ein paar
Bremsbacken. Das Wasser unter seiner Eisdecke rauschte
zurückbleibend auf und verlangsamte deren Umlauf, was die Schollen
immer erneut in Unruhe brachte, die Bildung der "Meere"
fortsetzend. Aber auch der Mondkern wurde gebremst. Nach
und nach sank die Umdrehungsgeschwindigkeit des Mondes mehr und mehr,
die Sphäroidform ging, als Mondumdrehung und Mondumlauf sich
annähernd gleich wurden, zur Eiform über, nur noch ganz
schwach pendelnd (Libration). Von Erdnähe zu Erdferne
"atmete" noch die Eiform der Außenschale - das hauptsächlich
an dem für uns sichtbaren Mondumfange austretende und wieder
versinkende Wasser taute die Kraterböden aus. (Fauth, WEL 33, Heft
2.)
Allmählich sank der auch zur Ruhe kommende Mondkern, so in die Eiform ein, daß Schwerpunkt und Mittelpunkt um 60 km auseinanderliegen.
Dann fror auch noch das Wasser zwischen Schale und Kern aus. Jetzt kann der Mond seine Eiform nur dadurch verlängern, daß seine Eisschale unter dem Zuge der Erde wie Gletschereis plastisch nachgibt.
Allmählich sank der auch zur Ruhe kommende Mondkern, so in die Eiform ein, daß Schwerpunkt und Mittelpunkt um 60 km auseinanderliegen.
Dann fror auch noch das Wasser zwischen Schale und Kern aus. Jetzt kann der Mond seine Eiform nur dadurch verlängern, daß seine Eisschale unter dem Zuge der Erde wie Gletschereis plastisch nachgibt.
Nun hat die Erde aber den Mond
"an der Nase fest" und zwingt ihm für
die Dauer gleichen Tag und
Monat auf, seine Achse aufrichtend, seine Winkel- und Umdrehungszeit
immer beschleunigend.
Der Mond steigert umgekehrt seine Bremswirkung, die Sphäroidform der Erde, deren rückschreitende Präzession, erhebt langsam die rückschreitende Gürtelflut auf ihr und senkt Wasserstand und Lufthülle an den Polen.
Der Mond steigert umgekehrt seine Bremswirkung, die Sphäroidform der Erde, deren rückschreitende Präzession, erhebt langsam die rückschreitende Gürtelflut auf ihr und senkt Wasserstand und Lufthülle an den Polen.
VOR-, VOLL-, NACHWIRKENDE ZEIT DES GLEICHEN MOND- UND ERDENTAGES
Ist der Mond auf etwa 6½
Erdradien (41 470 km) an die Erde
herangesunken, so trennt er, die Tageslänge verlängernd, die
Flut in Zenit- und Nadirflut, die als Bremsbacken unablässig
weiterwirken, bis bei gleichwerdender Tages- und Mondumlaufszeit der
Mond nun auch Zeit gewinnt,
die Erde unter seiner Anziehungskraft zu verformen. Die
Sphäroidform setzt sich zur Eiform um. Jetzt kracht wirklich
die Erde bei Annahme dieser neuen Gleichgewichtsform in allen
Fugen. Die Aufwölbung des Eisrundes (mondabgekehrt), noch
mehr aber die der Eispitze, zieht die Kruste straff und muß
Hautverschiebungen und Sprünge erzeugen, die den Magmamassen die
Möglichkeit des Durchtretens geben.
Ganz wird der Mond noch nicht
in die Gleicherebene (Äquatorebene)
der Erde hineingezogen sein; er pendelt also und verzerrt die Kruste
über den Aufwölbungen auch noch hin und her. Wenn nun
auch die Magmaergüsse beim Erkalten die Kruste der Eispitze
verstärken und versteifen, so verfallen sie beim Austreten selbst
einem besonderen Schicksal. Sie bringen Glutmassen in die
Zenitflut, gewaltige Dampfzerknallungen müssen die Folge sein,
mächtige Bimssteinmassen werden erzeugt, später am Strande zu
Sand zerrieben. Mag auch bei solchen Ausbrüchen viel Wasser
gebunden werden, so wird doch noch genug übrig bleiben, um
später beim Vorrücken der Zenit-Nadir-Flut und
Gürtelflut große Abrasionsarbeit zu leisten und im Umkreise
Ablagerungen abzusetzen.
Verhältnismäßig
kurze Zeit haben nun Mond und Erde
gleichen Tag, Umlauf und Gestalt, beide Eiform, sie fassen sich
gewissermaßen gegenseitig an der Nase.
Vulkanausbrüche aus
trockener Oberfläche reichern die Luft
mit Kohlensäure und Wasserdampf an, stoßen Basalte und Laven
aus, bedecken die Umgegend mit Aschenmassen. Nicht ganz
empordringende finden wir als Gänge, Pfropfen oder Lakkolithen;
sie werden die besten Stützen für die körperliche
Eispitze der Erde.
Mond und Erde richten gegenseitig ihre Achsen weiter auf, die rückschreitende Präzession der Erde kommt nach und nach zum Stillstand.
Der Übergang vom voll- zum
nachstationären Zustande leitet
die Lösung dieser Art von Gegenseitigkeitszustand ein, der auf der
gleichen Winkelge- schwindigkeit von Erdumdrehung und Mondumlauf
beruhte.
Der Mond, über das
nachstationäre Stadium zum
Voreilungsstadium übergehend, steigert seine
Winkelgeschwindigkeit, behält selbst die Eiform bei, verliert aber
mehr und mehr die Zeit, der Erde die Eiform aufzuprägen, deren
Eispitze er nicht mehr mit herumzureißen vermag.
Die zeichnerische Darstellung
ergibt, daß auf der mondzugekehrten
Eispitze der Erde einer Erdanziehungskraft von im Mittel g = 9,806, auf
der Spitze etwa 9,75 m, eine Mondanziehungskraft von Gm = 0,005 m, auf
der mondabgekehrten Seite von nur 0,002396 m, in der Erdmitte 0,00347
m, gegenübersteht.

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 103, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 3
Abbildung 3
So kann nicht etwa die
Vorstellung zur Geltung kommen, als ob der Mond
auf die ihm nächsten Krustenteile der Erde einen abhebenden Zug
auszuüben vermöchte. Seine Dauereinwirkung ist eben nur
imstande, der Erde eine bestimmte Gleichgewichtsform
aufzuzwingen.
Das ist bei ungleicher Winkelgeschwindigkeit die Sphäroidform, bei gleicher oder nahezu gleicher wirklich die Eiform. Die Gegensätzlichkeit besteht darin, daß der Mond aus der Kugel in die Sphäroidform und rasch in die Eiform übergeht, die er dann bis zum Zerfall behält, während die Erde aus der Kugel zum Sphäroid, dann für verhältnismäßig kurze Zeit zur Eiform und nun über das Sphäroid wieder zur Kugel zurückgeht.
Die Zeichnung ergibt, daß selbst die Eiform der Erde sich von der reinen Kugel nur sehr wenig entfernt. Von einer Art Überkippung der Eiform kann nicht die Rede sein, die die Gebirgsbildungen bewirkende Verformung innerhalb der eigentlichen starren, kalten Gesteinskruste ist also nur auf innere Vorgänge zurückzuführen.
Das ist bei ungleicher Winkelgeschwindigkeit die Sphäroidform, bei gleicher oder nahezu gleicher wirklich die Eiform. Die Gegensätzlichkeit besteht darin, daß der Mond aus der Kugel in die Sphäroidform und rasch in die Eiform übergeht, die er dann bis zum Zerfall behält, während die Erde aus der Kugel zum Sphäroid, dann für verhältnismäßig kurze Zeit zur Eiform und nun über das Sphäroid wieder zur Kugel zurückgeht.
Die Zeichnung ergibt, daß selbst die Eiform der Erde sich von der reinen Kugel nur sehr wenig entfernt. Von einer Art Überkippung der Eiform kann nicht die Rede sein, die die Gebirgsbildungen bewirkende Verformung innerhalb der eigentlichen starren, kalten Gesteinskruste ist also nur auf innere Vorgänge zurückzuführen.
Nehmen wir an, der mit seiner
Knotenlinie in der Ekliptik und auf dem
Frühlingspunkte, also auch in der Gleicherebene
(Äquatorebene) stehende Mond habe im Augenblick höchsten
Vollstadiums die im Bilde dargestellte Eiform der Erde erzeugt.
Nun sei er nach sehr, sehr vielen Umläufen der Erde etwas
näher und in der Winkelgeschwindigkeit vorausgekommen und sei in
seiner Stellung um 25° vorgerückt.
Dann ist seine Zugrichtung gegen die höchste Erhebung der Eispitze noch so spitzwinklig, daß von seinem Herumreißen der Erde zu rascherer Umdrehungsbewegung noch gar keine Rede sein kann. Aber der Verlauf der Kraftlinien für das Vollstadium und das Nachstadium für 25° zeigt uns nun, daß er jetzt die Gleichgewichtsform der in der Winkelgeschwindigkeit hinter ihm zurückbleibenden Erde schief anpackt.
Dann ist seine Zugrichtung gegen die höchste Erhebung der Eispitze noch so spitzwinklig, daß von seinem Herumreißen der Erde zu rascherer Umdrehungsbewegung noch gar keine Rede sein kann. Aber der Verlauf der Kraftlinien für das Vollstadium und das Nachstadium für 25° zeigt uns nun, daß er jetzt die Gleichgewichtsform der in der Winkelgeschwindigkeit hinter ihm zurückbleibenden Erde schief anpackt.
Dann muß allmählich
das zähe, aber immerhin noch
bewegliche Magma dem neuen Zuge irgendwie nachgeben, Massen davon
müssen sich in der durch die angedeuteten Pfeile gezeigten
Richtung bewegen, um in die neue Gleichgewichtsform zu gelangen.
Dabei "schießen" die westlichen Massen, dem Monde folgend,
verhältnismäßig flach unter der Gesteinskruste hin, sie
wie bei einem in den Eisgang geratenden Flusse nach Osten
mitzerrend. Die östlichen Massen streben mehr von unter her
hebend der neu sich senkrecht unter dem Monde erhebenden Eispitze
zu. Ihre gemeinsame Einwirkung reißt hinter der alten,
schon verfestigten Eispitzenkruste die Gesteinshaut in Art und Form des
afrikanischen
Grabens und Roten Meeres auf - das ist vorzugsweise dem
schrägen Stoße der von Westen nach Osten
nachschießenden Magmamassen zuzuschreiben - und bringt sie, wenn
der Mondzug stark ist, auch in der Gleicherrichtung zum Aufplatzen, wie
das der Golf von Aden zeigt - das wird den senkrechter aufsteigenden,
aus östlicher Gegend stammenden Magmamassen zuzuschreiben sein.
So schneidet der Mond wirklich tiefe Runen in das Antlitz der Erde, aus denen Hinzpeter die Einwirkung von mindestens 6 Monden herausgelesen hat.
So schneidet der Mond wirklich tiefe Runen in das Antlitz der Erde, aus denen Hinzpeter die Einwirkung von mindestens 6 Monden herausgelesen hat.
Die wirklich ruckartigen
Bewegungen erfolgen aber lediglich innerhalb
der Erde und das eigentlich wirkende Element sind die Magmamassen, die
auf ihrem gewaltigen Rücken die dünne leichte Eierschale von
Gesteinskruste verdriften, zerklüften, zerknittern,
verbiegen. Es ist deshalb durchaus berechtigt, von Gebirgsbildung
durch kosmische Katastrophen zu sprechen, aber gemieden habe ich
Ausdrücke wie Verankerung, Losreißen, ruckartiges
Abschnellen des Mondes. Dieser zieht seine Bahn in
majestätischer Ruhe um die Erde, letztere erhebt und
läßt ihre Eiform aus der und in die Sphäroidform
während des vor-, voll- und nachstationären Zustandes unter
Rucken wieder versinken. Diese Rucke werden, der wachsenden
Annäherung des Mondes entsprechend, im nachstationären
Zustande stärker sein, deshalb habe ich den Vorgang erst hier
geschildert. Verwickelt wird er durch die Pendelung des Mondes
bei noch schiefer Bahnlage und dadurch, daß er sich bei der
Überrundung der Erddrehung wohl mehrfach wiederholt. Das hat
Hinzpeter in seiner "Entstehung der
Hochgebirge durch kosmische
Katastrophen" vortrefflich dargestellt. Seine
Gebirgsschleppen usw., die pazifische Wanne sind wirklich die Spuren
des letzten Tertiärmondes, die vom Kampfe des Erdinnern um die
wechselnde Gleichgewichtsform während der Stationärzeit
zeugen.
Das Nachschießen der
Magmamassen muß beschleunigend auf die
Erdumdrehung wirken und auch den Übergang zu vorschreitender
Präzession befördern. Die Rucke, mit denen dies
geschieht, mögen innerhalb langer Zeiten erfolgen, wenn sie aber
erfolgen, so sind sie wirklich kurzzeitig und müssen als ungeheure
Erderschütterungen fühlbar werden, auch vulkanische
Vorgänge auslösen und die beiden Flutkappen mächtig
aufrauschen, auch wohl aufkochen machen. Diese Erscheinungen
müssen im nachstationären Zustande stärker sein als im
vorstationären. Erstens, weil der (Tertiär) Mond dann
näher ist, zweitens, weil das Magma, der Erddrehung folgend, dem
Monde im späteren Stadium leichter nachschwappen wird, als im
früheren Stadium ihm entgegen.
Das allmähliche
Heraustreten des (Tertiär) Mondes aus dem
nachstationären Stadium, das etwa bei 5½ Erdradien (35 000
km) angenommen werden mag, beginnt schon wieder ein Langziehen der
Flutkappen zu erzeugen. Sein Zwang auf die Erde, die Eiform
anzunehmen, erlahmt - nicht, weil die Kraft, sondern weil die Zeit
fehlt, eine Erdgegend
genügend lange anzufassen.
VOREILUNGSZEITALTER
Die Zunahme der
Winkelgeschwindigkeit des (Tertiär) Mondes, der im
Westen auf- und im Osten unterzugehen beginnt, ist nun so groß,
daß die Erde aus der Ei- in die Sphäroidform
zurückgeht, was namentlich in den Breiten von 40°-50°
Verbiegungen, Spannungen, Verwerfungen auslösen muß.
Die voreilende Gürtelflut bildet sich heraus. Die
Tageslänge der Erde nimmt wieder etwas ab, die Aufrichtung der
Erdachse und vorschreitende Präzession setzt sich fort. Der
Zug des Gleicherwulstes (Äquatorwulst), dem Monde immer näher
als die Pole, holt den Mond in die Gleicherebene hinein. Die
Umdrehung des Mondes nimmt mit abnehmender Umlaufszeit zu, denn ihn
hält die Erde nach wie vor an der Eispitze fest. Inwieweit
sie seine Eiform länger ziehen kann, hängt von der
Biegsamkeit seiner Eisschale ab.
ANNÄHERUNG DES (Tertiär) MONDES AN SEINE ZERFALLSGRENZE
Das Voreilungszeitalter mag bis
zur Annäherung bis auf 2½
Erdradien (16 000 km) reichen, dann ist es um ihn geschehen.
Längst wird er in der Gleicherebene (Äquatorebene) umlaufen,
seine Achse auf seiner Bahn senkrecht stehen. Die Erde wird sehr
abgeplattet sein, besonders ihre Luftlinse.
ZERFALLSZEIT DES (Tertiär) MONDES
Kommt der Mond der Erde so
nahe, daß die Erdanziehung beim Monde
selbst der Mondanziehung gleich wird, so gilt die Gleichung ge/gm =
r²x²/r² also x = √
(9,806)/1,62 = 2,4603 Erdradien für die Rochesche Zone. In
diesem Abstande hält also den Mond nicht mehr seine eigene
Anziehungskraft, sondern nur noch die Zerreißfestigkeit seiner
Teile zusammen.
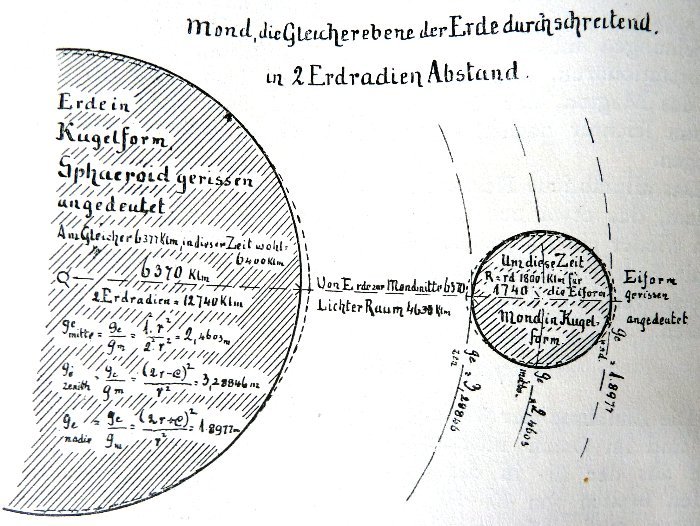
(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 105, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 4
Abbildung 4

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 106, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 5
Abbildung 5
Nun ist die
Zugfestigkeit des Eises gar nicht so gering; die Erde wird
also den Mond erst dann richtig zerreißen können, wenn ihre
Anziehungskraft die des Mondes sowohl auf der erdnahen, als auch auf
der erdfernen Seite wirklich überwiegt. Siehe obige
Abbildungen. Die bildliche Darstellung für 2 Erdradien
Abstand (Abbildung 4) von Mitte zu Mitte zeigt für die erdnahe
Mondseite ge = 3,28546 m, für die Mondmitte ge = 2,4603 m,
für die erdferne Seite ge = 1,8977 m und wie sehr sich der Mond
schon in Zonen von sehr verschiedener Erdanziehungskraft bewegt.
Das wird noch auffallender bei 1,8 Erdradien Abstand (Abbildung
5). Auch das soll bildlich und auch noch so dargestellt werden,
daß der Mond nun auch in seiner größten Abweichung von
der Gleicherebene ( = Äquatorebene) erscheint, um mit zu zeigen,
wie stark der Gleicherwulst (Äquatorwulst) der Erde befähigt
ist, den Mond in die Gleicherebene hinabzuziehen. - Siehe obige
Abbildungen.
Schon erfährt die erdnahe Mondseite fast den doppelten Erdzug, wie die erdferne, 4,20636 m gegen 2,2816 m, und der Erdzug übertrifft den Mondzug auf der erdfernen Seite um das 1½ fache. Bei 1,8 Erdradien (11 484 km) Abstand muß also der Mond spätestens zu Bruche gehen.
Schon erfährt die erdnahe Mondseite fast den doppelten Erdzug, wie die erdferne, 4,20636 m gegen 2,2816 m, und der Erdzug übertrifft den Mondzug auf der erdfernen Seite um das 1½ fache. Bei 1,8 Erdradien (11 484 km) Abstand muß also der Mond spätestens zu Bruche gehen.

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 108, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 6
Abbildung 6
Man sieht
auch, mit wie geringen Dezimalstellen der Mond auf die
mondnahe Erdseite wirkt und wie stark sein Zug bis zur mondfernen
Erdseite hin abfällt, daß er also auch die Linsengestalt der
Erde nicht allzu platt machen kann. Wirklich verzerren kann er
sie nicht; zur Erhaltung der Gürtelflut und starker Ausbauchung
der Luftlinse reicht es aber völlig aus.
Die bildliche Darstellung ist hier insoweit überholt, als um diese Zeit der Mond schon längst in der Gleicherebene umlaufen müßte; diese Art Wirkung begann schon vor dem Vorstationärstadium und hat sich seitdem stets gesteigert, um so mehr, als der Mond nur 1/80 der Erdmasse in die Wagschale werfen kann.
Auch die Mars-, Jupiter- und Saturnmonde laufen bei rund 6 Planetarischen Radien schon alle in der Gleicherebene um.
Ablösen müssen sich nun eine Zenit- und eine Nadirkappe, so, daß die Trennungsfuge bei der Auflagerung der Eis- auf die Gesteinsschale liegt, und so, daß die Bruchspalte annähernd der zugehörigen Zone der Erdanziehung folgt. Siehe Abbildung 6. Dabei mag zu größerer Bequemlichkeit von Abbildung und Rechnung nun angenommen werden, daß Erde und Mond Kugelgestalt hätten und der Mond und seine Trümmer konzentrische Kreisbahnen um den Erdmittelpunkt beschrieben. Zu welchen Abweichungen die Wirklichkeit führt, soll später nicht unerwähnt bleiben. Auch mag die Eisschale gleichmäßig und ohne Rücksicht auf die Eiform zu 270 km Dicke angenommen sein und der Schwerpunkt einer abfliegenden Eiskappe so liegen.
Die bildliche Darstellung ist hier insoweit überholt, als um diese Zeit der Mond schon längst in der Gleicherebene umlaufen müßte; diese Art Wirkung begann schon vor dem Vorstationärstadium und hat sich seitdem stets gesteigert, um so mehr, als der Mond nur 1/80 der Erdmasse in die Wagschale werfen kann.
Auch die Mars-, Jupiter- und Saturnmonde laufen bei rund 6 Planetarischen Radien schon alle in der Gleicherebene um.
Ablösen müssen sich nun eine Zenit- und eine Nadirkappe, so, daß die Trennungsfuge bei der Auflagerung der Eis- auf die Gesteinsschale liegt, und so, daß die Bruchspalte annähernd der zugehörigen Zone der Erdanziehung folgt. Siehe Abbildung 6. Dabei mag zu größerer Bequemlichkeit von Abbildung und Rechnung nun angenommen werden, daß Erde und Mond Kugelgestalt hätten und der Mond und seine Trümmer konzentrische Kreisbahnen um den Erdmittelpunkt beschrieben. Zu welchen Abweichungen die Wirklichkeit führt, soll später nicht unerwähnt bleiben. Auch mag die Eisschale gleichmäßig und ohne Rücksicht auf die Eiform zu 270 km Dicke angenommen sein und der Schwerpunkt einer abfliegenden Eiskappe so liegen.

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 108, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Mit dem
Augenblick der Ablösung unterliegen die Eiskappen dem 3.
Keplerschen Gesetz: "Die Quadrate der Umlaufszeiten verhalten sich, wie
die Kuben der mittleren Entfernungen."
Hat jetzt die Mondmitte 11 476 km Abstand und, nach Voigt "Eis ein Weltenbaustoff" 204 Minuten Umlaufszeit, so ergeben sich zum Umlauf für die erdnahe Kappe = 162,555 Minuten.
Die erdferne Kappe braucht 248,444 Minuten Umlaufszeit. Abbildung 7.
Hat jetzt die Mondmitte 11 476 km Abstand und, nach Voigt "Eis ein Weltenbaustoff" 204 Minuten Umlaufszeit, so ergeben sich zum Umlauf für die erdnahe Kappe = 162,555 Minuten.
Die erdferne Kappe braucht 248,444 Minuten Umlaufszeit. Abbildung 7.

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 109, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 7 (Mondzerfall)
Abbildung 7 (Mondzerfall)
Man sieht, daß innerhalb der Rocheschen Zone ein kugelförmiger Mond so zu rotieren anfangen müßte.

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 110, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Beim
eiförmigen Monde muß die Eispitze den Mondkern und das
Eirund mühsam mitschleppen - er muß
endlich auseinanderfliegen, wobei ganz klar wird,
daß dem Kernmonde das erdnahe
Stück vorauseilt, das erdferne Stück nachfolgt.
An Umlaufsweg hat das erdnahe Stück 61 921,43 km, der Mondkern 72 043,3 km, das erdferne Stück 82 160,0 km zurückzulegen. Die zugehörigen Geschwindigkeiten sind für das erdnahe Stück 6,4957 km/sec., den Mondkern 5,882 km/sec., das erdferne Stück 5,501 km/sec.
Nach einem Mondkernumlaufe hat das erdnahe Stück schon 16 157 km Vorsprung, das erdferne bleibt 14 697,33 km hinter dem Mondkern zurück, und das zuerst abgeflogene erdnahe Stück holt den Mondkern nach 3,832 Umläufen schon wieder ein, der Mondkern wird nach 5,590524 Umläufen wieder das zurückgebliebene, erdferne Stück neben sich haben. Zu solcher Einholung braucht das erdnahe Stück rund 13 Stunden 1,8 Minuten, das erdferne rund 19 Stunden 1 Minute. Der innere Ring schließt sich nach kaum mehr als ½ Tage, der äußere schon in weniger als einem ⅔ Tage. Es geht also wirklich katastrophal schnell.
An Umlaufsweg hat das erdnahe Stück 61 921,43 km, der Mondkern 72 043,3 km, das erdferne Stück 82 160,0 km zurückzulegen. Die zugehörigen Geschwindigkeiten sind für das erdnahe Stück 6,4957 km/sec., den Mondkern 5,882 km/sec., das erdferne Stück 5,501 km/sec.
Nach einem Mondkernumlaufe hat das erdnahe Stück schon 16 157 km Vorsprung, das erdferne bleibt 14 697,33 km hinter dem Mondkern zurück, und das zuerst abgeflogene erdnahe Stück holt den Mondkern nach 3,832 Umläufen schon wieder ein, der Mondkern wird nach 5,590524 Umläufen wieder das zurückgebliebene, erdferne Stück neben sich haben. Zu solcher Einholung braucht das erdnahe Stück rund 13 Stunden 1,8 Minuten, das erdferne rund 19 Stunden 1 Minute. Der innere Ring schließt sich nach kaum mehr als ½ Tage, der äußere schon in weniger als einem ⅔ Tage. Es geht also wirklich katastrophal schnell.
Das Abfliegen
der beiden Kappen bringt nun wirklich das vorhandene
Kippmoment zum Durchbruch. Wird auch nur der Unterschied von
Voreilen und Zurückbleiben der Kappenstücke eingesetzt und
angenommen, daß Kappen von 60° Zentriwinkel abgeflogen sind,
so erhalten wird 613,7-381,8 = 232,7 m an Drehgeschwindigkeit.
Dreht sich nun das Kernstück um die auf der Umlaufsebene senkrecht
stehende Achse, so stehen nach 60° Drehung wieder zwei Kappen so
zur Erde, daß auch sie abfliegen müssen. Diesen
Drehungsweg 2x1740pi/6 = 3 122 000 m legen sie in 13 456 Sekunden
zurück, fliegen also nach 3 Stunden 44 Minuten ab, und nach
gleicher Zeit folgt wieder ein Kappenpaar, mit gleicher Voreilung und
Zurückbleibung wie das erste. Damit ist die Mondgleicherzone
abgeschält; von den beiden verbliebenen Polkappen muß eine
die schwerere sein und von der Erde nach Art einer Pendelschwingung in
die Umlaufebene des Mondes hinabgezogen werden.
Formel
für den Fall der 60° = Kappe: (pi/6) [√ (1 • P)/gp],
wobei 1 der Mondradius, P das Mondgewicht, p das Übergewicht der
schwereren Polkappe, g = 3,0971 für die Mondmitte ist. Das
ergibt 16 Stunden 29,4 Minuten, Näherungswert.

(Bildquelle/text:
Buch "Planetentod und
Lebenswende" von H.W. Behm / Zeichnung Alfred Hörbiger)
Die im Gang
befindliche Mondauflösung
Nach 7,28
Stunden ist also der Mond seine Gleicherzone aus Eis, nach
weiteren 2x16 Stunden 29 Minuten 4 Sekunden rund 33 Stunden auch seine
Polkappen aus Eis losgeworden. Das Kippmoment teilt sich auch den
abfliegenden Eiskappen mit; bei dieser Drehung kommen sie bald genug in
strahlenförmige Stellung zur Erde und damit in Zonen verschiedener
Anziehung, sie zerbröckeln also weiter und verteilen sich, auch im
einzelnen voreilend oder zurückbleibend, auf dem Ringumfange.
Der Gesteinsmantel wird nicht minder schlecht behandelt. Er wurde bei dem ersten Kippen um die Polachse schon durch Zonen verschiedener Erdanziehung hindurchgezogen, beim Kippen der Polkappen nun auch noch in querer Richtung dazu durchgewalkt, er fliegt ab und zerfällt in gleicher Weise und ähnlichem Tempo wie die Eisschale. Ähnlich folgen die Erzstücke und zum Schluß der gediegene Metallkern. Das Ergebnis ist ein Ringsystem von Trümmern in folgender Anordnung von außen nach innen: Eistrümmerring, Gesteinsring, Erz- und Metallring, Gesteinstrümmerring, Eistrümmerring, die mit verschiedener, ihrem Abstande von der Erde gemäßer Geschwindigkeit kreisen, in der Gleicherebene der Erde umlaufen und wohl auch eine wesentlich größere Breitenausdehnung einnehmen, als die Längsachse der früheren Eiform des Mondes.
Der Gesteinsmantel wird nicht minder schlecht behandelt. Er wurde bei dem ersten Kippen um die Polachse schon durch Zonen verschiedener Erdanziehung hindurchgezogen, beim Kippen der Polkappen nun auch noch in querer Richtung dazu durchgewalkt, er fliegt ab und zerfällt in gleicher Weise und ähnlichem Tempo wie die Eisschale. Ähnlich folgen die Erzstücke und zum Schluß der gediegene Metallkern. Das Ergebnis ist ein Ringsystem von Trümmern in folgender Anordnung von außen nach innen: Eistrümmerring, Gesteinsring, Erz- und Metallring, Gesteinstrümmerring, Eistrümmerring, die mit verschiedener, ihrem Abstande von der Erde gemäßer Geschwindigkeit kreisen, in der Gleicherebene der Erde umlaufen und wohl auch eine wesentlich größere Breitenausdehnung einnehmen, als die Längsachse der früheren Eiform des Mondes.
RINGZEIT
Bei solchem
Breiten- und Dickenmaß ist der Ring reichlich dicht
gefüllt, seine Teile können nur unter großer innerer
Reibung umlaufen. Die Folge wird eine Verbreiterung nach innen
sein, die z. B. bei unserem Mond-Ringe bis zu 3700-3800 km ansteigen
kann. Der Ring wird also wohl stets breiter werden, als der
Eidurchmesser des Mondes, aus dem er hervorgegangen ist. Dann
erst tritt ruhiges Ausschweben ein. - Die Erde, die nun dauernd Zug von
allen Seiten erfährt, behält ihre nun wirklich abgeplattete
Sphäroidform, wie auch das Beispiel des Saturn
zeigt, macht aber sonst bei sehr abgeplatteter Luftlinse und stehender
Gürtelflut eine Zeit friedlicher Ruhe durch.
Der Mondzerfall geht, wie hier gezeigt, sehr katastrophal, zu deutsch, umstürzlerisch, vor sich, besonders wenn man die eintretenden Kippungen bedenkt. Die bildenden Gesetze werden bei einem neptodischen Monde die gleichen sein, das Verhalten des Baustoffes aber ein anderes. Zunächst wird sich das überfrorene Wasser-Eis mit wachsender Annäherung immer länger ziehen, wobei die Eis-Rinde sternförmige und netzartige Sprünge bekommen muß. Tritt Wasser aus, so gehts damit wie bei dem bekannten Experiment mit der wassergefüllten Bombe, die durch Einfrieren gesprengt wird, wobei das herausspritzende Wasser zum Eisbart gefriert.
Der Mondzerfall geht, wie hier gezeigt, sehr katastrophal, zu deutsch, umstürzlerisch, vor sich, besonders wenn man die eintretenden Kippungen bedenkt. Die bildenden Gesetze werden bei einem neptodischen Monde die gleichen sein, das Verhalten des Baustoffes aber ein anderes. Zunächst wird sich das überfrorene Wasser-Eis mit wachsender Annäherung immer länger ziehen, wobei die Eis-Rinde sternförmige und netzartige Sprünge bekommen muß. Tritt Wasser aus, so gehts damit wie bei dem bekannten Experiment mit der wassergefüllten Bombe, die durch Einfrieren gesprengt wird, wobei das herausspritzende Wasser zum Eisbart gefriert.
So fließt bei einem neptodischen Monde das Wasser beim Zerbersten gleich in der Ring-Richtung voraus oder hinten nach, erstarrt dann aber.
Diese
vorauswachsenden und nachhängenden Bärte, an der Wurzel
noch immer bildsam nachgeschoben, während die Eisschale nach und
nach einbricht und in Stücken mit fortschwimmt, holen das
Mittelstück in gleicher Weise und in gleichen Zeiten ein, wie bei
einem heliotischen Monde die abfliegenden und zerbröckelnden
Eiskappen und Gesteinstrümmer, und der Vorgang endet erst, wenn
der Wasservorrat des erzeugenden Mondes aufgezehrt ist. Das
allmähliche Ausziehen aus Kugel- und Eiform zum Ringe wird durch
die Abbildung 8 erläutert. Backen durch Regelation die
Eisringtrümmer zusammen, so gewinnt die Ringscheibe durchweg
gleiche Winkel- und Umlaufsgeschwindigkeit und würde, vor
Schrumpfung geschützt, das Privilegium ewiger Dauer in sich
tragen, - wenn, ja wenn sie wirklich kreisförmig und konzentrisch
mit dem Planeten wäre.

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 112, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 8
Abbildung 8
Nun
müssen aber die Ringteile gemäß dem 1. Keplerschen
Gesetz elliptische Bahnen einschlagen, in denen sie sich nach dem 2.
Keplerschen Gesetz mit ungleichförmiger Geschwindigkeit
bewegen. Das muß zum Zerbrechen der aus einem
wässerigen Monde herauswachsenden Eisbärte führen.
Nun besagen ferner Messungen des Saturn und seiner Ringe, daß
Saturnmitte und Ringmitte um 700 km auseinanderliegen, also fehlt die
Kreisform und ein gemeinsamer Mittelpunkt, so daß man folgern
muß, daß die Saturnringe schon beim Entstehen in Schollen
zerbrochen sind, die, wie die Treibeisschollen auf einem eben
zufrierenden Flusse dicht gepackt dahertreibend, die bekannte
Eierkuchenform angenommen haben, auf ihren Rändern und zwischen
einander zermahlenes Eis mitführend, und innen mit
größerer, außen mit geringerer Geschwindigkeit
umlaufend, einen mahlenden Wirbel bilden. Dieser kann sich
infolge der inneren Reibung sehr verbreitert haben, namentlich nach
innen zu.
Eine
Erwägung soll wenigstens nicht unterlassen werden: Infolge
innerer Reibung kann die Ringmasse der einzelnen Ringe gleiche
Winkelgeschwindigkeit angenommen haben und durch Zusammenbacken
(Regelation) starr geworden sein, und elliptische Längen
können sich beim Anbranden der Ringe gegeneinander rund
geschliffen haben. Dafür spräche die Angabe, daß
wechselnde Breiten der Kassiniteilung beobachtet seien, und der
Schattenwurf an den Ringrändern an der Kassiniteilung.
Daß ein solches, ausgefrorenes Gebilde sich statisch tragen kann,
hat Hanns Hörbiger nachgewiesen.
Ob die Ringe wirklich kreisförmig geworden sind, werden wir nur sehr schwer feststellen können, denn wir sehen niemals senkrecht auf sie.
Ob die Ringe wirklich kreisförmig geworden sind, werden wir nur sehr schwer feststellen können, denn wir sehen niemals senkrecht auf sie.

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 114, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 9
Abbildung 9
Es ist
immerhin nützlich, die Anziehung des Saturn auf seine Ringe
zu prüfen. Er hat am Gleicher ein G von 8,8 m (an den Polen
12,2 m). Im inneren, hellen Hauptringe, dessen Mittelkreis 1,65
Saturn Radien (Gleichermaß) Abstand hat, beträgt G nur noch
3,2 m, im äußeren Ringe, dessen Mittelkreis 2,04 Saturn
Radien hat, ist G nur noch 2,2 m.
Ohne weiteres sieht man, daß die Ringe schon weit innerhalb der Rocheschen Zone schweben - auch sonst paßt ihr Abstand in die Entfernungsreihe der Saturnsatelliten gut hinein: Bondscher Ring 1,25 Sat. Rad., Innerer Ring 1,65 Sat. Rad., Äußerer Ring 2,04 Sat. Rad., Mimas 3,01 Sat. Rad., Enceladus 4,00 Sat. Rad., Tethys 5,01 Sat. Rad., Dione 6,40 Sat. Rad., Rhea 8,93 Sat. Rad., Titan 20,71 Sat. Rad., Hyperion 25,12 Sat. Rad., Japetus 60,23 Sat. Rad. Sie sind geradezu Schulbeispiele für die verschiedenen, hier vorstehend zergliederten Abschnitte des Mondlebens.
Ohne weiteres sieht man, daß die Ringe schon weit innerhalb der Rocheschen Zone schweben - auch sonst paßt ihr Abstand in die Entfernungsreihe der Saturnsatelliten gut hinein: Bondscher Ring 1,25 Sat. Rad., Innerer Ring 1,65 Sat. Rad., Äußerer Ring 2,04 Sat. Rad., Mimas 3,01 Sat. Rad., Enceladus 4,00 Sat. Rad., Tethys 5,01 Sat. Rad., Dione 6,40 Sat. Rad., Rhea 8,93 Sat. Rad., Titan 20,71 Sat. Rad., Hyperion 25,12 Sat. Rad., Japetus 60,23 Sat. Rad. Sie sind geradezu Schulbeispiele für die verschiedenen, hier vorstehend zergliederten Abschnitte des Mondlebens.
Auch lohnt es
sich wohl, aus den uns bekannten Abmessungen der
Saturnringe die Größe der einstigen Monde, aus denen sie
entstanden sind, rückwärts zu berechnen.
Äußerer Ring 15 800 km Breite, 40 km Dicke (nach Bessel 220 km, nach Tisserand nur 40 km), 2,04 Sat. Rad. Abstand, Sat. Rad. 60 300 km,
V = 4/3r³pi, r = ³√ (3v/4pi), Durchmesser der früheren Mondkugel 9771,32 km.
Mittlerer Ring 31 700 km Breite, 40 km Dicke, 1,65 Sat. Rad. Abstand, Durchmesser der früheren Mondkugel 11 482,26 km. Dieser Ring muß durch den Zug des äußeren Ringes einerseits, des Saturn andererseits stark in die Breite gezogen sein, nachdem schon der Mond selbst zu sehr langer Eisspindel ausgezogen war, und dieses Langziehen, das stattgefunden haben muß, auch bei aller sonstigen Breitenentwicklung des Ringes, erweist uns die ursprüngliche, wässrige Natur der einstigen Monde.
Den Bondschen Ring, wegen unbekannter Abmessungen nicht nachgerechnet, halte ich für den Rest eines größtenteils bereits abgestürzten Ringes. Dafür spricht seine unsichere Begrenzung und Durchsichtigkeit.
Auf sein Engerwerden hat schon O. Struve 1851 aufmerksam gemacht. (E. Becker, Sonne und Planeten 1883.)
Äußerer Ring 15 800 km Breite, 40 km Dicke (nach Bessel 220 km, nach Tisserand nur 40 km), 2,04 Sat. Rad. Abstand, Sat. Rad. 60 300 km,
V = 4/3r³pi, r = ³√ (3v/4pi), Durchmesser der früheren Mondkugel 9771,32 km.
Mittlerer Ring 31 700 km Breite, 40 km Dicke, 1,65 Sat. Rad. Abstand, Durchmesser der früheren Mondkugel 11 482,26 km. Dieser Ring muß durch den Zug des äußeren Ringes einerseits, des Saturn andererseits stark in die Breite gezogen sein, nachdem schon der Mond selbst zu sehr langer Eisspindel ausgezogen war, und dieses Langziehen, das stattgefunden haben muß, auch bei aller sonstigen Breitenentwicklung des Ringes, erweist uns die ursprüngliche, wässrige Natur der einstigen Monde.
Den Bondschen Ring, wegen unbekannter Abmessungen nicht nachgerechnet, halte ich für den Rest eines größtenteils bereits abgestürzten Ringes. Dafür spricht seine unsichere Begrenzung und Durchsichtigkeit.
Auf sein Engerwerden hat schon O. Struve 1851 aufmerksam gemacht. (E. Becker, Sonne und Planeten 1883.)
Folgende Tabelle wird angegeben:
| Ringbreite |
Breite
des dunklen Zwischenraumes |
Verhältnis
beider |
||
| 1657 1695 1719 1799 1826 1838 1851 |
Huyghens Huyghens + Cassini Bradley W. Herschel W. Struve Eucke und Galle O. Struve |
4,6 5,1 5,7 5,98 6,14 7,06 7,43 |
6,5 6,0 5,4 5,12 4,36 4,04 3,67 |
1,41 1,18 0,95 0,86 0.64 0,57 0,49 |
Dagegen wird an gleicher Stelle angeführt, daß
| 1853 1866 |
Main Kaiser |
6,42 5,81 |
5,13 5,29 |
0,80 1,10 |
gefunden
hätten und die Schrumpfung wohl nur auf Ungenauigkeiten
der Messungen zurückzuführen sei. Ob neuere
Beobachtungen die Schrumpfung, die ich für unausbleiblich halte,
doch bestätigen, habe ich nicht in Erfahrung bringen können;
wäre es der Fall, so wäre meine Ansicht der Zusammen- setzung
der Saturnringe aus Treibeisschollen bestätigt. Ein wirklich
konzentrischer Ring könnte ausgefroren sein und brauchte nicht zu
schrumpfen.
Für
nicht ausgefroren halte ich den Bondschen Ring, weil ich
überzeugt bin, daß der Aufsturz eines aus demselben
abgestürzten Eisstückes auf den Saturn den in diesem Sommer
(im Jahr 1933) auf ihm sichtbar gewordenen weißen Fleck erzeugt
hat. Dringt ein solches Stück in die Lufthülle des
Saturn ein, so wird es in ihr ebenso zu Hagel zerkleinert, wie das auch
auf der Erde geschieht (vergl. Z. WEL 1933, Heft 6 oder Aufruhr im
Luftozean). Die Trümmer durchfahren auf dem Saturn eine
eiskalte Lufthülle, -150°, (Z. WEL, Heft 7, Seite 200) von
gewaltiger Höhe -
10-15 000 km (ebenda) - finden in ihr nichts abzuschmelzen und nichts zu kondensieren und schlagen schmetternd auf die kalte, trockene, harte Eisdecke des Planeten auf, wobei sie zerstäuben, und auf dem Grunde der Lufthülle, wenn sie mit Kohlenoxyd oder Kohlensäure angereichert ist, (Z. WEL. 1933, Heft 7, Seite 200) vielleicht auch noch Bodennebel erzeugen. Wie käme der Fleck gerade auf die Gleichergegend, wenn sein Erzeuger nicht aus dem Bondschen Ring gekommen wäre?
10-15 000 km (ebenda) - finden in ihr nichts abzuschmelzen und nichts zu kondensieren und schlagen schmetternd auf die kalte, trockene, harte Eisdecke des Planeten auf, wobei sie zerstäuben, und auf dem Grunde der Lufthülle, wenn sie mit Kohlenoxyd oder Kohlensäure angereichert ist, (Z. WEL. 1933, Heft 7, Seite 200) vielleicht auch noch Bodennebel erzeugen. Wie käme der Fleck gerade auf die Gleichergegend, wenn sein Erzeuger nicht aus dem Bondschen Ring gekommen wäre?
ABSINKEN DES RINGES
Wie lange ein
oder gar mehrere Ringe den einfangenden Planeten
umschweben können, lehren die Saturnringe. Die Ursache des
endlichen Absturzes wird aber weniger auf dem bahnverengenden
Weltraumwiderstande, als auf der inneren Reibung der Ringtrümmer
aneinander beruhen. Denn so locker wie der Asteroiden-Ring wird
ein Mondring gewiß nicht, und sei er noch so sehr in die Breite
gezogen.
Die inneren
Ringteile, die die rascheste Bewegung haben
müßten, erfahren gerade die stärkste Reibung und kommen
dadurch zu immer spiraligeren Bahnen, die sich schließlich der
Luftlinse des Planeten nähern, wobei sie auch noch in Zonen immer
stärker werdender Planetenanziehung gelangen. So müssen
die Einstürze auf dem Planeten sich häufen. Damit wird
wieder die Planetenmasse verstärkt, ihre Anziehungskraft
wächst an sich, und das
wirkt wieder zusammenziehend auf die Bahnen der Ringteile. Die
Erde wird daher bei Niedersturz des Jetztmondes (wie beim
Vormond = Tertiärmond!! , Anm.. WEL-Institut)
zunächst beim Einsinken des inneren Eistrümmerringes durch
schwere Hagelerscheinungen beglückt werden, denen ein schlimmes
Feuerwerk und Staubverdunkelung durch Einsturz des inneren
Gesteinstrümmerringes folgen muß, wobei auf Aufspaltung der
Gesteins- stücke durch die Luft wenig zu hoffen ist. Der
Stein von Ensisheim und die sibirischen Meteoriten werden schlimme und
entsetzlich zahlreiche Neuauflagen erfahren. Die Erz- und
Metalltrümmer des Mondkernes kann der Luftmantel schon gar nicht
abbremsen - die mit solchen Einschüssen verbundenen
Feuererscheinungen werden die ganze Lufthülle in Mitleidenschaft
ziehen. Ihr schiefer Stoß muß die ganze
Lufthülle erzittern machen und die Erdumdrehung
beschleunigen. Auch ist wohl anzunehmen, daß es sich bei
ihnen um verhältnismäßig wenige, dafür aber um so
größere Stücke handeln wird.
Mögen die kleineren unter ihnen in Form geologisch als Fremdlinge anzusprechender Erzstücke auf der Erdoberfläche gefunden werden, so werden die Großtrümmer, besonders der eigentliche Metallkern des Mondes, die Wucht in sich tragen, die Gesteinskruste der Erde wie eine Vollkugel zu durchschlagen und bis ins Magma einzudringen. Ihre Spur muß sichtbar bleiben (vergl. Abbildung 10, Aufwulstung um die Einschußstelle herum, Ausfüllung der hufeisenförmigen Einschußfurche durch Schutt und Meeresschlamm, vulkanische Ausquellungen ringsherum.)
Mögen die kleineren unter ihnen in Form geologisch als Fremdlinge anzusprechender Erzstücke auf der Erdoberfläche gefunden werden, so werden die Großtrümmer, besonders der eigentliche Metallkern des Mondes, die Wucht in sich tragen, die Gesteinskruste der Erde wie eine Vollkugel zu durchschlagen und bis ins Magma einzudringen. Ihre Spur muß sichtbar bleiben (vergl. Abbildung 10, Aufwulstung um die Einschußstelle herum, Ausfüllung der hufeisenförmigen Einschußfurche durch Schutt und Meeresschlamm, vulkanische Ausquellungen ringsherum.)
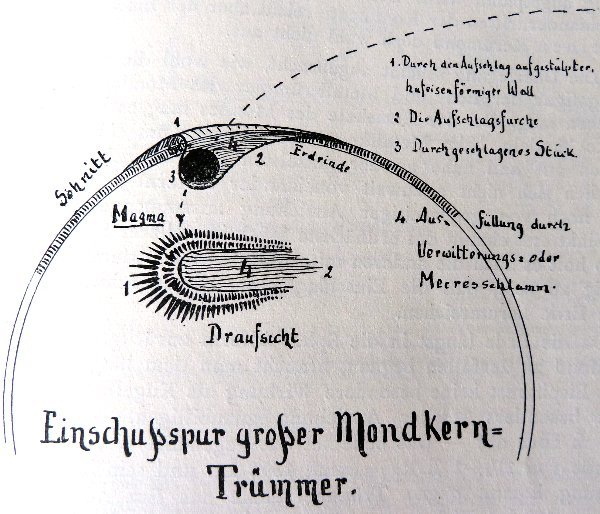
(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 117, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 10
Abbildung 10
Die
Eindringlinge, durch die Bremsung des Aufsturzes schon innerlich
vorgewärmt, müssen im Magma völlig zerschmelzen und
ihrem eigenen spezifischen Gewicht entsprechend, dem Erdinnern langsam
zusinken. Anfangs aber müssen sie wie exzentrisch
angebrachte Schwunggewichte wirken und sehr merkliche
Achsenschwankungen der Erde hervorrufen.
Der
neuerliche Massenzuwachs der Erde holt dann auch den
äußeren Gestein- und Eistrümmerring um so rascher
herab. Die Auflagerung der Einsturz- massen wird zwar vorwiegend
in den Gleicherebenen geschehen, es ist aber durchaus nicht als sicher
anzusehen, daß sie ganz gleichmäßig verteilt
werden. Weitere Achsenschwankungen, Magmaverlagerungen und
Krustenwanderungen müssen die Folge sein, während die Kruste
selbst durch die Anreicherung des Erdinneren durch die
durchgeschlagenen Kernmondtrümmer ganz gewaltig angespannt
wird. Die Kruste muß Risse bekommen; zu einem
Auseinanderdriften der Kontinente reicht aber der Innenzuwachs durch
nur einen Kernmond doch wohl
nicht aus.
Die
Überlegung scheint angebracht, wie wohl die ballistische
Einschlagsfigur der Erd- und Metalltrümmer des Mondes auf der Erde
aussehen mag. Bei der Erzschale des Mondes mag es sich um wenige
Stücke handeln, beim Metallkern vielleicht nur um ein
einziges. Alle werden auf und nahe an der mittelsten Bahn
umgelaufen sein und brauchen sich nicht allzuweit voneinander entfernt
zu haben, mögen auch noch von gegenseitiger Anziehung
zusammengehalten werden.
Sinkt erst einmal das erdnächste Stück in steilerer Spirale der Erde zu, so holt es auch die anderen mit, und es braucht durchaus nicht notwendig zu sein, daß die Einschlagsspuren dieses Schwarmes um die ganze Erde herumreichen.
Sinkt erst einmal das erdnächste Stück in steilerer Spirale der Erde zu, so holt es auch die anderen mit, und es braucht durchaus nicht notwendig zu sein, daß die Einschlagsspuren dieses Schwarmes um die ganze Erde herumreichen.
Da die Erde
längst in die Sphäroidform zurückgesunken
war, als der (Tertiär) Mond zu zerfallen begann, braucht man dem
längst miteingesunkenen Eispitzrest keine besondere Wirkung als
Kugelfang oder gar als Punkt besonders starker Anziehung
zuzubilligen. Ragte er selbst 10 000 m hoch auf - was bedeutet
das gegenüber einem lichten Ringabstande von 1½ - 1
Erdradien und sein bißchen Sonderanziehung kommt gegen
Trümmerstücke aus Erz oder Metall von mehreren 100 km Dicke
gar nicht merklich in Betracht.
Hinzpeter
sieht im Bismarck-Archipel die Einschußspur eines
mächtigen Mondkernstückes und betrachtet auch die Almiranten,
Komoren, Seychellen, Maskarenen als Spuren eines
Trümmerschwarmes. Ich stimme ihm zu. Auch glaube ich,
daß die Banda-See in den Molukken die Spur eines doppelten Einschusses bedeutet.
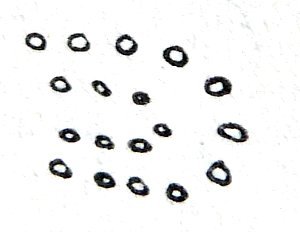
(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 118, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Wenn ich als
Ballistiker im Maskarenenbogen nun die
Einschußspuren des Hauptschwarmes und im Bismarck-Archipel und
der Banda-See die oberen Gabeläste der Weitgänger sehe, so
fehlt mir allerdings mindestens ein Kurzgänger, den ich in dem
Bogen der großen Antillen vermute (Abbildung 11). Nicht im
Zusammenhange mit diesen Einschüssen sehe ich den Inselbogen von
der Südspitze Patagoniens über die St. Georgia-, Travers-,
Süd- Orkneys-, Elephant-, Süd-Schottland-Inseln bis zur
Nordspitze von Grahamland mit sehr mißtrauischen Augen an.
Meine geologischen Kenntnisse reichen aber nicht aus, um auf Grund der
hier gestörten Formationen die Nummer des (Vorgänger) Mondes
festzustellen, der diese Einschußspur hinterlassen haben mag.

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 119, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Abbildung 11
Abbildung 11
Der
Einschuß des Mondkerns steigert, wie schon gesagt, die
Anziehungskraft der Erde, die den Rest des Ringes um so rascher zum
Nachfolgen zwingen kann. Danach geht sie wieder in die Kugelform
zurück, nur noch durch den Umschwung ausgebaucht, die
Gürtelflut läuft auseinander, die Luftlinse nimmt die
Kugelform auch wieder an, die Eiskappen der Pole schmelzen ab.
Exzentrisch und nicht gleichmäßig um den Gleicherumfang herumgefallene Mondmassen werden auch noch zu Krustenwanderungen und Verschieb- ungen der Kruste über die Pole hinweg führen. Danach tritt die glückliche Ruhe des mondlosen Zeitalters für Flora und Fauna ein, wenn nicht die Wassermassen des jetzigen Mondes die Erde ringsum als tiefes Meer bedecken.
Exzentrisch und nicht gleichmäßig um den Gleicherumfang herumgefallene Mondmassen werden auch noch zu Krustenwanderungen und Verschieb- ungen der Kruste über die Pole hinweg führen. Danach tritt die glückliche Ruhe des mondlosen Zeitalters für Flora und Fauna ein, wenn nicht die Wassermassen des jetzigen Mondes die Erde ringsum als tiefes Meer bedecken.
Darum lohnt
wohl eine Untersuchung, wie hoch die einzelnen
Stoffschichten des Mondes die Erde bedecken mögen.
Angenommen wird eine Eisschale von 280 km Dicke, eine Gesteinsschale
von 660 km, ein Metallkern von 800 km Halbmesser. Die zu Wasser
werdende Eisschale des Mondes würde die Erde 17,7 km hoch
bedecken; sie reichert erst die Gürtelflut an und zerfließt
dann mit dieser.
Die Gesteinsschale würde weitere 22,7 km Aufschüttung, verteilt über die ganze Erde, hinzubringen. Zunächst fällt sie aber in Gürtelform um die Gleicherzone herum. Nehmen wir an in nebenstehender Anordnung:
Die Gesteinsschale würde weitere 22,7 km Aufschüttung, verteilt über die ganze Erde, hinzubringen. Zunächst fällt sie aber in Gürtelform um die Gleicherzone herum. Nehmen wir an in nebenstehender Anordnung:

(Bildquelle: "Zeitschrift für
Welteislehre", Nr. 4, S. 120, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken,
Berlin)
Dieser Wulst
müßte 79,52 km Dicke haben. Nun
stürzt er in die Gürtelflut, die stark für seine
Ausbreitung sorgen würde; andernfalls müßte er 61,8 km
über das Meer hervorragen. Das ist nicht gut denkbar; er
würde vielmehr die Erdhaut niederdrücken, um so die
Gleichgewichtsgestalt der Erde hergestellt zu sehen.
Magmaverlagerungen, Krustenverschiebungen werden unvermeidlich sein;
ein Gesteinstrümmerring wird ferner vor, der andere nach dem
Einsturz des Mondkerns niederbrechen.
Durch den Einschuß des Mondkernes gewinnt die Erde noch weiteren Zuwachs, der die Gesamtbedeckung auf 42,8 rund 43 km Dicke, auf die ganze Erdoberfläche verteilt, bringen muß. Daß dieser Zuwachs wegen Durchschusses durch die Gesteinshaut von innen heraus anspannend wirkt, ist schon ausgeführt. So ergibt sich, daß der endliche Niedersturz des Jetztmondes alle die Spuren seiner Vor-, Haupt- und Nachstationärzeit usw. hoch zudecken wird.
Durch den Einschuß des Mondkernes gewinnt die Erde noch weiteren Zuwachs, der die Gesamtbedeckung auf 42,8 rund 43 km Dicke, auf die ganze Erdoberfläche verteilt, bringen muß. Daß dieser Zuwachs wegen Durchschusses durch die Gesteinshaut von innen heraus anspannend wirkt, ist schon ausgeführt. So ergibt sich, daß der endliche Niedersturz des Jetztmondes alle die Spuren seiner Vor-, Haupt- und Nachstationärzeit usw. hoch zudecken wird.
Was lehrt uns
nun die Tatsache, daß wir die Spuren der
Wirksamkeit zahlreicher, früherer Monde auf der Erde noch zu
erkennen vermögen?
Das, daß die früheren Monde der Erde nur wenig Wasserzuwachs und ganz wenig Schuttzuwachs eingebracht haben, der von der Gürtelflut weithin und dünn ausgebreitet sein muß.
Sie müssen also der jetzigen Erde sehr ähnlich gewesen sein, aus "Sonnenweite 1" stammen.
Das gibt dem Ausspruche des berühmten Geographen Ratzel (Die Erde und das Leben, 1901, I Seite 91, worin er Hypothesen von der Entstehung der Erde aus zusammengestürzten kleinen Weltkörpern bespricht), eine merkwürdige Bestätigung. Das läßt ferner erkennen, wie es gekommen ist, daß die Erde, nur um geringe Dezimalstellen vom Merkur übertroffen, fast der dichteste Körper des ganzen Sonnensystems ist, es lehrt aber auch, daß der ganz anders geartete Mond gar nicht in unsere Gegend gehört, und daß Hörbiger und Voigt recht haben, wenn sie behaupten, er sei, vom Mars aus der Asteroidengegend herausgefischt, der Erde in die Quere geworfen worden. Die schiefe Lage der Mondbahn zur Ekliptik, 5°, läßt den gleichen Schluß zu.
Das, daß die früheren Monde der Erde nur wenig Wasserzuwachs und ganz wenig Schuttzuwachs eingebracht haben, der von der Gürtelflut weithin und dünn ausgebreitet sein muß.
Sie müssen also der jetzigen Erde sehr ähnlich gewesen sein, aus "Sonnenweite 1" stammen.
Das gibt dem Ausspruche des berühmten Geographen Ratzel (Die Erde und das Leben, 1901, I Seite 91, worin er Hypothesen von der Entstehung der Erde aus zusammengestürzten kleinen Weltkörpern bespricht), eine merkwürdige Bestätigung. Das läßt ferner erkennen, wie es gekommen ist, daß die Erde, nur um geringe Dezimalstellen vom Merkur übertroffen, fast der dichteste Körper des ganzen Sonnensystems ist, es lehrt aber auch, daß der ganz anders geartete Mond gar nicht in unsere Gegend gehört, und daß Hörbiger und Voigt recht haben, wenn sie behaupten, er sei, vom Mars aus der Asteroidengegend herausgefischt, der Erde in die Quere geworfen worden. Die schiefe Lage der Mondbahn zur Ekliptik, 5°, läßt den gleichen Schluß zu.
Indessen -
Fremdling oder nicht, zerrissen wird er doch, und wie er
seinerseits erst Runen in das Gesicht der Erde schneiden und sie dann
zudecken wird, haben wir ausgerechnet. Gut, daß wir die
Bestätigung nicht mehr erleben werden.
Generalmajor a. D. Haenichen
(Quelle: Monatsheft "Zeitschrift für Welteislehre", Heft 4, S. 97-120, Jahrg. 1934, Verlag Luken & Luken, Berlin)