| Zurück |
Datenschutz
Da wir die
Plattentektonik-Theorie (diese Theorie wurde in den 60iger
Jahren des 20. Jahrhunderts Nachfolger der
Kontraktionstheorie)
ablehnen, wollen wir den Vorgang der Gebirgsbildung im logischen Sinne
der Welteislehre aufzeigen.
Hierfür lassen wir den ehemaligen Berginspektor Dr. Ing. Fritz Plasche "zu Worte" kommen.
Hinweis!:
Um den folgenden Aufsatz zu verstehen, bedarf es einer vorigen "Grundlagenkenntnis" der Abhandlung "Kosmisch orientierte Erdgeschichte", Schwerpunkt: "Mondeszeit und Erdkatastrophen".
Hierfür lassen wir den ehemaligen Berginspektor Dr. Ing. Fritz Plasche "zu Worte" kommen.
Hinweis!:
Um den folgenden Aufsatz zu verstehen, bedarf es einer vorigen "Grundlagenkenntnis" der Abhandlung "Kosmisch orientierte Erdgeschichte", Schwerpunkt: "Mondeszeit und Erdkatastrophen".
das Privatinstitut für Welteislehre
Gebirgsbautätigkeit (Faltungen, Schichtungen, Erosionsarbeit)
Alle bisherigen Theorien
(über die Gebirgsbautätigkeit), ob
sie nun Anerkennung (von der Geologie) gefunden haben oder nicht
durchgedrungen sind, fußen letzten Endes immer wieder auf der
Allheilstheorie von Kant und Laplace.
Beide hatten ursprünglich verschiedene Theorien aufgestellt, welche jedoch in den hauptsächlichsten Zügen einander ähnelten und daher mit den Namen beider Autoren in Zusammenhang gebracht werden.
In den Grundfragen stimmen beide Autoren überein. Sie gehen ursprünglich von einer Nebelmasse aus und lassen aus dieser sich die Himmelskörper des Sonnensystems bilden. Aus diesem Grunde wird die unter dem Namen Kant-Laplacesche Theorie bekannte Hypothese auch Nebularhypothese oder Gasentwicklungstheorie genannt. Alle Entwicklungsstadien vom Nebelfleck zu der leuchtenden Sonne, zu den erkalteten Planeten, bis zum erstarrten Mond, gehen ursprünglich vom Gasnebel aus. Schon zu der Zeit des ersten Auftauchens dieser Theorie haben sich Zweifel bemerkbar gemacht, und gegenwärtig (Stand: 1925 ,1926!) sind sich Physiker und Mathematiker darüber vollkommen einig, daß die bis in breiteste Schichten wissensdurstiger Menschen eingedrungene Theorie vollkommen unhaltbar ist (Bemerk. WEL-Instituts: Irgendwann hat man diese geradezu revolutionäre und logische Sicht wieder verworfen und "predigt" wieder - bis heute - die alte Nebularhypothese als die Allheilstheorie). Es sind soviel Einwendungen gegen dieselbe vorgebracht worden, daß es einer eigenen Abhandlung bedürfte, sie alle zu besprechen. Wir wollen deshalb auch nur einige wesentliche und wichtige herausgreifen, die allein schon die Unmöglichkeiten derselben dartun:
Beide hatten ursprünglich verschiedene Theorien aufgestellt, welche jedoch in den hauptsächlichsten Zügen einander ähnelten und daher mit den Namen beider Autoren in Zusammenhang gebracht werden.
In den Grundfragen stimmen beide Autoren überein. Sie gehen ursprünglich von einer Nebelmasse aus und lassen aus dieser sich die Himmelskörper des Sonnensystems bilden. Aus diesem Grunde wird die unter dem Namen Kant-Laplacesche Theorie bekannte Hypothese auch Nebularhypothese oder Gasentwicklungstheorie genannt. Alle Entwicklungsstadien vom Nebelfleck zu der leuchtenden Sonne, zu den erkalteten Planeten, bis zum erstarrten Mond, gehen ursprünglich vom Gasnebel aus. Schon zu der Zeit des ersten Auftauchens dieser Theorie haben sich Zweifel bemerkbar gemacht, und gegenwärtig (Stand: 1925 ,1926!) sind sich Physiker und Mathematiker darüber vollkommen einig, daß die bis in breiteste Schichten wissensdurstiger Menschen eingedrungene Theorie vollkommen unhaltbar ist (Bemerk. WEL-Instituts: Irgendwann hat man diese geradezu revolutionäre und logische Sicht wieder verworfen und "predigt" wieder - bis heute - die alte Nebularhypothese als die Allheilstheorie). Es sind soviel Einwendungen gegen dieselbe vorgebracht worden, daß es einer eigenen Abhandlung bedürfte, sie alle zu besprechen. Wir wollen deshalb auch nur einige wesentliche und wichtige herausgreifen, die allein schon die Unmöglichkeiten derselben dartun:
1. Die Entstehung des
Sonnensystems, wie sie von dieser Theorie
angenommen wird, setzt eine gleichsinnige Richtung der Bewegung aller
zum Sonnensystem gehörigen Himmelskörper voraus. Wie
kommt es nun, daß Neptun und Uranus mit ihren Monden sich nicht
in die Regel fügen und daß auch verschiedene Monde anderer
Planeten außergewöhnliche Bahnlagen besitzen?
2. Nach der Nebularhypothese
haben sich die einzelnen
Himmelskörper durch Abschleuderung gebildet. Ist dies jedoch
wirklich der Fall, so müßte
z. B. die Erde, wenn sich der Mond von ihr als Ring ablösen sollte, eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 2 Stunden gehabt haben, was den Erfahrungen an anderen Planeten vollkommen entgegensteht.
z. B. die Erde, wenn sich der Mond von ihr als Ring ablösen sollte, eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 2 Stunden gehabt haben, was den Erfahrungen an anderen Planeten vollkommen entgegensteht.
3. Es wäre mit
Bestimmtheit zu erwarten, daß die
Dichteverhältnisse in der Richtung gegen die Sonne zunehmen, denn
wenn sich ein ursprünglicher Gasball zusammenzieht, muß die
größte Dichte desselben in seinem Mittelpunkte liegen.
Dies ist jedoch auch nicht der Fall. Die größte Dichte
von allen Planeten hat die Erde. Merkur und Venus haben ebenso
geringere Dichten wie die äußeren Planeten, ja selbst, wenn
man die Erde als Ausnahme betrachtet, ist die Abnahme der Dichte gegen
den Rand des Sonnensystems noch immer ungleichmäßig.
4. Jede gedachte Gasmasse hat
eine äußerste
Ausdehnungsgrenze. Wird diese Grenze überschritten, so
müssen sich auch die einzelnen Moleküle im Weltenraum
zerstreuen. Denken wir uns nun die gesamte Masse des
Sonnensystems in Gasform über den ganzen Raum bis über die
Neptunbahn hinaus gleichmäßig ausgebreitet, so wäre
jener Grenzpunkt weit überschritten.
So kann es uns auch keineswegs
verwundern, wenn ein Mathematiker, wie
G. Holzmüller in seinen "Elementaren kosmischen Betrachtungen", zu
dem Ausspruch kommt: "Die
Kant-Laplacesche Hypothese ist als unheilbar krank zu betrachten; Kant
insbesondere war ein mathematischer Dilettant, seine Theorie aber eine
philosopisch-angehauchte Dichtung, ein Naturepos, das nicht in
wissenschaftliche Lehrbücher gehört."
Aus dieser so geschilderten
Theorie heraus erbaut sich nun das
gewaltige Lehrgebäude der "Geologie". Alle Theorien der
Entstehungsgeschichte der Erde haben letzten Endes ihre Stütze in
den Fundamenten der so berühmten und so vernichtend verurteilten
"Nebularhypothese". Kommt man da nicht unwillkürlich auf den
Gedanken, daß ein derartig schlecht fundiertes Gebäude, das
eben auf Sand erbaut wurde, eines neuen und besseren Fundaments
dringend bedarf. .....
.......................
....Und die Geologen wissen
heute noch nicht, wo in die Wahrheit die
Ursache der Gebirgsbildung liegt, ob die Faltengebirge der Erdzonen
besondere "Schwäche"- oder "Kraftfelder darstellen, ob die
Bewegungsursache in der Erdkruste oder in deren plastischer Unterlage
zu suchen ist, ob Senkungen, Hebungen oder tangentiale Bewegungen den
Anfang bei der Gebirgsbildung machen, ob die Schwerkraft, die
Fliehkraft oder die Abkühlung die Kraftquelle sind. Und...
(dies liegt daran), weil man immer nur die Erscheinungen im Bau der
Erde beobachtet und verwertet, immer nur die auf der Erde jetzt
herrschenden Naturkräfte zum Gebirgsbau heranzieht und sich
niemals vergegenwärtigt, daß zu so gewaltiger Arbeit nur
überirdische, das heißt kosmische Kräfte
hinreichen. Die Welteislehre hat diese kosmischen Kräfte
aufgedeckt, sie hat gezeigt, daß sie veranlaßt werden, wenn
ein eingefangener Trabant der Erde bei seiner Annäherung an
dieselbe eine gigantische Anziehung ausübt und besonders dann,
wenn er in der stationären Zeit immer über dem gleichen
Kontinent steht, diese gewaltigen Kräfte auf die gleichen Linien
konzentrieren kann. Auf diese Weise wird die Erdkruste verzerrt,
die Pole platten sich ab, um den Äquator bildet sich ein Ringwulst
und zur stationären Zeit bildet sich aus der Erde ein
"eiförmiger" Himmelskörper. Wir ersehen nun, daß
in derartigen Verzerrungen wirkliche Gebirgsbautätigkeit wohnt,
die der Quietismus (Aktualismus), welcher nur mit den
gegenwärtigen herrschenden Naturkräften operiert niemals zur
Verfügung haben kann. Und wir sehen sofort, daß die
von den Geologen beobachteten abwechselnden Perioden zwischen
Gebirgsbau und verhältnismäßiger Ruhe durch die
Perioden bei einem Mondeinfang und einem mondlosen Zeitalter
erklärt werden können. Die alten Geologen haben die
meisten geologischen Ereignisse durch Katastrophen erklärt und auf
diese kommen die Anhänger der Welteislehre wieder zurück,
sind jedoch in der Lage, die Ursachen dieser Katastrophen zu
erklären. Betrachten wir uns die fast unglaublichen
Faltungen, die mit der Gebirgsbildung einhergehen, so müssen wir
staunen vor den gigantischen Gewalten, welche damit einhergegangen
sind. Zur Illustrierung dieser großartigen Wirkungen diene
die Abbildung 1. ... Würden wir auch den Erdball von der
Rotglut bis in die Eiserstarrung abkühlen lassen, so könnten
sich doch niemals derartige mehrfache Überlappungen
ausbilden. Und diese gewaltigen übereinander gekippten
Decken sollen sich im steten Wechselspiel der Atmosphärilien
ausgebildet haben, auf rein quietistischer (aktualistischer) Weise,
ohne Zuhilfe- nahme äußerer Gewalten?

Abbildung. 1.; (Bildquelle: "Schlüssel zum
Weltgeschehen", Heft 4, S.
224, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Zu welcher Theorie die Geologen
auch immer hinneigen mögen, der
einfachste technische Verstand muß die gegenwärtigen
Theorien verwerfen.
Wie anders stellen sich uns hier die Hubkräfte eines heranschrumpfenden Mondes entgegen. Erschrecken wir schon heute vor den urgewaltigen Kräften der Mondflut (WEL-Institut: und auch Erd-"Flut", s. "Aktualität der Welteislehre", Punkt 11) Mondeinfluss auf die Erde), wie sie unser gegenwärtiger nächtlicher Begleiter hervorzaubert, wie viel gewaltiger müssen derartige Kräfte zur stationären Zeit auf Luft, Wasser und Erdkruste eingewirkt haben, waren sie doch auf das mehr als 700fache der gegenwärtigen Mondes-Hubkräfte angewachsen. Während die jetzt herrschenden Kräfte in ihrem Wechselspiel immer auf andere Flächen wirken und daher zu keinem richtigen Angriffe kommen, wirkten die vielhundertfach verstärkten Kräfte zur stationären Zeit immer auf den gleichen Erdmeridian.
Die zünftige Geologie versucht verschiedene Einwände dagegen vorzubringen. .... Sie sagt, daß die jüngeren Gebirge, wenn sie durch Mondanziehungskräfte gebildet worden wären, einen anderen Verlauf hätten nehmen müssen. Man kann zu diesem Schluß nur deshalb kommen, weil man die Grundregeln der Mechanik absichtlich oder unabsichtlich negiert. Man leugnet zwar nicht, daß eine Anzahl, und zwar die größten Gebirge, sich recht gut in das Schema Hörbigers einfügen, daß es jedoch eine große Anzahl von Gebirgen gibt, die absolut nicht einpassen. Betrachten wir die folgende Skizze mit den wichtigsten Gebirgszügen jüngerer geologischer Zeiten in Merkators Projektion (Abb. 2), so fällt uns vor allem auf, daß die ostasiatischen Gebirgsketten, die nordamerikanischen großen Gebirge, besonders jedoch die Anden, weiters auch die Alpen, Karpathen und Pyrenäen, ganz ausgezeichnet in die erwarteten Bruchlinien einpassen. Ja selbst der Atlas, die Balkangebirge und die kleinasiatischen Höhenzüge passen in das von Hörbiger erwartete Bruchliniensystem recht gut hinein.
Wie anders stellen sich uns hier die Hubkräfte eines heranschrumpfenden Mondes entgegen. Erschrecken wir schon heute vor den urgewaltigen Kräften der Mondflut (WEL-Institut: und auch Erd-"Flut", s. "Aktualität der Welteislehre", Punkt 11) Mondeinfluss auf die Erde), wie sie unser gegenwärtiger nächtlicher Begleiter hervorzaubert, wie viel gewaltiger müssen derartige Kräfte zur stationären Zeit auf Luft, Wasser und Erdkruste eingewirkt haben, waren sie doch auf das mehr als 700fache der gegenwärtigen Mondes-Hubkräfte angewachsen. Während die jetzt herrschenden Kräfte in ihrem Wechselspiel immer auf andere Flächen wirken und daher zu keinem richtigen Angriffe kommen, wirkten die vielhundertfach verstärkten Kräfte zur stationären Zeit immer auf den gleichen Erdmeridian.
Die zünftige Geologie versucht verschiedene Einwände dagegen vorzubringen. .... Sie sagt, daß die jüngeren Gebirge, wenn sie durch Mondanziehungskräfte gebildet worden wären, einen anderen Verlauf hätten nehmen müssen. Man kann zu diesem Schluß nur deshalb kommen, weil man die Grundregeln der Mechanik absichtlich oder unabsichtlich negiert. Man leugnet zwar nicht, daß eine Anzahl, und zwar die größten Gebirge, sich recht gut in das Schema Hörbigers einfügen, daß es jedoch eine große Anzahl von Gebirgen gibt, die absolut nicht einpassen. Betrachten wir die folgende Skizze mit den wichtigsten Gebirgszügen jüngerer geologischer Zeiten in Merkators Projektion (Abb. 2), so fällt uns vor allem auf, daß die ostasiatischen Gebirgsketten, die nordamerikanischen großen Gebirge, besonders jedoch die Anden, weiters auch die Alpen, Karpathen und Pyrenäen, ganz ausgezeichnet in die erwarteten Bruchlinien einpassen. Ja selbst der Atlas, die Balkangebirge und die kleinasiatischen Höhenzüge passen in das von Hörbiger erwartete Bruchliniensystem recht gut hinein.

Abbildung. 2; (Bildquelle: "Schlüssel zum
Weltgeschehen", Heft 4, S.
228, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Es gibt Ausnahmen von dieser
Regel.
Der Antillenbogen, das Kettengebirge Nord-Ost-Australiens fallen aus dem Schema heraus. Dem mechanisch denkenden Ingenieur ist die Sache sofort klar, denn er weiß, daß die Bruchlinien die gefährlichen Querschnitte darstellen, wo nach dem Spiel der einwirkenden Kräfte der Bruch der Erdkruste zu erwarten ist, er weiß jedoch sogleich, daß der Bruch nicht allein von dem Spiel der Kräfte, sondern hauptsächlich von der Widerstandsfähigkeit der Erdkruste abhängen wird. Wäre die Erde aus vollkommenen homogenen, gleich starken, nicht zerrissenen, gleichartig zusammengesetzten Materialien aufgebaut, so müßte eine gleichmäßig einwirkende Kraft die Bruchlinien dort erwarten lassen, wo die Ebbegebiete sind. Nachdem jedoch die Erde, wie jeder Laie zur Genüge weiß, doch nicht aus einer gleichmäßig beschaffenen Erdkruste besteht, keineswegs jedoch homogen, nicht zerrissen und gleichartig stark ist, wird bei dem Spiel der ziehenden (Tertiär)Mondkräfte der Bruch dort zu erwarten sein, wo praktisch der "gefährliche Querschnitt" in der Natur vorhanden ist, also dort, wo weniger widerstandsfähiges Material in der Erdkruste ansteht; dort, wo bereits alte Spalten, geringe Stärke und geringe Kohäsion herrscht, wird der Bruch eintreten müssen, werden sich Eruptionen des Magmas an die Oberfläche ergießen. Dort ist auch der Angriffspunkt für die Kräfte, welche die Erdkruste falten. Wir nehmen das einfachste Beispiel aus der Festigkeitslehre, welches uns dieses Kräftespiel zur Genüge zeigt.
Der Antillenbogen, das Kettengebirge Nord-Ost-Australiens fallen aus dem Schema heraus. Dem mechanisch denkenden Ingenieur ist die Sache sofort klar, denn er weiß, daß die Bruchlinien die gefährlichen Querschnitte darstellen, wo nach dem Spiel der einwirkenden Kräfte der Bruch der Erdkruste zu erwarten ist, er weiß jedoch sogleich, daß der Bruch nicht allein von dem Spiel der Kräfte, sondern hauptsächlich von der Widerstandsfähigkeit der Erdkruste abhängen wird. Wäre die Erde aus vollkommenen homogenen, gleich starken, nicht zerrissenen, gleichartig zusammengesetzten Materialien aufgebaut, so müßte eine gleichmäßig einwirkende Kraft die Bruchlinien dort erwarten lassen, wo die Ebbegebiete sind. Nachdem jedoch die Erde, wie jeder Laie zur Genüge weiß, doch nicht aus einer gleichmäßig beschaffenen Erdkruste besteht, keineswegs jedoch homogen, nicht zerrissen und gleichartig stark ist, wird bei dem Spiel der ziehenden (Tertiär)Mondkräfte der Bruch dort zu erwarten sein, wo praktisch der "gefährliche Querschnitt" in der Natur vorhanden ist, also dort, wo weniger widerstandsfähiges Material in der Erdkruste ansteht; dort, wo bereits alte Spalten, geringe Stärke und geringe Kohäsion herrscht, wird der Bruch eintreten müssen, werden sich Eruptionen des Magmas an die Oberfläche ergießen. Dort ist auch der Angriffspunkt für die Kräfte, welche die Erdkruste falten. Wir nehmen das einfachste Beispiel aus der Festigkeitslehre, welches uns dieses Kräftespiel zur Genüge zeigt.
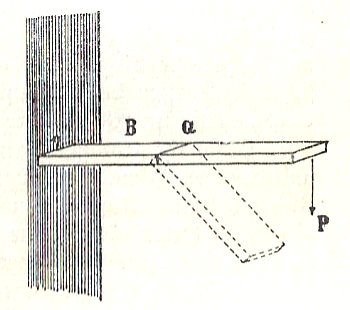
Abbildung. 3.; (Bildquelle: "Schlüssel zum
Weltgeschehen", Heft 4, S.
229, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Auf einen Balken B wirkt eine
Kraft P (Abb. 3), welche langsam steigend
immer größer werden soll. Der Balken ist in einer
Mauer fest eingebettet. Nimmt die Größe der Kraft P
derartig zu, daß der Balken nicht mehr standhalten kann, so tritt
der Bruch beim theoretisch zu erwartenden gefährlichen Querschnitt
qu ein. Besitzt jedoch der Balken an einer beliebigen anderen
Stelle, z. B. bei qu einen qu einen Anbruch, irgendeinen Riß oder
eine schwächere Stelle, so wird der Bruch keineswegs bei qu
eintreten, sondern bei Q und wird sich der Richtung des Risses
vollkommen anschmiegen. Dieses Verhältnis können wir
direkt auf die Gebirgsbildung anwenden. Die Zugkräfte des
(Tertiär)Mondes werden Gebirge nur dann längs der Ebbegebiete
der Flutberge auftürmen, wenn nicht anderweitige gefährliche
Bruchlinien, geringere Stärke der Erdkruste oder geringere
Widerstandskraft derselben vorhanden sind. Wir ersehen jetzt
sogleich, daß dies in Anbetracht der Beschaffenheit der Erdkruste
häufig vorkommen kann, und wenn trotzdem die größte
Anzahl der Gebirge unserer Erde diesem Anschmiegungssystem an die
Flutberge Folge leistet, um so wahrscheinlicher muß auch die
Richtigkeit der Aufstellung der Gebirgsbautheorie im Sinne der
Welteislehre einleuchten. Vom Standpunkt der Mechanik, der
Festigkeitslehre, wollen wir nun im folgenden auch die übrigen
Anomalien besprechen, welche man gegen die Welteislehre zu Felde
führt.....
Wir wollen hier unter den
mannigfachen Einwänden, ...., auch jener
gedenken, welche in Afrika wegen der Meeresüberflutungen tertiäre Sedimentierung verlangen und
Erosionsarbeit an den schon vorhanden gewesenen
Schichtenkomplexen fordern. Auch hier liegt ein tiefer Irrtum
zugrunde. Ein ruhiges Meer in alluvial-ruhiger Zeit leistet genau
so wie die heutigen Meere geologische Kleinarbeit, indem in seinen
Tiefen alle Arten von Schlamm abgesetzt werden. Es ist richtig,
daß Sand, Schlamm und ausgelöste Salze aus den Gesteinen
unaufhörlich zum Meere wandern. Dort bauen sich
infolgedessen Schlammschichten auf, welche
jedoch in sich nicht gefestigt sind.
Gegenwärtig unterscheiden wir bei den Meeresbildungen folgende Typen:
Gegenwärtig unterscheiden wir bei den Meeresbildungen folgende Typen:
1) Landnahe Ablagerungen:
Strandbildung. Diese stammen
größtenteils vom Ufersaum und bestehen, je nach
Beschaffenheit des Ufers aus Blöcken verschiedener Gesteine, aus
Kies und Sand, Muscheltrümmern und Tangmassen.
Außerhalb dieser unmittelbaren Strandbildungen treten die
Schlicke auf. Diese bestehen aus den feinen Tonteilchen und
enthalten meistens einen gewissen Prozentsatz von Diatomeenschalen.
2) Landferne Ablagerungen:
Daher gehören verschiedenartige
Niederschläge der Tiefsee, des Mittelmeeres, der Steilabfälle
und der Rücken und Sättel der Tiefsee. Es gehören
ferner teilweise hierher, die verschiedenartig gefärbten Schlicke,
welche einen Übergang zwischen den landnahen und landfernen
Sedimenten darstellen. Die größte Verbreitung der
landfernen, die Tiefseeablagerungen besitzt der rote Tiefseeton. Auf sehr
große Tiefen beschränkt sich auch der sogenannte "Radiolarienschlamm", der
außer dem roten Schlamm noch kieselige Reste von Urtieren
enthält. Eine große Verbreitung besitzt ferner noch
der Globigerinenschlamm. Bei der so gewaltigen Verbreitung des
roten Tones in unseren Meeren müßten wir daraus den
Schluß ableiten können, daß wir derartige Tiefsee-Tone
auch in allen früheren Formationen antreffen, denn der Geologe
hält doch die Meere als die wirklichen und die einzigen
Geburtsstätten der Sedimentschichten. Dies ist nun
keineswegs der Fall.
Ältere geologische
Formationen zeigen nur sehr selten
Sedimentgesteine vom Typus des "roten Tones". Wohl ähneln
dem Globigerinenschlamm die Ablagerungen der Schreibkreide, doch fehlen
uns immer jene Vorgänge, welche zur Verfestigung der Gesteine
dienen. Die Zeit allein ist niemals in der Lage, aus dem weichen
Ton einen festen Schiefer zu machen, ebensowenig ist auch der Druck
später überlagerter Massen imstande, diese Erhärtung zu
bewirken. Das beste Beispiel derartiger Vorgänge tritt uns
in den geologisch uralten baltischen kambrischen Tonen entgegen.
Seit der Ablagerung dieser Tone ist eine ungeheure Fülle von Zeit
verstrichen. Diese Ablagerungen sind auch den größten
Drücken ausgesetzt gewesen, und trotzdem treten sie uns heute noch
ebenso plastisch entgegen, wie in den Zeiten ihrer Entstehung. Zur Erhärtung der Gesteine
gehören eben andere Faktoren als Druck und Zeit, es gehört
dazu die Umlagerung und zementartige Verkittung während eines
Kataklysmus (erdgeschichtliche Katastrophe). Fast
nichts von den in den Weltmeeren sedimentierten vielartigen
Schlammassen bleibt während eines Kataklysmus liegen. Nur
ganz besonders geschützte Schichten, vorwiegend in nördlichen
Breiten, die vom schützenden Eis baldigst bedeckt werden,
können unter Umständen für künftige geologische
Epochen erhalten bleiben. Sonst wird alles, samt den feineren
alluvialen und diluvialen Ablagerungen abermals aufgewühlt und mit
den übrigen organischen gerodeten Schwimmstoffen durch die
Flutwellen verschwemmt und erst jetzt
in haltbarer Weise neu sedimentiert. Dabei wird aber
besonders der auch gelöste und im Wasser suspendierte Kalkgehalt
des Meeres zum Großteil auch den neuen Sedimenten als
zementartiges Bindemittel zugute kommen und im Verein mit dem
später auftretenden Hochdruck die Festigkeit des Sandsteins,
Tonsandsteins und Schiefertones erhöhen. Derartige
Bindefestigkeit fehlt sämtlichen alluvialen Bildungen vollkommen,
wobei selbstverständlich auch noch der Druck wegfällt, um
beispielsweise zu einer gesteinsähnlichen Verfestigung der
heutigen Alluvien in einem Stromdelta zu kommen. So kommt
Hörbiger zu dem Schluß: "Keine der
heute beobachtbaren, kontinentalen, quietistischen (aktuellen)
Sedimentierungsvorgänge gibt jemals festes Gestein."
Kehren wir nun unter diesen
Voraussetzungen .... zurück, so
müssen wir uns sofort sagen, daß der Kontinent Afrika, auch
dann, wenn er wirklich durch lange Zeiträume vom Meere bedeckt
war, diese Sedimentierungen heute nicht mehr aufweisen kann. In
den Zeiten, als die Sedimentierung hätte erfolgen sollen, war das
Meer so bis auf den Grund aufgewühlt, da die Flutberge
tagtäglich nach Norden und Süden pendelten und jede
Sedimentierung, wenn sie wirklich schon erfolgt gewesen wäre,
sofort wieder vernichtet hätten, so daß während dieser
Zeitläufe mit einer richtigen Sedimentierung nicht gerechnet
werden kann. Daß dem wirklich so ist und das Meer bei
kilometerhohen Flutwellen bis auf den Grund aufgewühlt werden
muß, zeigen die Untersuchungen Philippis, welcher bei den
gegenwärtigen Sturmfluten einen Tiefgang bis zu 200 Meter Tiefe
nachgewiesen hat. Als der Flutberg während der
Hauptgebirgsbautätigkeit über Afrika stand, war keine Zeit
für Sedimentierungsvorgänge, wie man aus den
gegenwärtigen alluvialen Vorgängen ableitet, damals war nur
Erosionsarbeit denkbar, und zwar solche allergrößten
Stils. Nun will man diese Erosionsarbeit in Afrika dadurch
widerlegen, daß heute daselbst noch paläozoische,
mesozoische und känozoische Schichten in weiten Gebieten erhalten
geblieben sind. Man meint, diese Schichten hätten einfach
glatt hinweggespült werden müssen. Gewiß wird der
Flutberg bei seinem Kommen und seinem Abgang gewaltige Erosionsarbeit
geleistet haben, welche wir ja selbst heutigentags in der Landschaft
des Kaps der Guten Hoffnung noch deutlich erkennen, er wird große
Komplexe der früheren Sedimente alter geologischer
Bautätigkeit vernichtet haben, es liegt aber durchaus kein Grund
vor, anzunehmen, daß er alle aus früherer Zeit bereits
gefestigten Schichten zur Gänze vernichtet hat. Wenn wir
schon erkannt haben, daß unter Umständen sogar nicht durch
Umlagerung entstandenes Tonmaterial erhalten bleiben kann, um so
wahrscheinlicher muß auch zementverkittetes, eiseingebettetes
Sedimentgestein erhalten bleiben können. Wenn auch
vielleicht nur Fragmente vorhanden sind, woran läßt sich
denn feststellen, ob diese einem hundertmal oder nur zehnmal
mächtigeren Schichtenkomplexe angehört haben? Das
läßt sich schwer oder überhaupt nicht
feststellen. Daß aber gewaltige Erosionskräfte im
Spiele waren, das sehen wir ja noch heute an der Landschaft, an den
Großformen derselben, welche uns besonders in der Umgebung des
Tafelberges die gigantische Wühlarbeit der Fluten erkennen
lassen. Auch in den Kordilleren beobachten wir an zahlreichen
Stellen gewaltigste Erosionsarbeit.
Bei Gebirgsbautätigkeit um
den Äquator, die Auftürmung
der gewaltigen Bergmassive eines Chimborasso, Cotopaxi usw. führt
man gegen die Welteislehre zu Felde, indem man annimmt, daß diese
jung entstandenen Gebirgsmassive von der Gürtelflut glatt
weggeschleift werden müßten. Man begeht hier den
Denkfehler, denn man vergißt die großen Zeiträume, die
seit der stationären Hochflut (WEL-Institut:
Tertiärmond
scheinbar über Afrika verankert) verstrichen sind, bis die
Gürtelhochflut ihr Spiel begann. Zur Erstarrung eines
Gebirgsmassivs, welches durch Eruptionen aus der Tiefe aufgetaucht ist,
bedarf es keiner geologisch
langen Zeiträume, obwohl hier in diesem Falle zur
Verfügung stehen würde. Die Erstarrung geht
verhältnismäßig rasch vor sich, und die
Kräfte, mit welchen spätere Fluten an dem jung entstandenen
Gebirge nagen, können dieses wohl in seinen Formen verändern,
können Täler, Sättel, Klammen großen Charakters
schaffen, sie sind jedoch nicht imstande, ein so gewaltiges
Gebirgsmassiv bis auf den Grund zu vernichten. Die
Gürtelhochflut im späteren Stadium hat nicht jene große
Erosionsarbeit geleistet, wie die Flutberge besonders vor und nach der
stationären Zeit, denn während der zweiten
Gürtelhochflut hatten sich die Wendekreise des
(Tertiär)Mondes infolge der Aufstellung der Erdachse bereits eng
zusammengezogen, und die Ausschläge der Flutberge waren nicht mehr
so bedeutend wie um die Wende der stationären Zeit. Dies ist
auch der Grund, warum die Welteislehre die Haupterosionsarbeit in die
Zeit vor und nach der stationären Zeit verlegt. Deshalb
begeht man einen Fehler, wenn man glaubt, dem späten
Gürtelhochflut-Zeitalter die gleiche Erosionsarbeit wie
früheren Stadien zuschreiben zu können.
Wir wollen nun den Vorgang bei
der Gebirgsbildung nach den Ansichten
der Welteislehre einmal etwas näher, jedoch immer nur in den
gröbsten Umrissen, betrachten. Wir haben dabei vor allem
zwischen den beiden Hauptsystemen der Gebirge, zwischen den durch
vulkanische Kräfte hervorgebrachten und den durch Sedimentierung
entstandenen Gebirgen zu unterscheiden. Die Bildung der beiden
Gebirgsgruppen fällt in die gleiche Bildungszeit, und zwar
hauptsächlich in die stationäre Periode. Denken wir uns
den Vorgang bei der Gebirgsbildung etwas vereinfacht, und zwar
folgendermaßen:
Die Erde wäre durch irgendwelche Kräfte elliptisch geformt und mit einer gleichmäßigen, beispielsweise 2 Kilometer starken Sedimentschicht bedeckt, die Sedimente seien infolge der Eiszeitkälte niedergefroren und in einen Eisschichtenkomplex eingebettet, wodurch ihnen jedoch die gletscherartige Plastizität nicht genommen werden kann. Nachdem außer der Erdoberflächenschwere und der Fliehkraft keine wesentlichen Kräfte auf die neugebildeten Schichten wirken, setzen wir dieselben jetzt den Einwirkungen eines Mondes in stationärer Zeit aus. So wirken nun die uns in ihrer gewaltigen Größe schon bewußt gewordenen Hubkräfte (des Tertiärmondes) auf die neuen Schichten ein. Zuerst werden sich die Flutberge der Luft und des Wassers ausbilden, und letztere werden entsprechend dem Neigungswinkel der Mondbahnebene ihre Breitenoszillationen vollführen. Die Erdkruste, Lithosphäre, wird infolge Wirkungsweise dieser Kräfte zu einem ovalen Geoid verzerrt, und diese gesamten Vorgänge wirken auf die neu gebildet gedachten Schichten entsprechend ein. (s. Abb. 4)
Die Erde wäre durch irgendwelche Kräfte elliptisch geformt und mit einer gleichmäßigen, beispielsweise 2 Kilometer starken Sedimentschicht bedeckt, die Sedimente seien infolge der Eiszeitkälte niedergefroren und in einen Eisschichtenkomplex eingebettet, wodurch ihnen jedoch die gletscherartige Plastizität nicht genommen werden kann. Nachdem außer der Erdoberflächenschwere und der Fliehkraft keine wesentlichen Kräfte auf die neugebildeten Schichten wirken, setzen wir dieselben jetzt den Einwirkungen eines Mondes in stationärer Zeit aus. So wirken nun die uns in ihrer gewaltigen Größe schon bewußt gewordenen Hubkräfte (des Tertiärmondes) auf die neuen Schichten ein. Zuerst werden sich die Flutberge der Luft und des Wassers ausbilden, und letztere werden entsprechend dem Neigungswinkel der Mondbahnebene ihre Breitenoszillationen vollführen. Die Erdkruste, Lithosphäre, wird infolge Wirkungsweise dieser Kräfte zu einem ovalen Geoid verzerrt, und diese gesamten Vorgänge wirken auf die neu gebildet gedachten Schichten entsprechend ein. (s. Abb. 4)

Abbildung. 4.; (Bildquelle: "Schlüssel zum
Weltgeschehen", Heft 4, S.
233, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Diese beginnen sich vom
Ebbegürtel loszureißen und geraten
auf der gletscherartigen Unterlage, welche als schlüpfrige
Rutschbahn dient, in ein Gleiten....
Gerade in den Zonen der Ebbegebiete wirkten die Mondeshubkräfte in fast tangentialer Richtung der Fluten. In diesen Zonen werden also hauptsächlich die Flutkräfte ihre stärksten Angriffe auf die neugebildeten Schichtenkomplexe ausüben können. Die für das Gleiten unbedingt notwendige glatte Gleitfläche entsteht dadurch, daß der gefrorene große Schichtenkomplex durch den Druck auf seine Unterlage die untersten Schichten in Lösung bringt und so Gleitflächen schafft, auf denen dann die Trennung der Schichtenkomplexe von ihrer Unterlage vonstatten geht. Die frisch gefrorenen Schichtenmassen haben die Tendenz, in der Richtung gegen die Flutberge zu rutschen, also gegen den Äquator zu. Sie kommen schließlich durch Massenanstauungen und durch Wasserwiderstandswirkungen zum Halten. Die nachdrängenden Schichtmassen stauen sich an den schon vorhandenen und aufgehaltenen Schichten, beginnen sich an diesen emporzufalten, zu überschieben und zu überkippen, sie sind selbst in der Lage, sich auch nach rückwärts zu überkippen. Dieser Gleitvorgang würde wegen der bald eintretenden Stauungen in kurzer Zeit sein Ende erreichen, doch dürfen wir nicht vergessen, daß sich dieser Faltungsvorgang, wie wir aus der Abbildung 4 ersehen, am Grunde der Flutberge vollzieht, die tagtäglich nach Nord und Süd pendeln. Die bis auf den Grund des Meeres aufwühlenden Wassermassen waschen die oberen Falten sofort wieder ab, nehmen dieses schon früher sedimentiert gewesene Material zur nochmaligen Schichtung wieder mit in die Ebbegebiete, wo es neuerdings eingefriert und an dem Sedimentschichtaufbau nochmals teilnehmen kann. In den uns bekannten sichelförmigen Ebbegebieten werden diese Schichtenfaltungen immer neu gebildet und zum Gleiten veranlaßt. Es kann auch der Fall eintreten, daß die Gleitung und Stauchung schon nach kurzer Bewegung zum Halten kommt, wenn sich ihr ein unüberwindlicher Widerstand entgegensetzt.
Wir haben zur Besprechung dieses ganzen Vorgangs ideale Verhältnisse angenommen, und zwar eine plötzliche Einsetzung des stationären Mondes auf eine gleichmäßig mit Sedimenten beschickt gedachte Erdoberfläche. In Wirklichkeit ist dies natürlich nicht der Fall. Die Erde hat vor Beginn der Hauptgebirgsbautätigkeit zur stationären Zeit keine gleichmäßig geoidale Form. Aus den früheren Gebirgsbautätigkeiten stehen die alten Horste, so der Afrikahorst, die festfundierten alten archäischen Gebirge und andere. Die Oberfläche der Erde zeigt die gleichen Abweichungen, wie sie uns auch jetzt bekannt sind. Die Sedimentierungsvorgänge der vor-, um- und nachstationären Zeit beschränken sich im besonderen auf die eisüberdeckten, eben gedachten sichelförmigen Ebbegebiete. Gleichzeitig mit den Schichtenbildungen treten aber durch Aufreißen der alten Spalten infolge der Hubkräfte gewaltige Eruptionen ein, welche zur Gebirgsbildung mit Verwendung finden oder, sogleich erstarrt, den Gleitvorgängen Hindernisse in den Weg legen. Nachdem jedoch die Gleit- und Faltungsvorgänge sich hauptsächlich auf die sichelförmigen Ebbegebiete und deren weitere Umgebung beschränken, hier aber auch gleichzeitig die Eruptionen erfolgen, lakkolithe Aufwölbungen alter Schichten veranlassen können, ist es selbstverständlich, daß in die Faltungen auch alte Schichten mit einbezogen werden können.
Gerade in den Zonen der Ebbegebiete wirkten die Mondeshubkräfte in fast tangentialer Richtung der Fluten. In diesen Zonen werden also hauptsächlich die Flutkräfte ihre stärksten Angriffe auf die neugebildeten Schichtenkomplexe ausüben können. Die für das Gleiten unbedingt notwendige glatte Gleitfläche entsteht dadurch, daß der gefrorene große Schichtenkomplex durch den Druck auf seine Unterlage die untersten Schichten in Lösung bringt und so Gleitflächen schafft, auf denen dann die Trennung der Schichtenkomplexe von ihrer Unterlage vonstatten geht. Die frisch gefrorenen Schichtenmassen haben die Tendenz, in der Richtung gegen die Flutberge zu rutschen, also gegen den Äquator zu. Sie kommen schließlich durch Massenanstauungen und durch Wasserwiderstandswirkungen zum Halten. Die nachdrängenden Schichtmassen stauen sich an den schon vorhandenen und aufgehaltenen Schichten, beginnen sich an diesen emporzufalten, zu überschieben und zu überkippen, sie sind selbst in der Lage, sich auch nach rückwärts zu überkippen. Dieser Gleitvorgang würde wegen der bald eintretenden Stauungen in kurzer Zeit sein Ende erreichen, doch dürfen wir nicht vergessen, daß sich dieser Faltungsvorgang, wie wir aus der Abbildung 4 ersehen, am Grunde der Flutberge vollzieht, die tagtäglich nach Nord und Süd pendeln. Die bis auf den Grund des Meeres aufwühlenden Wassermassen waschen die oberen Falten sofort wieder ab, nehmen dieses schon früher sedimentiert gewesene Material zur nochmaligen Schichtung wieder mit in die Ebbegebiete, wo es neuerdings eingefriert und an dem Sedimentschichtaufbau nochmals teilnehmen kann. In den uns bekannten sichelförmigen Ebbegebieten werden diese Schichtenfaltungen immer neu gebildet und zum Gleiten veranlaßt. Es kann auch der Fall eintreten, daß die Gleitung und Stauchung schon nach kurzer Bewegung zum Halten kommt, wenn sich ihr ein unüberwindlicher Widerstand entgegensetzt.
Wir haben zur Besprechung dieses ganzen Vorgangs ideale Verhältnisse angenommen, und zwar eine plötzliche Einsetzung des stationären Mondes auf eine gleichmäßig mit Sedimenten beschickt gedachte Erdoberfläche. In Wirklichkeit ist dies natürlich nicht der Fall. Die Erde hat vor Beginn der Hauptgebirgsbautätigkeit zur stationären Zeit keine gleichmäßig geoidale Form. Aus den früheren Gebirgsbautätigkeiten stehen die alten Horste, so der Afrikahorst, die festfundierten alten archäischen Gebirge und andere. Die Oberfläche der Erde zeigt die gleichen Abweichungen, wie sie uns auch jetzt bekannt sind. Die Sedimentierungsvorgänge der vor-, um- und nachstationären Zeit beschränken sich im besonderen auf die eisüberdeckten, eben gedachten sichelförmigen Ebbegebiete. Gleichzeitig mit den Schichtenbildungen treten aber durch Aufreißen der alten Spalten infolge der Hubkräfte gewaltige Eruptionen ein, welche zur Gebirgsbildung mit Verwendung finden oder, sogleich erstarrt, den Gleitvorgängen Hindernisse in den Weg legen. Nachdem jedoch die Gleit- und Faltungsvorgänge sich hauptsächlich auf die sichelförmigen Ebbegebiete und deren weitere Umgebung beschränken, hier aber auch gleichzeitig die Eruptionen erfolgen, lakkolithe Aufwölbungen alter Schichten veranlassen können, ist es selbstverständlich, daß in die Faltungen auch alte Schichten mit einbezogen werden können.
Nun meinen manche Geologen,
daß der innere Aufbau der
Kettengebirge gegen die Ansichten der Welteislehre sprechen. Sie
sagen: "Die meisten Kettengebirge
sind einseitig gebaut, das heißt, die Mehrzahl ihrer Falten ist
nach einer bestimmten Seite umgekippt und nach dieser Seite hin auf das
Vorland aufgeschoben worden. Nach Hörbiger müßte
man annehmen, daß diese Überkippungen und
Überschiebungen stets auf den Mittelpunkt des Flutberges
hingerichtet seien. Dies stimmt aber nur für eine geringe
Zahl von Ketten (Atlas, armenische und mesopotamische Ketten).
Bei weitem die Mehrzahl der Ketten ist aber sowohl in Europa als auch
in Amerika gerade in entgegengesetzter Richtung gefaltet." -
Wer sich mit den Kräften, immer wieder den Hubkräften der stationären Zeit genügend vertraut gemacht hat, weiß auch, daß die Falten sich in der Richtung gegen die Flutberge bewegen, er kann aber nicht sagen, daß sie nur dorthin umkippen dürfen. Die Umkippungen finden statt, wenn den heranrutschenden Falten ein Hindernis entgegengestellt wird. Sie können durch Nachdrängen folgender Schichten sich an dem Hindernis emporfalten, sich aber ebenso zurück- als vorwärtsneigen. Es spielen hier so mannigfaltige Kräfte mit, so viel Widerstände, innere und äußere Kräfte, daß die Falten ebenso senkrecht gegen die Flutbergradien zu liegen kommen können.
Wer sich mit den Kräften, immer wieder den Hubkräften der stationären Zeit genügend vertraut gemacht hat, weiß auch, daß die Falten sich in der Richtung gegen die Flutberge bewegen, er kann aber nicht sagen, daß sie nur dorthin umkippen dürfen. Die Umkippungen finden statt, wenn den heranrutschenden Falten ein Hindernis entgegengestellt wird. Sie können durch Nachdrängen folgender Schichten sich an dem Hindernis emporfalten, sich aber ebenso zurück- als vorwärtsneigen. Es spielen hier so mannigfaltige Kräfte mit, so viel Widerstände, innere und äußere Kräfte, daß die Falten ebenso senkrecht gegen die Flutbergradien zu liegen kommen können.
Wir müssen uns nun noch
das eine vor Augen halten, daß
dieser Faltungsvorgang aus zwei Stadien zusammengesetzt ist, welche
durch zwei Kräftesysteme veranlaßt werden, und zwar dem
Einsatz der (Tertiär)Mondeshubkräfte und dem Aufhören
derselben. In dem oben angeführten Beispiel haben wir
angenommen, daß der (Tertiär)Mond plötzlich in seinem
stationären Stadium auf eine ideal gedachte Sedimentierung
einwirkt. Nehmen wir nun an, daß der (Tertiär)Mond
ebenso plötzlich, wie sein Kommen angenommen wurde, auch
verschwindet. Die Schichtenkomplexe, welche sich in ein den
Kraftwirkungen entsprechendes Gleichgewicht gestellt haben, geraten
durch das Verschwinden des Mondes außer Gleichgewicht, und diese
Störung, durch welche ein Zurücksetzen des eiförmigen
Erdballs eintritt, bringt eine zweite Phase der
Gebirgsbautätigkeit mit sich, welche für gewisse Arten von
Bildungen ebenfalls von Bedeutung sein werden. Wenn wir uns diese
vielfachen widerstreitenden Kräfte, die bei der
Gebirgsbautätigkeit mitspielen, vergegenwärtigen, so
müssen wir uns sagen, daß unter diesen Voraussetzungen auch
die auffallende Kompliziertheit in manchem Gebirgsbau, so in jenem der
Alpen, begründet ist. Zug- und Druckkräfte,
hervorgegangen aus den Mondeshubkräften, bei deren langsamem
Beginnen, ihren Hauptwirkungen zur stationären Zeit, ihrem
langsamen Aufhören, die Rücksetzungen, die Gleitfaltungen,
welchen durch alte Gebirgssysteme und sonstige Widerstände
verschiedene Lagen und Richtungen diktiert werden, die gleichzeitig
einhergehenden Sedimentierungsvorgänge, die zur selben Zeit auch
erfolgenden grandiosen Abtragungen der neu entstandenen Gebilde, die in
eben der gleichen Zeit sich abspielenden vulkanischen Vorgänge,
sie alle wirken gemeinsam und verschleiern so das Bild, das uns heute
in dem Relief der neuen Gebirge nur verwischt entgegentritt. Wer
sich den inneren Bau der Gebirge näher betrachtet und z. B. die
Faltungsdecken, die uns Abbildung 1 schematisch gezeigt werden, einem
eingehenden Studium unterzieht, der weiß recht bald, daß
hier niemals einfach wirkende Kräfte, wie sie von der
Kontraktionstheorie (heute: Plattentektonik-Theorie) gefordert werden,
derartig knetende Eigenschaften aufweisen können. Solche
Arbeiten zu leisten, benötigen wir außerirdische, kosmische
Kräfte.

Abbildung. 1.; (Bildquelle: "Schlüssel zum
Weltgeschehen", Heft 4, S.
224, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Schon seit jeher ist es allen
Geologen aufgefallen, daß die
Gebirgsbautätigkeit auf gewisse Zeiten beschränkt geblieben
ist und lange Zeiträume ruhiger Tätigkeit mit kurzen Zeiten
gewaltigen Gebirgsbaues abgewechselt haben. Ebenso ist es auch
aufgefallen, daß gewisse große Schollen vom geologischen
Geschehen fast vollkommen ausgeschlossen bleiben, während gewisse
Gebiete dem ständigen Wechsel des Aufbaues und der Abtragung ganz
besonders ausgesetzt geblieben sind. Für diese beiden
Tatsachen hatten die herrschenden und geltenden Theorien keinen
zwingenden Beweis zur Hand. Wie leicht fällt es jedoch der
Welteislehre, gerade für diese Tatsachen den richtigen Beweis zu
erbringen. ....
Nun sprechen alle Anzeichen dafür, daß dem Kontinent Afrika in der Geschichte des Aufbaues der Erde eine ganz besondere Rolle zugeteilt gewesen war (Afrika war wegen seiner Beschaffenheit der Ankerplatz des Zenitflutberges).
Nun sprechen alle Anzeichen dafür, daß dem Kontinent Afrika in der Geschichte des Aufbaues der Erde eine ganz besondere Rolle zugeteilt gewesen war (Afrika war wegen seiner Beschaffenheit der Ankerplatz des Zenitflutberges).

Abbildung. 2; (Bildquelle: "Schlüssel zum
Weltgeschehen", Heft 4, S.
228, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
So beobachten wir eine
auffallende Umkränzung des Zenitflutberges,
und zwar konzentrisch zu dem afrikanischen Kontinent. Diese durch
Gebirgsbautätigkeit erfolgte Umkränzung ist als eine
Fortsetzung der Karpathen, Alpen, Pyrenäen, Atlas- und
Apennin-Faltengebirge anzusehen, und ist quer in nord- und
südatlantischen Tiefen und in den Indischen Ozean
hineingebaut. Die einstmalige Atlantis, das besonders von
Bölsche erwähnte und benutzte Gondwanaland, finden auf diese
Weise ihre Entstehungsursache geklärt. Auch die Insel
Madagaskar mit ihren aufragenden Gebirgen und eine Anzahl
untermeerischer Gebirge findet auf diese Weise ihre zwanglose
Erklärung. Der Ausspruch der Geologen, daß der
Kontinent Afrika niemals vom Meer bedeckt gewesen sein soll, stimmt
gegenwärtig nicht mehr, denn der Zenitflutberg stand ebenso wie
die Gürtelflut über Afrika. Davon können wir
jedoch heute nichts mehr bemerken, denn durch die Überdeckung des
Kontinentes Afrika zur Hauptgebirgsbautätigkeit mit einem stark
bewegten Meere war es vollkommen ausgeschlossen, daß sich hier
Sedimente und Meerestiere absetzen konnten. (Anmerk. des WEL-Instituts: nach der
langen Stationärzeit - Hauptgebirgsbautätigkeit - über
Afrika, reißt sich der Tertiärmond scheinbar los, um dann
zunehmend die Erde von Westen nach Osten schneller zu umlaufen.
Die beiden breitenpendelnden Flutberge schleichen im Schneckentempo
vorwärts. Doch der Tertiärmond "verankert" sich immer
wieder über bestimmte Erdgebiete für eine gewisse
Zeitperiode. In diesen Zeitperioden verfrachten die Flutberge
auch Sedimente, Pflanzen und Tiere bzw. Kadaver in die Ebbegebiete von
Afrika. Da hier auch die Eiszeit herrscht, kommt es zur
Einbettung bzw. Konservierung, wie auch zu Gebirgsbautätigkeiten.)
Wir können jedoch aus dem Fehlen von Meerestieren niemals den Schluß ableiten, daß dieses Land nicht vom Meer bedeckt war. Meerestierleichen werden am Grunde des Meeres niemals für die Zukunft dauernd und konserviert eingebettet. Am allerwenigsten aber am Grunde der Tiefsee. Es ist doch eine allgemein bekannte Tatsache, daß sich auch gegenwärtig in den tiefen und auch in den seichten Meeresschichten keine derartigen Tierleichen erhalten können. Sie sind auch dort ebenso der vollkommenen Verwesung anheimgegeben, wie an der Oberfläche, es können sich nur nichtorganische Teilchen, Gehäuse von Schnecken und dergleichen, welche kalk- oder kieselige Beschaffenheit haben, für die Zukunft erhalten. Alles andere verwest. Gut erhaltene Einbettungen von Meerestieren, welche auch für die Zukunft dauernd erhalten bleiben können, dürfen wir nur in den Ebbegebieten erwarten, wo die strenge Eiszeit ihre Eiseinbettung veranlaßt, durch deren luftdichten Abschluß uns die Abdrücke und in Ausnahmefällen auch selbst Weichteile erhalten bleiben können. Der afrikanische Kontinent war während der Flutbergherrschaft zwar vom Meer mächtig bedeckt, war jedoch in eigentlichem Sinne des Wortes niemals Ebbegebiet. Er war während des Anschleichens und des Abschleichens des Flutberges immer nur das Rodungsgebiet, aus welchem die Sedimentlager, besonders jedoch die Kohlenlager ihre Baustoffe heranschwemmten. Es ist richtig, daß die Abrasionstätigkeit dieses Kontinentes ganz besonders in die Augen springend sein sollte, und dies ist auch wirklich der Fall. Die eigenartige Beschaffenheit der Landschaft in der Sahara, die durch Terrassen ganz besonders auffällt, weisen derartige Erosionsarbeit auf, welche wir niemals durch die hier doch so geringe Erosionstätigkeit des Wassers erklären könnten. Die Terrassenmassive selbst können ja nur im Wasser abgesetzt worden sein. Wahrscheinlich stammen diese Massive aus der ältesten geologischen Zeit, denn sie weisen noch keinerlei Petrefakten auf. Sie dürften also aus einer Zeit stammen, wo auf der Erde noch kein wesentliches organisches Leben herrschte. Obwohl man in geologischen Kreisen die Meinung hört, daß diese Terrassenlandschaft der Kreideformation angehört, muß man in Anbetracht des Fehlens jeder Versteinerung diese Meinung verwerfen. Der geologische Bau der inneren Sahara ist äußerst einfach. Sie besteht vorwiegend aus einer Terrassenlandschaft mit Hochgebirgscharakter. Die einzelnen Tafeln sind nahezu horizontal gelagert. Die Sahara baut sich aus lauter terrassenförmig übereinander aufsteigenden Gebirgen auf. Selbst die bedeutendsten Gebirge bestehen aus lauter eng sich zusammendrängenden Terrassenstufen. Alles dies zeigt eine auffallende Einfachheit, und dadurch werden wir darauf hingewiesen, daß ein richtiges geologisches Großgeschehen, wie wir es von unseren Faltengebirgen her kennen, überhaupt nicht stattgefunden hat. Betrachten wir uns die Verhältnisse in Abbildung 4, so finden wir sofort, daß die Hubkräfte des (Tertiär)Mondes zur Hauptgebirgszeit hier einen senkrechten Zug veranlaßten, wodurch wohl ein Anheben eines ganzen Massivs denkbar wäre, niemals jedoch eine Faltung eintreten könnte. Derartige Faltungsvorgänge, wie sie uns die Alpen und der Himalaja darstellen, können hier nicht stattgefunden haben, sie wären nur dann denkbar, wenn Afrika für längere Zeit in die Ebbegebiete geraten wäre. Dies ist wohl vorübergehend vor und nach Abschleichen der Flutberge der Fall gewesen, doch fehlt uns hier die Zeit, die für so große Faltungsvorgänge notgedrungen auch zur Verfügung stehen müßte und die immer die gleichen Kräfte auf die gleichen Zonen wirken lassen kann. Es dürfte wohl dem Geologen noch niemals aufgefallen sein, daß der afrikanische Kontinent, wenn er wirklich uralten Ursprungs ist, einer riesigen Verwitterungszeit ausgesetzt war. Er müßte während der ganzen geologischen, ungeheuren Zeiträume stets dem Spiel der Atmosphärilien ausgesetzt gewesen sein. Wir fragen deshalb mit Recht, wo die Produkte dieser Tätigkeit hingekommen sind. Die Flußmassen führen doch nur wenig Wasser und nur zur Regenzeit, und keines der Flußtäler führt bis in das Meer. Auch hier, wie in so vielen anderen Fällen, reicht die Erosionsarbeit nicht aus, wir brauchen hier ebenso wie in den Alpen große Wasserfluten, um die gewaltige Erosionsarbeit genügend glaubhaft erklären zu können.
Wir können jedoch aus dem Fehlen von Meerestieren niemals den Schluß ableiten, daß dieses Land nicht vom Meer bedeckt war. Meerestierleichen werden am Grunde des Meeres niemals für die Zukunft dauernd und konserviert eingebettet. Am allerwenigsten aber am Grunde der Tiefsee. Es ist doch eine allgemein bekannte Tatsache, daß sich auch gegenwärtig in den tiefen und auch in den seichten Meeresschichten keine derartigen Tierleichen erhalten können. Sie sind auch dort ebenso der vollkommenen Verwesung anheimgegeben, wie an der Oberfläche, es können sich nur nichtorganische Teilchen, Gehäuse von Schnecken und dergleichen, welche kalk- oder kieselige Beschaffenheit haben, für die Zukunft erhalten. Alles andere verwest. Gut erhaltene Einbettungen von Meerestieren, welche auch für die Zukunft dauernd erhalten bleiben können, dürfen wir nur in den Ebbegebieten erwarten, wo die strenge Eiszeit ihre Eiseinbettung veranlaßt, durch deren luftdichten Abschluß uns die Abdrücke und in Ausnahmefällen auch selbst Weichteile erhalten bleiben können. Der afrikanische Kontinent war während der Flutbergherrschaft zwar vom Meer mächtig bedeckt, war jedoch in eigentlichem Sinne des Wortes niemals Ebbegebiet. Er war während des Anschleichens und des Abschleichens des Flutberges immer nur das Rodungsgebiet, aus welchem die Sedimentlager, besonders jedoch die Kohlenlager ihre Baustoffe heranschwemmten. Es ist richtig, daß die Abrasionstätigkeit dieses Kontinentes ganz besonders in die Augen springend sein sollte, und dies ist auch wirklich der Fall. Die eigenartige Beschaffenheit der Landschaft in der Sahara, die durch Terrassen ganz besonders auffällt, weisen derartige Erosionsarbeit auf, welche wir niemals durch die hier doch so geringe Erosionstätigkeit des Wassers erklären könnten. Die Terrassenmassive selbst können ja nur im Wasser abgesetzt worden sein. Wahrscheinlich stammen diese Massive aus der ältesten geologischen Zeit, denn sie weisen noch keinerlei Petrefakten auf. Sie dürften also aus einer Zeit stammen, wo auf der Erde noch kein wesentliches organisches Leben herrschte. Obwohl man in geologischen Kreisen die Meinung hört, daß diese Terrassenlandschaft der Kreideformation angehört, muß man in Anbetracht des Fehlens jeder Versteinerung diese Meinung verwerfen. Der geologische Bau der inneren Sahara ist äußerst einfach. Sie besteht vorwiegend aus einer Terrassenlandschaft mit Hochgebirgscharakter. Die einzelnen Tafeln sind nahezu horizontal gelagert. Die Sahara baut sich aus lauter terrassenförmig übereinander aufsteigenden Gebirgen auf. Selbst die bedeutendsten Gebirge bestehen aus lauter eng sich zusammendrängenden Terrassenstufen. Alles dies zeigt eine auffallende Einfachheit, und dadurch werden wir darauf hingewiesen, daß ein richtiges geologisches Großgeschehen, wie wir es von unseren Faltengebirgen her kennen, überhaupt nicht stattgefunden hat. Betrachten wir uns die Verhältnisse in Abbildung 4, so finden wir sofort, daß die Hubkräfte des (Tertiär)Mondes zur Hauptgebirgszeit hier einen senkrechten Zug veranlaßten, wodurch wohl ein Anheben eines ganzen Massivs denkbar wäre, niemals jedoch eine Faltung eintreten könnte. Derartige Faltungsvorgänge, wie sie uns die Alpen und der Himalaja darstellen, können hier nicht stattgefunden haben, sie wären nur dann denkbar, wenn Afrika für längere Zeit in die Ebbegebiete geraten wäre. Dies ist wohl vorübergehend vor und nach Abschleichen der Flutberge der Fall gewesen, doch fehlt uns hier die Zeit, die für so große Faltungsvorgänge notgedrungen auch zur Verfügung stehen müßte und die immer die gleichen Kräfte auf die gleichen Zonen wirken lassen kann. Es dürfte wohl dem Geologen noch niemals aufgefallen sein, daß der afrikanische Kontinent, wenn er wirklich uralten Ursprungs ist, einer riesigen Verwitterungszeit ausgesetzt war. Er müßte während der ganzen geologischen, ungeheuren Zeiträume stets dem Spiel der Atmosphärilien ausgesetzt gewesen sein. Wir fragen deshalb mit Recht, wo die Produkte dieser Tätigkeit hingekommen sind. Die Flußmassen führen doch nur wenig Wasser und nur zur Regenzeit, und keines der Flußtäler führt bis in das Meer. Auch hier, wie in so vielen anderen Fällen, reicht die Erosionsarbeit nicht aus, wir brauchen hier ebenso wie in den Alpen große Wasserfluten, um die gewaltige Erosionsarbeit genügend glaubhaft erklären zu können.
Die Erosionsarbeit des Wassers,
des Windes und der
Temperaturunterschiede, welche die leichten Stoffe hinwegschwemmt oder
-fegt, den Fels benagt, sprengt und zu Tal schafft, ist die wichtigste
gestaltende Kraft des Quietismus (= geologischer Aktualismus).
Von dem Sprichwort ausgehend "Steter Tropfen höhlt den Stein",
haben wir uns die Geschichte der Täler und die mannigfachen
Kupierungen des Geländes zu denken. Betrachten wir uns nun
die uns bekannten gewaltigen Erosionen in den Alpen, in den
Mittelgebirgen, im Himalaja und überall sonst auf der Erde, so
können wir daraus auch heutigentags noch unsere Schlüsse auf
die Länge der absoluten geologischen Zeiträume ziehen.
Und legen wir den Quietismus in seinen Entwicklungsphasen zugrunde,
sehen wir von jeglichen Katastrophen ab, so treten uns ganz erstaunlich
lange Zeiträume in der jüngsten geologischen Erdgeschichte
entgegen, welche mit anderen Beobachtungen und Berechnungen auf anderen
Grundlagen mit krassesten Widerspruch stehen. Aus diesem
interessanten Kapitel der "Jahreszahlen der Erdgeschichte" will ich nur
kurz ein Beispiel herausgreifen, welches aus meiner unmittelbaren
Umgebung stammt:
Wer das herrliche Elbtal, das böhmische Paradies, durchwandert hat, kennt das schöne Kirchlein, das so anmutig von Bergeshöhe oberhalb Salesls herabschaut, das Dubitzer Kirchlein. Der Wanderer genießt von diesem schönsten Punkte des Mittelgebirges einen wunderbaren Rundblick über das gesamte Mittelgebirge und sieht von hier einzigartig die tief eingeschnittenen Talrinnen, welche die Elbe und ihre einmündenden Bäche geschaffen haben müssen. Das, was uns heute als anmutigste und besonders während der Baumblüte weithin berühmte Landschaft entgegentritt, ist verursacht worden durch den Abtrag, durch Erosion und Abrasion der großen und kleinen Gewässer. Die Größe dieses Abtrags können wir messen, die Massen sind uns bekannt, die das Wasser hinwegschaffen mußte, und wir können daher unsere Schlüsse in quietistischer (aktualistischer) Weise ziehen. In geologischen Kreisen verlegt man die Erosionsarbeit dieses gesamten Gebietes hauptsächlich in das Diluvium, also in die allerjüngste geologische Vergangenheit. Fortschreitend mit dem Einsägen der Talrinnen erfolgte der Abtrag des gesamten Gebietes. Mit der Erosionsarbeit einher erfolgte auch eine Sedimentierung, so daß wir eine zweifache Tätigkeit des Wassers sehen. Das Einschneiden der gewaltigen, heute uns so anmutig entgegentretenden Talrinnen war eine gewaltige Arbeit, denn wir beobachten an einzelnen Stellen Einschnitte von mehr als 300 m Höhe. Nachdem mit der Abtragungsarbeit gleichzeitig ein Tieferlegen der gegenwärtig fließenden Gewässer und somit des ganzen Abtraggebiets einhergegangen sein muß, wollen wir aus diesen Tatsachen unsere Schlußfolgerungen ableiten.
Die Flüsse, welche hauptsächlich während des geologischen Diluviums diese gewaltige Arbeit geleistet haben sollen, sind als die Vorläufer unserer heutigen Elbe und deren kleinen Nebenflüßchen anzusehen, denn schon während der ganzen Tertiärzeit erfolgte die gesamte Entwässerung Böhmens von Süden nach Norden. Gelingt es uns, zwischen der Größe der Abtragung und der damit einhergehenden Zeit eine Beziehung herzustellen, so sind wir dadurch in der Lage, einen Maßstab für die Länge des vermeintlichen geologischen Diluviums aufzustellen. Diese vermeintlichen Flußablagerungen, welche sich in Terrassen von Schottern, von Sanden und Kiesen uns zeigen, liegen stellenweisen so hoch, daß wir erstaunen, was für eine gewaltige Arbeit das Wasser des Diluviums und Alluviums angeblich geleistet haben soll. Unter den vielen Flutanschwemmungen wollen wir hier nur kurz die exponiertesten erwähnen, das sind jene des Deblik.
Hoch auf exponierter Bergeshöhe, 305 m über dem gegenwärtigen Spiegel der Elbe, finden wir hier Sande ohne Versteinerungen, deren Alter jedoch geologisch als diluvial feststeht. Während wir auf der einen Seite die gewaltige 300 m mächtige Erosionsarbeit der Elbe bestaunen und uns verwundern, daß ihre Nebenflüßchen sogar in der Lage waren, das Urgestein, wie im Wopparner Tal, einzusägen, haben sich auf luftiger Bergeshöhe, auf dem Gipfel des Deblik die Sande während der geologisch so langen Periode des Diluviums bis auf den heutigen Tag erhalten. In dieser Höhe floß nun die Elbe - nach geologischer Ansicht - zur Diluvialzeit und lagerte die Sande, Kiese und Gerölle ab, während zur gleichen Zeit, wenige Kilometer entfernt, und durch keine Gebirgshöhen getrennt, sich die Hangendschichten der Braunkohlen in einem mehr als 200 m tiefer gelegenen See abgelagert haben sollen. Können wir uns dies vorstellen? Doch damit sind die Widersprüche nicht beendet. Auch die Geologen vom Fach wissen von diesen Widersprüchen und können sie nicht deuten. So nimmt (ehem.) R. Engelmann an, daß im jüngsten Diluvium große Hebungen des gesamten böhmischen Massivs stattgefunden haben, welche mit gleichzeitigen örtlichen stärkeren Hebungen einhergegangen sein sollen. Ihm widerspricht (der ehem.) Dr. Hibsch, welcher gesondert auf die Debliksande hinweist und die lokale Hebung eines kleinen Pfropfens von 700 m Durchmesser auf 100 m Höhe während des Jungdiluviums für geologisch unmöglich erklärt. Andere Geologen haben versucht, diese Sande durch die Winde auf Bergeshöhen tragen zu lassen, eine Ansicht, die jedoch in Anbetracht der stellenweise sehr groben Körnung vollkommen unmöglich ist. Mit Rücksicht auf die allgemeine Tektonik des böhmischen Mittelgebirges einerseits und mit Rücksicht auf die Lagerungsverhältnisse der weitesten Umgebung der Debliksande andererseits steht fest, daß dieselben frühestens am Beginn des von den Geologen als Diluvium (= Pleistozän) bezeichneten Erdgeschichtsabschnittes entstanden sind.
Wer das herrliche Elbtal, das böhmische Paradies, durchwandert hat, kennt das schöne Kirchlein, das so anmutig von Bergeshöhe oberhalb Salesls herabschaut, das Dubitzer Kirchlein. Der Wanderer genießt von diesem schönsten Punkte des Mittelgebirges einen wunderbaren Rundblick über das gesamte Mittelgebirge und sieht von hier einzigartig die tief eingeschnittenen Talrinnen, welche die Elbe und ihre einmündenden Bäche geschaffen haben müssen. Das, was uns heute als anmutigste und besonders während der Baumblüte weithin berühmte Landschaft entgegentritt, ist verursacht worden durch den Abtrag, durch Erosion und Abrasion der großen und kleinen Gewässer. Die Größe dieses Abtrags können wir messen, die Massen sind uns bekannt, die das Wasser hinwegschaffen mußte, und wir können daher unsere Schlüsse in quietistischer (aktualistischer) Weise ziehen. In geologischen Kreisen verlegt man die Erosionsarbeit dieses gesamten Gebietes hauptsächlich in das Diluvium, also in die allerjüngste geologische Vergangenheit. Fortschreitend mit dem Einsägen der Talrinnen erfolgte der Abtrag des gesamten Gebietes. Mit der Erosionsarbeit einher erfolgte auch eine Sedimentierung, so daß wir eine zweifache Tätigkeit des Wassers sehen. Das Einschneiden der gewaltigen, heute uns so anmutig entgegentretenden Talrinnen war eine gewaltige Arbeit, denn wir beobachten an einzelnen Stellen Einschnitte von mehr als 300 m Höhe. Nachdem mit der Abtragungsarbeit gleichzeitig ein Tieferlegen der gegenwärtig fließenden Gewässer und somit des ganzen Abtraggebiets einhergegangen sein muß, wollen wir aus diesen Tatsachen unsere Schlußfolgerungen ableiten.
Die Flüsse, welche hauptsächlich während des geologischen Diluviums diese gewaltige Arbeit geleistet haben sollen, sind als die Vorläufer unserer heutigen Elbe und deren kleinen Nebenflüßchen anzusehen, denn schon während der ganzen Tertiärzeit erfolgte die gesamte Entwässerung Böhmens von Süden nach Norden. Gelingt es uns, zwischen der Größe der Abtragung und der damit einhergehenden Zeit eine Beziehung herzustellen, so sind wir dadurch in der Lage, einen Maßstab für die Länge des vermeintlichen geologischen Diluviums aufzustellen. Diese vermeintlichen Flußablagerungen, welche sich in Terrassen von Schottern, von Sanden und Kiesen uns zeigen, liegen stellenweisen so hoch, daß wir erstaunen, was für eine gewaltige Arbeit das Wasser des Diluviums und Alluviums angeblich geleistet haben soll. Unter den vielen Flutanschwemmungen wollen wir hier nur kurz die exponiertesten erwähnen, das sind jene des Deblik.
Hoch auf exponierter Bergeshöhe, 305 m über dem gegenwärtigen Spiegel der Elbe, finden wir hier Sande ohne Versteinerungen, deren Alter jedoch geologisch als diluvial feststeht. Während wir auf der einen Seite die gewaltige 300 m mächtige Erosionsarbeit der Elbe bestaunen und uns verwundern, daß ihre Nebenflüßchen sogar in der Lage waren, das Urgestein, wie im Wopparner Tal, einzusägen, haben sich auf luftiger Bergeshöhe, auf dem Gipfel des Deblik die Sande während der geologisch so langen Periode des Diluviums bis auf den heutigen Tag erhalten. In dieser Höhe floß nun die Elbe - nach geologischer Ansicht - zur Diluvialzeit und lagerte die Sande, Kiese und Gerölle ab, während zur gleichen Zeit, wenige Kilometer entfernt, und durch keine Gebirgshöhen getrennt, sich die Hangendschichten der Braunkohlen in einem mehr als 200 m tiefer gelegenen See abgelagert haben sollen. Können wir uns dies vorstellen? Doch damit sind die Widersprüche nicht beendet. Auch die Geologen vom Fach wissen von diesen Widersprüchen und können sie nicht deuten. So nimmt (ehem.) R. Engelmann an, daß im jüngsten Diluvium große Hebungen des gesamten böhmischen Massivs stattgefunden haben, welche mit gleichzeitigen örtlichen stärkeren Hebungen einhergegangen sein sollen. Ihm widerspricht (der ehem.) Dr. Hibsch, welcher gesondert auf die Debliksande hinweist und die lokale Hebung eines kleinen Pfropfens von 700 m Durchmesser auf 100 m Höhe während des Jungdiluviums für geologisch unmöglich erklärt. Andere Geologen haben versucht, diese Sande durch die Winde auf Bergeshöhen tragen zu lassen, eine Ansicht, die jedoch in Anbetracht der stellenweise sehr groben Körnung vollkommen unmöglich ist. Mit Rücksicht auf die allgemeine Tektonik des böhmischen Mittelgebirges einerseits und mit Rücksicht auf die Lagerungsverhältnisse der weitesten Umgebung der Debliksande andererseits steht fest, daß dieselben frühestens am Beginn des von den Geologen als Diluvium (= Pleistozän) bezeichneten Erdgeschichtsabschnittes entstanden sind.
Uns tritt also hier in der
Zeitspanne seit Bildung dieser Sande das
absolute Alter des Diluviums entgegen. Wir wollen es an der Hand
der Erosionsarbeit überprüfen. Wenn der Fluß,
nachdem eine nachträgliche Hebung nicht feststellbar und denkbar
ist, einstmals in diesen Höhen floß, gegenwärtig jedoch
etwa 300 m tiefer fließt, so hat er während des Diluviums
nicht allein die Rinne in das Gebirge um diesen Betrag tiefer gelegt,
sondern auch sein gesamtes Abtragsgebiet mindestens auch um diesen
Betrag gesenkt. Das gesamte Quellgebiet der Elbe beträgt
aber ungefähr 50 000 km². Wir wollen annehmen,
daß nur die Erosionsarbeit allein in Rechnung gezogen wird, von
den Ergänzungen der Stoffe, wollen wir absehen. Die seit
Beginn des Diluviums vollzogene Abtragungsarbeit betrug demnach 50 000
km² × 0,3 = 15 000 km³. Legen wir die
quietistischen (aktualistischen) Verhältnisse zugrunde und nehmen
wir an, daß die Elbe durchschnittlich immer die gleiche
Wassermenge wegführt, welche gegenwärtig abfließt, so
können wir die gelösten und mitgeführten Stoffe
empirisch feststellen. Die Elbe entführt gegenwärtig
jährlich nach verschiedenen Messungen 978 Millionen kg feste
Stoffe + 192 Millionen kg gelöste Stoffe = 1170 Millionen kg
Abtragungen. Der Abtrag, welcher sich auf das gesamte Quellgebiet
von 50 000 km² verteilt, beträgt demnach jährlich 1,17
Millionen Tonnen. Nehmen wir eine durchschnittliche Dichte der
entführten Gesteine von 3 an, so erhalten wir 390 000 m³ an
festen und gelösten Stoffen, um welche das Abtragsgebiet
jährlich erniedrigt wird. Daraus ergibt sich die
jährliche Abtragung mit 0,0078 mm. Die gesamte Abtragung
seit dem Diluvium betrug nun 300 m, folglich müßte die
Zeitspanne aus dem Bruch 300 000 durch 0,0078 = 38 000 000 Jahre
abgeleitet werden. Es müßten also seit Beginn des
Diluviums bis auf den heutigen 38 000
000 Jahre verstrichen sein. Wir können diese Rechnung
in verschiedenartiger Form und auf andere Abtragungsgebiete
übertragen, wobei wir gewöhnlich auf erstaunlich hohe Zeiten
kommen. Diese Zahlen stehen nun mit den geologischerseits
angenommenen absoluten Zahlen in sehr krassem Widerspruch, trotzdem sie
mit den sonstigen Beobachtungen bei anderen Flüssen in keinem
Widerspruch stehen, denn der Neckar z. B. erniedrigt sein
Flußgebiet jährlich um 0,05 mm, der Hudson aber nur um 0,006
mm. Der (ehem.) amerikanische Geologe Clarke hat
diesbezüglich eine große Zahl derartiger Messungen für
die ganze Erde gesammelt und kommt auf Grund dieser Zusammenstellung zu
dem Resultate, daß für die Flüsse der ganzen Erde eine
Jahresleistung von 2500 Millionen Tonnen gelöster und 6000
Millionen Tonnen schwebender fester Stoffe in Betracht kommt.
Dies entspricht einer jährlichen Abtragung von 0,03 mm im
Durchschnitt, wobei jedoch die reißenden Alpenflüsse Po und
Reuß und auch der durch seine Erosionsarbeit berühmt
gewordene Irawadi in Indien mit inbegriffen sind, von denen der letzte
allein eine Jahresleistung von 0,08 mm
aufzuweisen hat.
Wir sehen, daß unsere durchgeführte Berechnung des Alters des Diluviums mit 38 000 000 Jahren mit den Erfahrungen über Flußabtragungen nicht in Widerspruch steht. Man wird uns jedoch einwenden können, daß die Elbe während des Diluviums mehr Wasser geführt haben wird. Wir können dies ohne weiteres zugeben, obwohl dies mit der Ansicht, daß Böhmen während des Diluviums ein stürmereiches Steppenland war, nicht übereinstimmt. Wir können die Wassermenge der Elbe vervielfachen und haben doch immer noch so ungeheuer lange Zeiträume errechnet, die mit sonst gewonnenen absoluten Zahlen nicht in Einklang gebracht werden können. Die Angaben über die Länge des Diluviums gehen bei den Geologen wohl sehr auseinander, sie sind jedoch in dem Zahlenraum 200 000 bis 1 000 000 Jahre enthalten. (Anmerk. des WEL-Instituts: heute wird das Diluvium = Pleistozän auf zirka 2,6 Millionen Jahre geschätzt). Auch für das Tertiär sind die verschiedenen Angaben über die absolute Zeitdauer sehr verschieden und schwanken zwischen 15-40 Millionen Jahren. Unsere Berechnung würde uns also schon in den Beginn des Tertiärs, evtl. in die Kreidezeit hineinführen.
Wir sehen, daß unsere durchgeführte Berechnung des Alters des Diluviums mit 38 000 000 Jahren mit den Erfahrungen über Flußabtragungen nicht in Widerspruch steht. Man wird uns jedoch einwenden können, daß die Elbe während des Diluviums mehr Wasser geführt haben wird. Wir können dies ohne weiteres zugeben, obwohl dies mit der Ansicht, daß Böhmen während des Diluviums ein stürmereiches Steppenland war, nicht übereinstimmt. Wir können die Wassermenge der Elbe vervielfachen und haben doch immer noch so ungeheuer lange Zeiträume errechnet, die mit sonst gewonnenen absoluten Zahlen nicht in Einklang gebracht werden können. Die Angaben über die Länge des Diluviums gehen bei den Geologen wohl sehr auseinander, sie sind jedoch in dem Zahlenraum 200 000 bis 1 000 000 Jahre enthalten. (Anmerk. des WEL-Instituts: heute wird das Diluvium = Pleistozän auf zirka 2,6 Millionen Jahre geschätzt). Auch für das Tertiär sind die verschiedenen Angaben über die absolute Zeitdauer sehr verschieden und schwanken zwischen 15-40 Millionen Jahren. Unsere Berechnung würde uns also schon in den Beginn des Tertiärs, evtl. in die Kreidezeit hineinführen.
Wir haben nun gesehen, in was
für krasse Widersprüche sich
durch so erfolgende exakte Rechnungen die geologischen Ansichten
bringen lassen, denn dieses eine gewählte Beispiel ließe
sich ohne weiteres verfielfachen. Wir brauchen nur einmal die
weit ausgewaschenen breiten Alpentäler der Drau, der Gail, der
Save, die langen Täler des Inn und andere derartigen Berechnungen
zugrunde zu legen, um einsehen zu müssen, daß die einfache Erosionsarbeit
auf quietistischer (aktualistischer) Basis niemals in der Lage sein
wird, diese Rätsel zu lösen. Wir können die kleine
Arbeit des Wassertropfens bewundern, wir können sie spüren,
wir können sie aber niemals allein
für geologische Großgeschehen als die wichtigste
gebirgs- gestaltende Kraft gelten lassen. Sie leistet nur die
Vorbereitungsarbeit für die kommenden Katastrophen, die
Mondeswasserfluten, welche die Hauptgestaltung allein durchführen.

Abbildung. 1; (Bildquelle: "Schlüssel zum
Weltgeschehen", Heft 4, S.
228, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Betrachten wir nun noch einmal
Abbildung 1, das schematische Profil der
Schweizer Alpen, und denken wir uns das heutige wirkliche Profil dazu,
so kann dies nur durch eine Riesenerosionsarbeit entstanden sein.
Viele Kilometer müssen verschwunden sein, und wenn wir die
Gewässer noch so reißend arbeiten lassen und die Gletscher
als Pflüge die Einschnitte aushobeln, so müßten
trotzdem unfaßbar lange Zeiträume zur Verfügung stehen,
um das verhältnismäßig jung entstandene Gebirge in
seine jetzige Form zu bringen.
Und was wir an den Alpen beobachten können, tritt uns in ebenso gigantischem Maße, nur noch viel gewaltiger, in dem größten aller Gebirge, im Himalaja, entgegen. Auch von diesem Gebirge hat man gesagt, daß es nicht in das Schema der Welteislehre hineinpaßt. Mit nichten, denn es paßt ebenso in das Schema wie die angezweifelten Gebirge: Alleghanis, Ural. Wir müssen uns nur der Beschaffenheit der Erdkruste erinnern und der Kraftwirkungen, welche um die Zeit des stationären (Tertiär)Mondes von diesem ausgehen.
Und was wir an den Alpen beobachten können, tritt uns in ebenso gigantischem Maße, nur noch viel gewaltiger, in dem größten aller Gebirge, im Himalaja, entgegen. Auch von diesem Gebirge hat man gesagt, daß es nicht in das Schema der Welteislehre hineinpaßt. Mit nichten, denn es paßt ebenso in das Schema wie die angezweifelten Gebirge: Alleghanis, Ural. Wir müssen uns nur der Beschaffenheit der Erdkruste erinnern und der Kraftwirkungen, welche um die Zeit des stationären (Tertiär)Mondes von diesem ausgehen.

(Bildquelle u. -text:
"Schlüssel zum Weltgeschehen", Heft 4, S.
253, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Präkambrisches Gebirge nach Kreichgauer. Geologisch ein schlagender Beweis für die Welteislehre.
Die von Kreichgauer festgestellten Gebirge entsprechen vollkommen der von der Welteislehre zu fordernden Zenit-Flutbergumkränzung.
Präkambrisches Gebirge nach Kreichgauer. Geologisch ein schlagender Beweis für die Welteislehre.
Die von Kreichgauer festgestellten Gebirge entsprechen vollkommen der von der Welteislehre zu fordernden Zenit-Flutbergumkränzung.
Zu diesem Zwecke dienen uns die
Karten Kreichgauers, welcher in
emsigster Arbeit nach jahrelangen Bemühungen herausgefunden hat,
daß alle auf der Erde befindlichen Kettengebirge in großen
Zügen wie ein doppelt geschlungenes Band den Äquator
umlaufen. Kreichgauer hat dies nicht allein für das
Tertiär, sondern auch für das azoische, das
präkambrische und das karbonische Zeitalter ausgeführt.
Die von ihm in Unkenntnis der Welteislehre durchgeführten
Arbeiten, welche geologischerseits Anerkennung gefunden haben und
vielleicht nur in kleinen Einzelheiten widerlegt oder bezweifelt werden
dürfen, sind ein schlagender Beweis für die Annahmen der
Welteislehre, denn sie zeigen uns deutlich die schon erwähnte
Umkränzung der beiden Flutberge zur Hauptgebirgsbauzeit, zur
stationären Zeit. Wir sehen von dem letzten Zeitalter an,
daß Afrika wie ein Horst von diesen Gebirgsbauvorgängen
ausgeschlossen war, und können daran nicht achtlos
vorübergehen, wie dies die Anhänger der Kontraktionstheorie
(heute: Plattentektonik-Theorie) tun. Wir müssen uns sagen,
daß wir eine Ursache zugrunde liegt, welche eben darin besteht,
daß der Zenitflutberg zur Gebirgsbauzeit über Afrika stand.
Die afrikanische Kontinentmasse war aus diesem Grunde nur von den
hebenden lotrechten Kräften der Mondanziehung beeinflußt und
konnte daher an dem Gebirgsbau nicht teilnehmen. Wir wollen uns
diesen Vorgang nun noch einmal vor Augen halten. Bevor der
stationäre Zustand wirklich erreicht wurde, kam der Flutberg, von
Osten kommend, mit dem letzten Reste der negativen Flutgeschwindigkeit
heran und stand unmittelbar vor seinem Stillstand über Afrika
(Erdumdrehung und Mondumlauf sind zeitlich gleich). Der Flutberg
wird gewiß, bevor er über dem Afrikahorst anstieg, durch
einige Zeit in der indischen Ozeanwanne stillgestanden sein. Dies war
nun die Zeit, wo der Beginn der Faltungen des Himalaja stattfand,
welche auch zu jener Zeit, als sich die Flutberge schon über
Afrika verankert hatten und die Alpen während ihrer Hauptfaltung
waren, weiter fortschritt und dann zum Abschluß gelangte, als der
rückeilende Flutberg zum zweiten Male nach der stationären
Zeit abermals in der indischen Ozeanwanne eine Zeitlang anhielt, um
nochmals seine Kräfte zu den großen Faltungen spielen zu
lassen. Wir wollen dabei keineswegs außer acht lassen,
daß auch zu der stationären Zeit auf das Gebirgskettensystem
Kraftwirkungen von dem über Afrika stehenden Monde ausgingen,
welche sich als tangentiale Schubkräfte äußerten und
über dem Himalaja eben zu dieser Zeit sich in zwei Komponenten
äußerten, die sich aus den Wirkungen des Zenit- und auch des
Nadirflutberges zusammensetzen. Während die eine horizontale
Schubkraft in der Richtung gegen den afrikanischen Zenit hinanstrebte,
war die Richtung der aus dem Nadirflutberg abgeleiteten Schubkraft
gegen den Stillen Ozean gerichtet. Beide bildeten zusammen eine
Resultierende, deren Größe wir bei der Gebirgsbildung nicht
vernachlässigen können und die gemeinsam mit den schon vor
der stationären Zeit und nach derselben erfolgenden Kräften
aus dem Stillstande der Flutberge im Indischen Ozean eben die
Veranlassung zur Bildung des Himalaja bzw. des Hedingebirges
gaben. Die Beschaffenheit des Afrikahorstes hat den Stillstand
über diesem Kontinent bewirkt, und wir können ebenso
annehmen, daß dieser Stillstand ebenso bei dem geringen relativen
Vorschleichen der Flutberge im Indischen Ozean erfolgte, wie es auch
wahrscheinlich ist, daß die noch geringe Tendenz der
Vorwärtsbewegung der Flutberge es veranlaßt hat, daß
der Zenitflutberg vor der wirklichen Verankerung über Afrika
für kurze Zeit in den Atlantischen Ozean sich hinabwälzte, um
dort nur kurze Zeit stillzustehen, bis er von dem Afrikahorste
gezwungen wurde, sich über diesem wirklich stationär
einzustellen. Diese zeitweisen substationären Zustände,
unmittelbar vor der wirklich stationären Zeit gaben nun die
Veranlassung für die ovale Gestaltung der Flutbergumfaltungen. Unter
diesem Gesichtspunkt betrachtet, erscheinen uns die interessanten
Karten Kreichgauers besonders wahrscheinlich, denn sie haben fast alle
diesen Eigentümlichkeiten der Flutberge Rechnung getragen.
Die aus diesem Substationär-Zustand resultierenden Anomalien der
Flutbergumfaltungen lösen uns spielend verschiedene Rätsel
der Gebirgsbildung. Hörbiger knüpft an diese
Eigentümlichkeit, welche er Achtertendenz der
Flutbergmassen-Schwingung nennt, folgende Kombinationen an. Es
ist auffallend, daß heute im tropischen und gemäßigten
Gürtel der nördlichen Hemisphäre die Inseln, Halbinseln,
Meeresengen und Meeresbuchten im Durchschnitt eine so auffallende
Tendenz zu einem Nordwest-Südost-Verlauf zeigen. Italien und
die Adria mit ihren östlichen Inseln, ganz Griechenland und das
Ägäische Meer mit seinen zahlreichen nach Süd-Ost
gerichteten Inseln, Buchten und Halbinseln, das Kaspische Meer mit
Arabien und dem Persischen Meerbusen, Vorder- und Hinterindien mit
Malakka und Sumatra, schließlich Panama, Niederkalifornien und
Florida, wenn man von den sonstigen feineren Gliederungen absieht,
zeigen alle die genannte Tendenz. Die Abrasionsarbeit der nördlichen Flutberge vollzog
sich offenbar nicht genau meridional, sondern in Richtung, welche durch
die oben aufgezählten Küstenlinien angedeutet
erscheint. Natürlich kommt für diese Achtertendenz der
Abrasionsarbeit nicht so sehr die stationäre Zeit in Betracht, als
vielmehr die Zeit der rück- und vorschleichenden
Flutbewegungen. Auf diese auffallende Beschaffenheit mancher
Kontinente und Gliederungen derselben hat schon der geologische
Altmeister Sueß aufmerksam gemacht, indem er sagte: "Die meisten Kontinente zeigen nach
Süden hin ein keilförmiges Auslaufen."
Wir haben gesehen, daß
die Anwesenheit der Flutberge, deren
Bewegungen durch den (Tertiär)Mond diktiert wurden, gleichzeitig
mit den durch die Mondeshubkräfte bedingten Faltungen einhergeht
und beide innig miteinander verzahnt sind. Wir haben auch
kennengelernt, daß unsere Faltengebirge und die Sedimentgebirge
gerade dort sein müssen, wo wir sie finden, daß sie an
keinen anderen Orten auftreten konnten, weil die Wirkungen der
Kräfte des (Tertiär)Mondes sie dort erstehen
ließen. Die vermeintlichen Widersprüche sind in ein
Nichts verraucht, denn es sind keine Widersprüche vorhanden, wenn
wir nur die etwas komplizierten Verhältnisse eingehender sowohl
vom mechanischen als auch vom glazialkosmogonischen (welteislichen)
Standpunkte aus betrachten. Die neue Ansicht der Welteislehre ist
aber - im Gegensatz zu allen früheren Theorien - in der Lage, auch
jene Fragen zu beantworten, die uns bisher so rätselhaft
erschienen: Warum sind gewisse Gebiete auf der Erde vom geologischen
Geschehen nahezu vollkommen ausgeschlossen? Warum haben die
Faltungsgebirge eine so eigenartige Gliederung?
Ursprung der Eiszeiten
Niemals hätten die
Faltengebirge jenen komplizierten Aufbau
erhalten, wenn sie nicht mit der eiszeitlichen Sedimentierung
einhergehen würden. Wir wissen heute mit apodiktischer
Sicherheit, daß die Erde nicht einmal, sondern schon wiederholt
von großen Eiszeitkatastrophen heimgesucht wurde, und es wurden
diese Zeiten starker Kälteperioden als die ganze Erde heimsuchend
erkannt, obwohl es bisher noch nicht gelungen ist, für die
Anwesenheit der Eiszeiten eine wirklich mitdenkbare Deutung zu
bringen. Man nimmt die Eiszeiten als Faktum hin, hat zwar schon
vielfach versucht, dieser schwierigen meteorologischen Erscheinung
näherzutreten, und trotzdem ist es bis auf den heutigen Tag nur
der Welteislehre gelungen, für alle die Nebenerscheinungen, welche
gleichzeitig mit den Eiszeiten einhergehen, eine wahrhaft
glaubwürdige Erklärung zu finden. Eine Unzahl von
Theorien ist aufgetaucht und gewöhnlich schon nach kurzer Zeit in
Vergessenheit geraten. Irdische und kosmische Kräfte wurden
zur Erklärung herangezogen, das eine Rätsel wurde durch ein
neues noch unbeweisbareres ersetzt und die Fragestellung
verschleiert. Wirklich glaubhafte Theorien sind aber bis heute
(auch im 21. Jahrhundert!), außer jener der Welteislehre, nicht vorhanden.
Und so steht auch in dem berühmten Sammelwerke, der Lethaea geognostica, der vielsagende Ausspruch: "Die Entstehung der Eiszeiten kennt man nicht." Und doch wissen alle Geologen, daß gerade den verschiedenen Eiszeiten mit ihren Wirkungen im Aufbau unserer Erdkruste eine bedeutende Rolle zukommt.
Man versucht die Entstehung der Eiszeiten nach den Ansichten der Welteislehre zu bezweifeln, indem man verschiedene untergeordnete Beobachtungen gegen die Welteislehre deutet.
Die Spuren der Eiszeiten, welche sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben und uns in der Natur als Gletscherschutt, als Rundhöcker, als Moränen, als Gletscherlehm usw. entgegentreten, sind immer nur Erscheinungen, welche mit einer Gletschertätigkeit in Zusammenhang stehen. Zur Gletscherbildung gehören aber mehrere Umstände. Es genügt nicht allein die Höhe des Gebirges, nicht allein die geographische Breite, sondern auch die zur Speisung der Gletscher notwendigen Niederschläge. Sind diese nicht vorhanden, dann kann sich auch keine Gletschertätigkeit entfalten.
Wir werden deshalb in Gegenden, wo die entsprechenden Gebirgshöhen vorhanden sind und wo auch die entsprechenden Niederschläge zur Verfügung stehen, große Gletschertätigkeit erwarten können. Trockene Gebiete können keine oder nur untergeordnete Gletschertätigkeit hervorbringen. So beobachten wir entsprechend der Stärke der Niederschläge auch gegenwärtig noch eine Abnahme der Gletschertätigkeit von West nach Ost, welche selbst durch die bedeutenderen Höhen der Gebirge nicht ausgeglichen werden können. Nach der Mächtigkeit der Gletscher richtet sich aber unmittelbar die Arbeit derselben. Heutzutage sind wir nur in der Lage, aus der uns noch bis jetzt erhalten gebliebenen Gletscherarbeit seine einstmalige Tätigkeit zu erkennen. Je größer sie war, desto wahrscheinlicher sind auch die erhalten gebliebenen Spuren. Denken wir nun daran, daß seit jenen Gletschertätigkeiten Jahrzehntausende ins Land gegangen sind und die einstmaligen Spuren arg verwischt haben, denken wir an die erfolgten Abtragungen noch während der Eiszeit selbst und während des dieser folgenden diluvialen Zeitalters, dann müssen wir uns sagen, daß nur sehr wuchtige Spuren, mächtige Schichtablagerungen, gewaltige Gletschertätigkeit uns erhalten geblieben sein wird, Kleinarbeit jedoch verloren gegangen ist. Es ist eine bekannte Tatsache, daß die Erkennungszeichen von Gletscherarbeit mit der Entfernung von diesem abnehmen, weshalb wir, mit Rücksicht auf die Arbeit der Atmosphärilien, ohne weiteres sagen können, die Gletscher haben einstmals viel weiter gereicht, als gegenwärtig ihre Spuren dies erkennen lassen. .......
Und so steht auch in dem berühmten Sammelwerke, der Lethaea geognostica, der vielsagende Ausspruch: "Die Entstehung der Eiszeiten kennt man nicht." Und doch wissen alle Geologen, daß gerade den verschiedenen Eiszeiten mit ihren Wirkungen im Aufbau unserer Erdkruste eine bedeutende Rolle zukommt.
Man versucht die Entstehung der Eiszeiten nach den Ansichten der Welteislehre zu bezweifeln, indem man verschiedene untergeordnete Beobachtungen gegen die Welteislehre deutet.
Die Spuren der Eiszeiten, welche sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben und uns in der Natur als Gletscherschutt, als Rundhöcker, als Moränen, als Gletscherlehm usw. entgegentreten, sind immer nur Erscheinungen, welche mit einer Gletschertätigkeit in Zusammenhang stehen. Zur Gletscherbildung gehören aber mehrere Umstände. Es genügt nicht allein die Höhe des Gebirges, nicht allein die geographische Breite, sondern auch die zur Speisung der Gletscher notwendigen Niederschläge. Sind diese nicht vorhanden, dann kann sich auch keine Gletschertätigkeit entfalten.
Wir werden deshalb in Gegenden, wo die entsprechenden Gebirgshöhen vorhanden sind und wo auch die entsprechenden Niederschläge zur Verfügung stehen, große Gletschertätigkeit erwarten können. Trockene Gebiete können keine oder nur untergeordnete Gletschertätigkeit hervorbringen. So beobachten wir entsprechend der Stärke der Niederschläge auch gegenwärtig noch eine Abnahme der Gletschertätigkeit von West nach Ost, welche selbst durch die bedeutenderen Höhen der Gebirge nicht ausgeglichen werden können. Nach der Mächtigkeit der Gletscher richtet sich aber unmittelbar die Arbeit derselben. Heutzutage sind wir nur in der Lage, aus der uns noch bis jetzt erhalten gebliebenen Gletscherarbeit seine einstmalige Tätigkeit zu erkennen. Je größer sie war, desto wahrscheinlicher sind auch die erhalten gebliebenen Spuren. Denken wir nun daran, daß seit jenen Gletschertätigkeiten Jahrzehntausende ins Land gegangen sind und die einstmaligen Spuren arg verwischt haben, denken wir an die erfolgten Abtragungen noch während der Eiszeit selbst und während des dieser folgenden diluvialen Zeitalters, dann müssen wir uns sagen, daß nur sehr wuchtige Spuren, mächtige Schichtablagerungen, gewaltige Gletschertätigkeit uns erhalten geblieben sein wird, Kleinarbeit jedoch verloren gegangen ist. Es ist eine bekannte Tatsache, daß die Erkennungszeichen von Gletscherarbeit mit der Entfernung von diesem abnehmen, weshalb wir, mit Rücksicht auf die Arbeit der Atmosphärilien, ohne weiteres sagen können, die Gletscher haben einstmals viel weiter gereicht, als gegenwärtig ihre Spuren dies erkennen lassen. .......
Wir sprachen bisher immer nur
von Gletschertätigkeit
mit ihren auch uns noch teilweise
erhalten gebliebenen Runenzeichen, sprachen jedoch bisher noch nicht
von dem Landeis. Und doch spricht Hörbiger immer nur von
Vereisungen, welche sich von den Polkappen vorschoben und worin wir
keineswegs nur Gletschertätigkeit zu verstehen haben, sondern auch
Landeis. Der
Unterschied zwischen dem Gletscher und dem Landeis besteht darin,
daß der Gletscher eine mehr oder weniger stark fließende
Bewegung zeigt, wogegen das Landeis unter gewöhnlichen
Umständen als ruhend zu denken
ist. Der fließende Gletscher hinterläßt
aber Spuren, das nicht fließende, daher auch nicht arbeitende
Landeis kann Spuren größeren Geschehens niemals hinterlassen. Nagt nun
der Zahn der Zeit an den einstmals weit ausgedehnteren Gletscherspuren
und ist dort in der Lage, die einstmalige Gletschertätigkeit zu
verwischen, so muß er um so mehr die geringen, kaum vorhandenen
Spuren des Landeises beseitigen. Wir erkennen sie nicht mehr,
weil wir keine Spuren sehen, und doch
war das Landeis vorhanden.
Es ist doch an und für sich unwahrscheinlich, daß während der letzten großen Eiszeit Deutschland, die Alpen, die Karpathen und selbst die Balkangebirge unter einer viele Kilometer mächtigen urgewaltigen Eisdecke begraben gewesen sein sollen, während zu selben Zeit das klassische Land des Eises und der Kälte, Sibirien, eislos gewesen sein soll. Wir beobachten ausgedehnte, wenn auch nicht zusammenhängende Gletscherspuren in den sibirischen und südlich angrenzenden Gebirgen und schließen daraus auf eine Gletschertätigkeit, welche jedoch in Anbetracht der geringen Niederschlagsmengen nur ein geringes Fließen der Gletscher gewährleisten konnte. Wir müssen aber den Schluß ableiten, daß die Landeisdecke, welche zwar einmal erzeugt, jedoch nicht gespeist werden muß, vorhanden war, daß wir ihre Spuren aber heute nicht mehr erkennen können, weil sie entweder keine oder inzwischen verwischte Spuren hinterlassen hat. Man wird entgegnen, daß auch das Landeis ein geringes Fließen zeigt, wie wir es von Grönland her kennen, und doch wissen wir gerade von dort, daß die Bewegungen mit dem Profil des eisbedeckten Gebirges zusammenhängen, wodurch ein langsames Fließen möglich ist.
Mit der gleichen Berechtigung können wir den Einwurf zurückweisen, daß auch in den tropischen Gebirgen Gletscherspuren, selbst in Äquatornähe, beobachtet werden. Unter Beziehung auf Abbildung 4 können wir antworten, daß zur vor- und nachstationären Zeit, als die Ebbegebiete weit gegen den Äquator hin sich erstreckten und durch welche infolge der Luftabsaugung durch die (Tertiär)Mondkräfte eine allgemeine Luftverarmung eingesetzt hatte, die Ebbegebiete weitgehende Vereisungsmöglichkeiten boten. Der Luftmantel der Erde wurde verzerrt dadurch, daß sich über den beiden Wasserflutbergen mächtige Luftkalotten auftürmten und hier die obersten Wasserstoffschichten in den Weltenraum entströmten, während zur selben Zeit den Ebbegebieten zur Speisung der Zenit- und Nadirluftkalotten Luft entnommen wurde, wodurch hier diese verdünnt, der Luftmantel geschwächt und die Erde in diesen Zonen der grimmigen Weltenraumkälte ausgesetzt wurde. So senkte sich die Schneegrenze in den südlichen tropischen Zonen weit unter die heutige Schneegrenze herab und, verbunden mit den zahlreichen Niederschlagsmengen, war so die Veranlassung für die Vergletscherungen gegeben. Diese Gletscher haben ihre Wahrzeichen bis auf den heutigen Tag teilweise erhalten, sie stammen jedoch alle aus größeren Bergeshöhen, wo sie, geschützt vor dem Spiel der Flutberge, teilweise noch erhalten bleiben konnten. Ein Teil dieser Wahrzeichen einstmaliger großer Gletschertätigkeit ist jedoch auch als Gerölle und Schutt, mit Gletscherschrammen, zu Tal gewandert und kann in Ausnahmefällen uns heute begegnen, unsere Phantasie anregen, welche in tropischen heißen Gebieten Gletschertätigkeit nicht erwarten wird. Wir können auch hier dem Einwurf begegnen, daß diese Gletscherspuren von den Flutbergen vernichtet werden müßten. Keineswegs, denn auch zur aufgeregtesten Katastrophenzeit waren in den Hochgebirgen der Anden, in Abessinien usw. immer noch Asylmöglichkeiten für Menschen und Tiere vorhanden. Bis zu diesen Höhen reichten die Flutberge nicht, hier blieb Leben erhalten und hier haben sich auch Gletscherspuren bis auf unsere Tage erhalten können. Nur auf diese Weise kommen wir den uns so geheimnisvoll anmutenden indischen Eiszeitspuren aus der Permzeit bei, welche nur wenige Breitengrade oberhalb des Äquators schon wiederholt Anlaß für die Aufstellung von geist- und phantasievollen Theorien gegeben haben.
Es ist doch an und für sich unwahrscheinlich, daß während der letzten großen Eiszeit Deutschland, die Alpen, die Karpathen und selbst die Balkangebirge unter einer viele Kilometer mächtigen urgewaltigen Eisdecke begraben gewesen sein sollen, während zu selben Zeit das klassische Land des Eises und der Kälte, Sibirien, eislos gewesen sein soll. Wir beobachten ausgedehnte, wenn auch nicht zusammenhängende Gletscherspuren in den sibirischen und südlich angrenzenden Gebirgen und schließen daraus auf eine Gletschertätigkeit, welche jedoch in Anbetracht der geringen Niederschlagsmengen nur ein geringes Fließen der Gletscher gewährleisten konnte. Wir müssen aber den Schluß ableiten, daß die Landeisdecke, welche zwar einmal erzeugt, jedoch nicht gespeist werden muß, vorhanden war, daß wir ihre Spuren aber heute nicht mehr erkennen können, weil sie entweder keine oder inzwischen verwischte Spuren hinterlassen hat. Man wird entgegnen, daß auch das Landeis ein geringes Fließen zeigt, wie wir es von Grönland her kennen, und doch wissen wir gerade von dort, daß die Bewegungen mit dem Profil des eisbedeckten Gebirges zusammenhängen, wodurch ein langsames Fließen möglich ist.
Mit der gleichen Berechtigung können wir den Einwurf zurückweisen, daß auch in den tropischen Gebirgen Gletscherspuren, selbst in Äquatornähe, beobachtet werden. Unter Beziehung auf Abbildung 4 können wir antworten, daß zur vor- und nachstationären Zeit, als die Ebbegebiete weit gegen den Äquator hin sich erstreckten und durch welche infolge der Luftabsaugung durch die (Tertiär)Mondkräfte eine allgemeine Luftverarmung eingesetzt hatte, die Ebbegebiete weitgehende Vereisungsmöglichkeiten boten. Der Luftmantel der Erde wurde verzerrt dadurch, daß sich über den beiden Wasserflutbergen mächtige Luftkalotten auftürmten und hier die obersten Wasserstoffschichten in den Weltenraum entströmten, während zur selben Zeit den Ebbegebieten zur Speisung der Zenit- und Nadirluftkalotten Luft entnommen wurde, wodurch hier diese verdünnt, der Luftmantel geschwächt und die Erde in diesen Zonen der grimmigen Weltenraumkälte ausgesetzt wurde. So senkte sich die Schneegrenze in den südlichen tropischen Zonen weit unter die heutige Schneegrenze herab und, verbunden mit den zahlreichen Niederschlagsmengen, war so die Veranlassung für die Vergletscherungen gegeben. Diese Gletscher haben ihre Wahrzeichen bis auf den heutigen Tag teilweise erhalten, sie stammen jedoch alle aus größeren Bergeshöhen, wo sie, geschützt vor dem Spiel der Flutberge, teilweise noch erhalten bleiben konnten. Ein Teil dieser Wahrzeichen einstmaliger großer Gletschertätigkeit ist jedoch auch als Gerölle und Schutt, mit Gletscherschrammen, zu Tal gewandert und kann in Ausnahmefällen uns heute begegnen, unsere Phantasie anregen, welche in tropischen heißen Gebieten Gletschertätigkeit nicht erwarten wird. Wir können auch hier dem Einwurf begegnen, daß diese Gletscherspuren von den Flutbergen vernichtet werden müßten. Keineswegs, denn auch zur aufgeregtesten Katastrophenzeit waren in den Hochgebirgen der Anden, in Abessinien usw. immer noch Asylmöglichkeiten für Menschen und Tiere vorhanden. Bis zu diesen Höhen reichten die Flutberge nicht, hier blieb Leben erhalten und hier haben sich auch Gletscherspuren bis auf unsere Tage erhalten können. Nur auf diese Weise kommen wir den uns so geheimnisvoll anmutenden indischen Eiszeitspuren aus der Permzeit bei, welche nur wenige Breitengrade oberhalb des Äquators schon wiederholt Anlaß für die Aufstellung von geist- und phantasievollen Theorien gegeben haben.
Die Versteinerungsursache
Mit dem Eis hängt auch
innig die Geschichte von den
Versteinerungen zusammen, aus welcher wir einzig und allein auf das
gleichzeitige Entstehen zweier Schichten in verschiedenen Gegenden
schließen dürfen. Das gleichzeitige Vorhandensein
typischer Versteinerungen in verschiedenen Schichten verschiedener
Länder weist auf die Gleichzeitigkeit der Entstehung hin.
Darauf beruht die Lehre von den Leitfossilien. Wir können
auch hier ohne Hilfe des Eises nicht auskommen. Wenn man
behauptet, daß die Hilfe des Eises entbehrt werden kann, so ist
dies doch sehr unwahrscheinlich, denn abgesehen von den sibirischen
Mammuts, welche ja bestimmt nur durch Kälte erhalten geblieben
sind, abgesehen von den kalkhaltigen Muschelschalen und Knochen gibt es
sehr viele Versteinerungen, so z. B. die feinsten Blättchen, mit
den kleinsten Rippen, heute noch deutlich wahrnehmbar, Abdrücke
und Skelette mit den genauesten Gliederungen, die wir auf quietistische
(= aktualistische) Weise ohne
Eiseinbettung nicht deuten können. Wir behaupten ja
keineswegs, daß uns in den Versteinerungen die einstmaligen
Kadaverreste, die verwesbaren Bestandteile, entgegentreten, wir
behaupten nur, daß die große Mehrzahl der Versteinerungen,
ohne Anwesenheit von Eis, uns heute nicht mehr erhalten geblieben
wären; denn sie wären alle der Verwesung
anheimgefallen.

(Bildquelle:
Privatinstitut für
Welteislehre, aufgenommen im Mammutmuseum Siegsdorf, Sonderausstellung
"Fossiles Afrika" 2014/2015)
Solch ein Abdruck von Meerespflanzen ist ohne eine rasche Eiseinbettung nicht zu deuten.
Solch ein Abdruck von Meerespflanzen ist ohne eine rasche Eiseinbettung nicht zu deuten.
In was für Irrwege die
Geologie gerade auf diesem Gebiet geraten
ist, zeigt das Beispiel von den Versteinerungen der sogenannten
Wellenfurchen, der Kriechspuren, der Fährten, der fossilen
Regentropfen, des rieselnden Wassers. Betrachten wir uns diese
auf den heutigen Tag uns erhalten gebliebenen Spuren und hören wir
die Erklärung an: "Wenn ein
niederes Tier auf dem frisch abgelagerten Meeresboden sich kriechend bewegt, so erzeugt es in
vielen Fällen auf ihm eine Kriechspur, die sich meist aus einer
kleinen Reihe von Eindrücken mit aufgetriebenen Rändern
zusammensetzt. Wird eine solche Spur fossil, so zeigt die obere
Seite der Schicht die von den Aufwulstungen umgebenen Vertiefungen als
solche, der Abdruck dagegen, also die Unterseite der höheren
Schicht, zeigt die Spur als erhabene Fläche und ihre Ränder
als vertieften Saum. Bilden die Kriechspuren dagegen nur flache
rillige Vertiefungen, so zeigt ihr Ausguß auf der unteren Seite
der folgenden Schicht Leisten mit rundlichem Querschnitt.
Fährten von Tieren sind vertieft in der Schicht, auf deren
Oberfläche sich die Tiere bewegt haben. Gesteinsplatten
also, auf welchen diese Fährten erhaben erscheinen, müssen
notwendig die Unterseite der nächstjüngeren Schicht
darstellen." Und in ähnlicher Weise, wie die
Kriechspuren entstanden sein sollen, nimmt die Geologie auch die
Entstehung der fossilen Regentropfen und des rieselnden Wassers
an. "Wenn eine eben dem Wasser
entstiegene Schicht dem Einfluß eines heftigen Regens ausgesetzt
ist, so bilden die einzelnen auffallenden Tropfen in der weichen Masse
flache, rundliche Vertiefungen, die vom Material der
nächstfolgenden Schicht wieder ausgefüllt werden. So
kann auch das rieselnde Wasser an der Oberfläche einer in Bildung
begriffenen Schicht eigentümliche Skulpturen erzeugen. Auch
die Wellenfurchen können sich auf diese Weise in flachem Wasser
bilden. Je nach dem Material und je nach der Stärke des
Wellenschlages werden die sogenannten Wellenfurchen, die sich besonders
schön im flachen Wasser bilden, bald breiter und schmäler
sein, und ebenso verschieden sind auch die Zwischenräume, in denen
sie aufeinander folgen. Diese Wellenfurchen (Ripplemarks) sind
auch aus älteren Formationen im fossilen Zustande bekannt, vor
allem in dem Rotliegenden und dem bunten Sandstein, und liefern in diesem Falle ein recht
brauchbares Kennzeichen zur Beurteilung der Schichten."
Haben wir diese geologischen Ansichten gehört, so müssen wir staunen über die Erklärung (WEL-Institut: diese Erklärung wird bis heute beibehalten).
Spuren, welche schon nach wenigen Stunden gewöhnlich verschwunden sind, sollen sich auf solche Weise durch Hunderte von Millionen Jahren erhalten haben. Diese Erklärung kann nur jemand glauben, der quietistisch (= aktualistisch) getrübten Blickes die Naturerscheinungen beobachtet, oder der früher ausgesprochene Ansichten nicht mehr widerrufen will. Betrachten wir uns einmal diese Art von Kriechspuren und fossilen Wellenfurchen, die fossilen Regentropfen in Wirklichkeit, schauen wir uns einmal die Abbildungen derartiger Funde in Dr. Keilhacks praktischer Geologie (1916) an (WEL-Institut: oder sonstigen aktuellen Büchern), so wissen wir auf den allerersten Blick, das sind ja Spuren in Eis. Wir erkennen sie sofort, und wir erinnern uns jener schneefreien Wintertage, wo nach einem ausgiebigen Regen plötzlich ein Frost eintritt und wo Straßen und Wege mit ihren vielartigen Spuren einen ganz ähnlichen Anblick bieten, wie ihn diese Abbildungen zeigen. Deutlich sehen wir, daß Eis bei der Entstehung dieser eigenartigen Versteinerungen ebenso die Hauptrolle gespielt hat, wie dies auch bei den anderen erhaltengebliebenen Versteinerungen der Fall sein wird.
Haben wir diese geologischen Ansichten gehört, so müssen wir staunen über die Erklärung (WEL-Institut: diese Erklärung wird bis heute beibehalten).
Spuren, welche schon nach wenigen Stunden gewöhnlich verschwunden sind, sollen sich auf solche Weise durch Hunderte von Millionen Jahren erhalten haben. Diese Erklärung kann nur jemand glauben, der quietistisch (= aktualistisch) getrübten Blickes die Naturerscheinungen beobachtet, oder der früher ausgesprochene Ansichten nicht mehr widerrufen will. Betrachten wir uns einmal diese Art von Kriechspuren und fossilen Wellenfurchen, die fossilen Regentropfen in Wirklichkeit, schauen wir uns einmal die Abbildungen derartiger Funde in Dr. Keilhacks praktischer Geologie (1916) an (WEL-Institut: oder sonstigen aktuellen Büchern), so wissen wir auf den allerersten Blick, das sind ja Spuren in Eis. Wir erkennen sie sofort, und wir erinnern uns jener schneefreien Wintertage, wo nach einem ausgiebigen Regen plötzlich ein Frost eintritt und wo Straßen und Wege mit ihren vielartigen Spuren einen ganz ähnlichen Anblick bieten, wie ihn diese Abbildungen zeigen. Deutlich sehen wir, daß Eis bei der Entstehung dieser eigenartigen Versteinerungen ebenso die Hauptrolle gespielt hat, wie dies auch bei den anderen erhaltengebliebenen Versteinerungen der Fall sein wird.
Aus den uns überlieferten
Versteinerungen ziehen wir unsere
Schlüsse in paläobiologischer Hinsicht. Die
Versteinerungen geben uns also einen Maßstab für das
relative Alter von Gebirgsschichten an verschiedenen Orten, sie
erlauben uns auch - nach der Ansicht der geologischen Lehrmeinung -
Schlüsse auf die Stammesentwicklung der einzelnen Tiergattungen zu
ziehen. Je nach den erfolgten Funden glaubt der Geologe
berechtigt zu sein, die Gleichzeitigkeit der Entstehung zweier
beliebiger Schichten nur durch
die Anwesenheit der gleichen Fossilien beweisen zu können.
Je nach dem Vorherrschen des einen oder andern Fossils werden so
Schichtenbenennungen vorgenommen. Als Voraussetzung gilt bei
dieser Art der Schichtenentstehung immer der Quietismus (= Aktualismus)
mit seinem allmählichen Fortschritt. Kehren wir uns jedoch,
wir haben ja schon zur Genüge bewiesen, daß derselbe nicht
haltbar ist, von dieser herrschenden Ansicht ab, dann fällt auch
das auf ihm errichtete Lehrgebäude in sich zusammen. Dann
fällt auch die von einzelnen Geologen der Welteislehre
vorgehaltene stammesgeschichtliche
Entwicklung des Vorderfußes der nordamerikanischen Pferde
in sich zusammen, denn wir können erwidern, daß es ohne
weiteres denkbar ist, daß diese Tiere in ihren verschiedenen
Entwicklungsstadien eben gleichzeitig gelebt haben, daß die
Entwicklung der Artenspaltung in der vortertiären alluvialen Zeit
erfolgte und daß die mit dem (Tertiär)Mondeinfang und
(Tertiär)Mondniederbruch einhergehende Katastrophe lediglich eine
Aussortierung vor dem Sterben mit sich brachte, eine Art von Selektion
im Darwinschen Sinne. Geben uns schon die Asyle und die hier in
Massen versammelten Landfaunen große Aussichten, die bisher noch
so unbekannten Gründe der Artenzerspaltung aufzudecken, so gibt
uns die Katastrophentheorie der Welteislehre die richtige Handhabe
für die unbekannten Gründe des Artentodes. Wie jeder
Biologe weiß, gibt es keine plötzliche, explosive
Entwicklung der Fauna und ebenso auch keine plötzliche, grundlose Vernichtung. Alles
erfolgt kontinuierlich. Die Natur macht keine Sprünge.
Alle die uns vorgebrachten Beobachtungen sind einfache
Täuschungen, welche darin ihre Ursache haben, daß die
Paläontologie, im Schlepptau der quietistischen (aktualistischen)
Geologie, die Katastrophen leugnen will. Alles ist
zwangsläufig durch den Kataklysmus bedingt. Es wird
während des Kataklysmus (= erdgeschichtliche Katastrophe) durch
den Kampf ums Dasein Anstoß zu den Artenbildungen gegeben, aber
die Ausbildung der Arten brauchte Zeit, und dazu reicht das Zeitalter
der Katastrophen nicht aus, dazu wird das alluviale Zeitalter der
ruhigen Entwicklung benötigt.
Es gibt gewiß Perioden in der Erdgeschichte, wo eine scheinbar rasche Umänderung der Lebewesen erfolgt. Dies kommt dadurch zum Ausdruck, daß es ganz große Tiergesellschaften gibt, welche miteinander auftreten und ebenso wieder verschwinden. Dies kann der quietistisch (aktualistisch) eingestellte Geologe nur so erklären, daß er dazu gewaltig lange Zeiträume verstreichen läßt, wobei er die sprunghaften Änderungen nie richtig erklären kann. Ganz anders kann hier die Welteislehre mit ihrer Erklärung eingreifen, denn sie rechnet nicht mit der langsamen, stetigen Entwicklung allein, sondern schaltet dazwischen gewaltige Katastrophen ein, die das ruhig schreitende Leben der Erde stören, ganze Stämme von Tieren, welche sich nicht retten können, vernichten, wobei die Individuen von den Flutwellen mit erfaßt und in die Ebbegebiete verdriftet werden, wo sie alsdann in eiszeitlicher Weise dauernd eingefrieren. Bei diesen Massentransporten aus den Rodungsgebieten spielt nun die Horizontalsortierung eine sehr große Rolle, welche ebenso wichtig ist wie die Widerstandsfähigkeit der einzelnen Arten selbst. Je nach der Schwere der einzelnen Arten, je nach der Widerstandsfähigkeit, mit welcher sie den Unbillen der Katastrophe entgegentreten können, je nach dem Instinkt der jeweiligen Tierart werden die Tiere auch von den Fluten erfaßt und zur Einbettung gezwungen werden. Deshalb darf es uns nicht verwundern, daß wir in den einzelnen übereinandergelagerten Schichten durch diese Art von Selektion, jeweils in einer gewissen Schicht, typische Formen finden, die uns ein gleichzeitiges Leben bezeichnen und die doch nur ein gleichzeitiges Sterben angeben. Denn schon die nächsten Flutwellen der nächsten Tage in dem gleichen Kataklysmus können andere, vielleicht widerstandsfähigere Arten einbetten, wobei die gestrige Art vollkommen fehlen kann. Es ist verfehlt, daraus schon den Schluß abzuleiten, daß die beiden Arten nicht zu gleicher Zeit gelebt haben. Sie hatten noch vor kurzer Zeit miteinander gelebt, waren aber an einander folgenden Tagen zugrunde gegangen. Betrachten wir von diesem Standpunkt aus die Lehre von den Leitfossilien, so sehen wir, daß sie uns eigentlich nichts Wesentliches in der Geschichte der absoluten geologischen Zeiten bieten kann, daß die Leitfossilien nur durch die Auslese entweder aus Horizontalsortierung oder durch die verschiedene Widerstandsfähigkeit der einzelnen Arten hervorgegangen sind. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, bietet das Problem des Artentodes keine größeren Schwierigkeiten mehr. Dort, wo die Theorien der alten Schule versagten, das plötzliche Erlöschen großer blühender Formengruppen ohne Hinterlassen von Nachkommen zu erklären, ist die Welteislehre in der Lage, eine wirklich plausible Deutung zu erbringen. So wird neues Licht in das Rätsel des scharfen Faunenwechsels an der Grenze der oberen Kreide gebracht, die Ursache des raschen Erlöschens der Ammoniten oder der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit, des Niederganges der Gigantostraca und der Trilobiten am Beginn des Devons, der Brachiopoden in der Trias getragen. Möge die Geologie und die in ihrem Gefolge befindliche Paläobiologie einmal diese Geheimnisse aufdecken und die wir hier erklären können.
Es gibt gewiß Perioden in der Erdgeschichte, wo eine scheinbar rasche Umänderung der Lebewesen erfolgt. Dies kommt dadurch zum Ausdruck, daß es ganz große Tiergesellschaften gibt, welche miteinander auftreten und ebenso wieder verschwinden. Dies kann der quietistisch (aktualistisch) eingestellte Geologe nur so erklären, daß er dazu gewaltig lange Zeiträume verstreichen läßt, wobei er die sprunghaften Änderungen nie richtig erklären kann. Ganz anders kann hier die Welteislehre mit ihrer Erklärung eingreifen, denn sie rechnet nicht mit der langsamen, stetigen Entwicklung allein, sondern schaltet dazwischen gewaltige Katastrophen ein, die das ruhig schreitende Leben der Erde stören, ganze Stämme von Tieren, welche sich nicht retten können, vernichten, wobei die Individuen von den Flutwellen mit erfaßt und in die Ebbegebiete verdriftet werden, wo sie alsdann in eiszeitlicher Weise dauernd eingefrieren. Bei diesen Massentransporten aus den Rodungsgebieten spielt nun die Horizontalsortierung eine sehr große Rolle, welche ebenso wichtig ist wie die Widerstandsfähigkeit der einzelnen Arten selbst. Je nach der Schwere der einzelnen Arten, je nach der Widerstandsfähigkeit, mit welcher sie den Unbillen der Katastrophe entgegentreten können, je nach dem Instinkt der jeweiligen Tierart werden die Tiere auch von den Fluten erfaßt und zur Einbettung gezwungen werden. Deshalb darf es uns nicht verwundern, daß wir in den einzelnen übereinandergelagerten Schichten durch diese Art von Selektion, jeweils in einer gewissen Schicht, typische Formen finden, die uns ein gleichzeitiges Leben bezeichnen und die doch nur ein gleichzeitiges Sterben angeben. Denn schon die nächsten Flutwellen der nächsten Tage in dem gleichen Kataklysmus können andere, vielleicht widerstandsfähigere Arten einbetten, wobei die gestrige Art vollkommen fehlen kann. Es ist verfehlt, daraus schon den Schluß abzuleiten, daß die beiden Arten nicht zu gleicher Zeit gelebt haben. Sie hatten noch vor kurzer Zeit miteinander gelebt, waren aber an einander folgenden Tagen zugrunde gegangen. Betrachten wir von diesem Standpunkt aus die Lehre von den Leitfossilien, so sehen wir, daß sie uns eigentlich nichts Wesentliches in der Geschichte der absoluten geologischen Zeiten bieten kann, daß die Leitfossilien nur durch die Auslese entweder aus Horizontalsortierung oder durch die verschiedene Widerstandsfähigkeit der einzelnen Arten hervorgegangen sind. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, bietet das Problem des Artentodes keine größeren Schwierigkeiten mehr. Dort, wo die Theorien der alten Schule versagten, das plötzliche Erlöschen großer blühender Formengruppen ohne Hinterlassen von Nachkommen zu erklären, ist die Welteislehre in der Lage, eine wirklich plausible Deutung zu erbringen. So wird neues Licht in das Rätsel des scharfen Faunenwechsels an der Grenze der oberen Kreide gebracht, die Ursache des raschen Erlöschens der Ammoniten oder der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit, des Niederganges der Gigantostraca und der Trilobiten am Beginn des Devons, der Brachiopoden in der Trias getragen. Möge die Geologie und die in ihrem Gefolge befindliche Paläobiologie einmal diese Geheimnisse aufdecken und die wir hier erklären können.
Kohlenlagerentstehung
Wir kehren nach dieser mit der
Sedimentierung einhergehenden Einbettung
der Lebewesen im Oszillationsgebiet wieder zur Sedimentierung
zurück, um auch hier der Besprechung der nutzbaren eingebetteten
Mineralien den Einwendungen, welche gegen die Welteislehre erhoben
wurden, zu begegnen. .... Immer wieder werden die gleichen
Einwände von geologischer Seite erhoben, und doch weiß jeder
Fachmann, der sich mit dieser Materie eingehend beschäftigt hat,
daß die Ansicht von der Autochthonie (= auf der selben Stelle
entstanden) der Kohlenflöze (s. auch: Entstehung der
Steinkohlenlager) im allgemeinen undenkbar ist. Sie
widerspricht in so vielen Erscheinungen den Theorien vom Waldmoor,
daß selbst auch Gegner der Welteislehre es für notwendig
erachten, daß die Lagerstättenlehre
dringend einer neuen Basis bedarf. Es ist nicht allein die innere
Beschaffenheit der Flöze, es ist auch die Tektonik, welche zu
direkten Widersprüchen herausfordert. .... Nun bezweifelt
man die Anschwemmungstheorie der Welteislehre und stützt seine
Meinung hauptsächlich auf die Auffindung der bewurzelten
Baumstämme, der Wurzelböden im allgemeinen und will diese
Beobachtungen gegen die Welteislehre zur Anwendung bringen. Mit
Unrecht, denn derartige aufrecht stehende Baumstämme können
von der Wald- und Torfmoortheorie überhaupt nicht erklärt
werden. Es ist doch vollkommen ausgeschlossen, daß sich ein
Waldmoor so rasch aufgebaut haben kann, daß der aufragende Stamm
während der ganzen Bildung ununterbrochen lotrecht aus dem in
Bildung befindlichen Flöz aufragte. Er mußte in der
Zwischenzeit doch vermodern, mußte abgebrochen werden, denn ein
in autochthonem Sinne gebildetes Flöz brauchte zu seiner
Entstehung sehr lange Zeiträume, erinnern wir uns doch, daß
ein hundertjähriger Buchenwald ein nur 2 cm mächtiges
Kohlenflöz gibt. Der autochthonen Theorie stehen
diese Zeiträume jedoch keineswegs zur Verfügung. Es ist
schon aus diesem Grunde verfehlt, gerade die so rätselhaften
lotrecht stehenden Baumstämme zugunsten der autochthonen Theorie
zu verwerten.
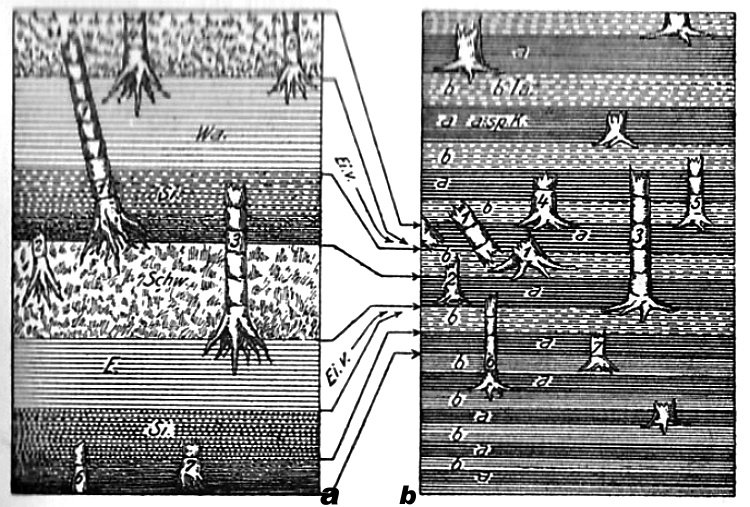
(Figurquelle/-text: Atlas "Eis
- ein
Weltenbaustoff", Dr. H. Voigt, 1928, R. Voigtländer Verlag,
Leipzig)
Fig. IV a:
Anfangszustand eines Kohlenlagers.
Eine Flutwelle der Eiszeit (3-500 mal so hoch wie die jetzigen) geschwängert mit Kies, Sand, Ton, zermahlenen Baumresten, Gras, Moos u. dergl., trat bei Ebbe zurück und ließ das mitgebrachte Material liegen, welches sich der Schwere nach absetzte. Das Wasser gefror, ehe es ganz ablaufen konnte. Eine zusammengehörige Schichtenfolge: Sinkstoffe, Wasser bezw. Eis und Schwimmstoffe entspricht also, jeweils eine Tageslieferung, weil zu jener Zeit die Flutwelle nur einmal am Tage nach Norden und Süden ausschlug. Baumreste konnten aufrecht schwimmend vom Wasser mit heran getragen werden, weil der große und schwere Wurzelstock dem leichten Stamm eines Bambus-, Schachtelhalm- oder Farnbaumes gegenüber einen genügend tief gelegenen Schwerpunkt darstellt.
Eine Flutwelle der Eiszeit (3-500 mal so hoch wie die jetzigen) geschwängert mit Kies, Sand, Ton, zermahlenen Baumresten, Gras, Moos u. dergl., trat bei Ebbe zurück und ließ das mitgebrachte Material liegen, welches sich der Schwere nach absetzte. Das Wasser gefror, ehe es ganz ablaufen konnte. Eine zusammengehörige Schichtenfolge: Sinkstoffe, Wasser bezw. Eis und Schwimmstoffe entspricht also, jeweils eine Tageslieferung, weil zu jener Zeit die Flutwelle nur einmal am Tage nach Norden und Süden ausschlug. Baumreste konnten aufrecht schwimmend vom Wasser mit heran getragen werden, weil der große und schwere Wurzelstock dem leichten Stamm eines Bambus-, Schachtelhalm- oder Farnbaumes gegenüber einen genügend tief gelegenen Schwerpunkt darstellt.
Fig.
IV b: Späterer Zustand
der Lagerstelle.
Jeder Tag führte eine neue Schichtenfolge heran, wodurch der Bau der auf einander folgenden Lagen höher und höher wurde. Das Gewicht der oben lagernden Massen übte auf die tiefer befindlichen einen Druck aus, der sich als Wärme äußerte. Diese Druckwärme brachte zunächst das eingeschlossene Eis zum Schmelzen, und danach preßte er auch das entstandene Schmelzwasser heraus. Auch die Schwimm- und Sinkstoffschichten verloren des Rest ihres Wassers und die Lagen setzten sich dichter zusammen, wobei sie durch den Druck noch zusammengepreßt wurden. Später trat größere Erhitzung ein, wodurch die Verkohlung der organischen Stoffe eingeleitet wurde. Die Baumstämme bohrten sich beim Zusammenpressen der Schichten durch diese hindurch; schräg stehende brachen ab.
Jeder Tag führte eine neue Schichtenfolge heran, wodurch der Bau der auf einander folgenden Lagen höher und höher wurde. Das Gewicht der oben lagernden Massen übte auf die tiefer befindlichen einen Druck aus, der sich als Wärme äußerte. Diese Druckwärme brachte zunächst das eingeschlossene Eis zum Schmelzen, und danach preßte er auch das entstandene Schmelzwasser heraus. Auch die Schwimm- und Sinkstoffschichten verloren des Rest ihres Wassers und die Lagen setzten sich dichter zusammen, wobei sie durch den Druck noch zusammengepreßt wurden. Später trat größere Erhitzung ein, wodurch die Verkohlung der organischen Stoffe eingeleitet wurde. Die Baumstämme bohrten sich beim Zusammenpressen der Schichten durch diese hindurch; schräg stehende brachen ab.
Nun wird eingewendet, daß
die Wurzelböden, die uns in den
einzelnen Kohlenrevieren begegnen, nicht durch die Fluttheorie der
Welteislehre gedeutet werden können. Unter diesen
Wurzelkronen gibt es solche von 8 m Spannweite, welche sehr weit
verzweigt sind. Die verhältnismäßig sehr leichte
Beschaffenheit der Stämme, welche zu diesen Wurzelstöcken
gehören, bewirkte bei der Flutverdriftung das Aufrechtstehen der Bäume.
So gelangten diese in die Ebbegebiete, wo sie anfangs noch aufrecht
schwimmend einfroren, wobei der Stamm selbst aus dem Wasser geragt
haben wird. Aufrechtstehende Stämme kommen vor, sie sind
jedoch keineswegs so in der Mehrzahl, wie dies ein Geologe
anführt, der ja auch zugeben muß, daß in
Ausnahmefällen ein Baum zur Karbonzeit auch senkrecht verschwemmt
werden kann. Im allgemeinen war dies ja nicht der Fall, denn die
Verfrachtung ganzer aufrecht stehender Bäume mit
Wurzelstöcken stellt immerhin doch einen Ausnahmefall vor.
Die Wurzelböden sind keineswegs ein Beweis gegen die Welteislehre,
auch dann nicht, wenn sie ohne Stämme im Flöz lagern, denn
dies hängt ja mit der Art und Weise der Rodung innig
zusammen.
Wir wollen uns diesen Vorgang einmal näher betrachten, um die eigenartige Lagerung der Flöze und besonders der Wurzelböden zu verstehen. Beginnt ein heranschleichender Flutberg einen Urwald zu bespülen, so wird er mit der Fällung der Bäume nicht sogleich beginnen; es wird zuerst das Unterholz geknickt, zerkleinert und schließlich verdriftet. Dann beginnen die schwächeren Bäume den Wasserfluten zu weichen, sie knicken am Erdboden ab, die Wurzeln bleiben jedoch noch immer im Waldboden. Der fortschreitende Flutberg setzt aber seine Rodungsarbeit weiter fort und knickt die mächtigsten Stämme, reißt auch aus dem aufgeweichten Waldboden einzelne Stämme mit ihren Wurzeln heraus, um sie zu entführen. Schließlich wird der ganze Waldboden aufgewühlt und bis auf den eventuellen felsigen Untergrund von den Wurzelstöcken und von dem Humusboden entblößt und hinweggeschafft. Die gleich bei Beginn der Rodung erfolgende Knickung der Stammtrümmer bewirkt eine horizontale Einbettung ohne Wurzeln, gleichzeitig damit wird das Geäst, das noch vorhandene Unterholz, die Zweige und Blätter eingebettet. Aus dieser Trübe, denn gleichzeitig wird auch Waldboden mit entführt, entsteht durch reinliche Scheidung bei der Vertikalsortierung jene feste strukturlose Masse, wie sie unsere Kohle meist darstellt. Die Wurzelstöcke, welche später zur Verdriftung kommen, werden infolge ihrer Beschaffenheit bei entsprechendem Längenverhältnis zur schließlich resultierenden Flözstärke mit den Wurzeln in die Sinkstoffschicht eingedrückt, so daß wir den Eindruck erhalten, als würde der Stamm in dieser Schicht Wurzeln gefaßt haben. Auch hier begegnen wir der Einwendung, daß die Wurzeln, die beobachtet werden, sehr feine Gliederung zeigen. Dies können wir dadurch leicht erklären, daß der gerodete Stamm mit einer großen Wurzelkrone, eventuell samt einem Teil Humusboden weggeschwemmt wird. Die Flutbergverdriftung auf den Gipfeln kilometerhoher Flutberge wird die Wurzeln nicht gänzlich vernichten, viele werden erhalten bleiben, erscheinen uns also heute als die vermeintlichen Wurzelausstrahlungen eines an Ort und Stelle gewachsenen Baumes. Gerade diese Erscheinung der aufrecht stehenden Bäume in den Flözen, welche unter Umständen auch durch mehrere Flöze hindurchragen können, strafen den Quietismus (Aktualismus) Lügen, denn hier liegt der unüberbrückbare Widerspruch mit den doch immer betonten langen Zeiträumen, während deren ein so aufrecht stehender Baum hätte erhalten bleiben müssen. Ein solcher Stamm, müßte ja durch Jahrtausende so aufrecht gestanden sein und müßte Fluten über sich haben ergehen lassen, ohne sich zu rühren. Darin liegt doch ein für das natürliche Denken ganz unfaßbarer Widerspruch.
Wir wollen uns diesen Vorgang einmal näher betrachten, um die eigenartige Lagerung der Flöze und besonders der Wurzelböden zu verstehen. Beginnt ein heranschleichender Flutberg einen Urwald zu bespülen, so wird er mit der Fällung der Bäume nicht sogleich beginnen; es wird zuerst das Unterholz geknickt, zerkleinert und schließlich verdriftet. Dann beginnen die schwächeren Bäume den Wasserfluten zu weichen, sie knicken am Erdboden ab, die Wurzeln bleiben jedoch noch immer im Waldboden. Der fortschreitende Flutberg setzt aber seine Rodungsarbeit weiter fort und knickt die mächtigsten Stämme, reißt auch aus dem aufgeweichten Waldboden einzelne Stämme mit ihren Wurzeln heraus, um sie zu entführen. Schließlich wird der ganze Waldboden aufgewühlt und bis auf den eventuellen felsigen Untergrund von den Wurzelstöcken und von dem Humusboden entblößt und hinweggeschafft. Die gleich bei Beginn der Rodung erfolgende Knickung der Stammtrümmer bewirkt eine horizontale Einbettung ohne Wurzeln, gleichzeitig damit wird das Geäst, das noch vorhandene Unterholz, die Zweige und Blätter eingebettet. Aus dieser Trübe, denn gleichzeitig wird auch Waldboden mit entführt, entsteht durch reinliche Scheidung bei der Vertikalsortierung jene feste strukturlose Masse, wie sie unsere Kohle meist darstellt. Die Wurzelstöcke, welche später zur Verdriftung kommen, werden infolge ihrer Beschaffenheit bei entsprechendem Längenverhältnis zur schließlich resultierenden Flözstärke mit den Wurzeln in die Sinkstoffschicht eingedrückt, so daß wir den Eindruck erhalten, als würde der Stamm in dieser Schicht Wurzeln gefaßt haben. Auch hier begegnen wir der Einwendung, daß die Wurzeln, die beobachtet werden, sehr feine Gliederung zeigen. Dies können wir dadurch leicht erklären, daß der gerodete Stamm mit einer großen Wurzelkrone, eventuell samt einem Teil Humusboden weggeschwemmt wird. Die Flutbergverdriftung auf den Gipfeln kilometerhoher Flutberge wird die Wurzeln nicht gänzlich vernichten, viele werden erhalten bleiben, erscheinen uns also heute als die vermeintlichen Wurzelausstrahlungen eines an Ort und Stelle gewachsenen Baumes. Gerade diese Erscheinung der aufrecht stehenden Bäume in den Flözen, welche unter Umständen auch durch mehrere Flöze hindurchragen können, strafen den Quietismus (Aktualismus) Lügen, denn hier liegt der unüberbrückbare Widerspruch mit den doch immer betonten langen Zeiträumen, während deren ein so aufrecht stehender Baum hätte erhalten bleiben müssen. Ein solcher Stamm, müßte ja durch Jahrtausende so aufrecht gestanden sein und müßte Fluten über sich haben ergehen lassen, ohne sich zu rühren. Darin liegt doch ein für das natürliche Denken ganz unfaßbarer Widerspruch.
Nun versucht man auch darin zu
widersprechen, daß man Kennzeichen
für die Wasserauspressung aus dem in Bildung befindlichen
Flöz fordert, wenn die Flöze im Eisberg eingebettet
waren. Wie leicht durchlässig die Steine im allgemeinen
sind, weiß jeder Techniker. Es bedarf dazu wahrlich keiner
besonderen Spalten und Gänge, denn die schon immer vorhandenen
feinsten Klüfte und Risse geben dem Wasser genügend
Gelegenheit zur Entweichung. Ja selbst das Urgestein, das wir
doch so kompakt glauben, bietet für das Wasser
Entweichungsmöglichkeiten genug. Ich verweise
diesbezüglich nur auf die Schwierigkeiten, mit denen die meisten
Talsperren beim Baum zu kämpfen haben und darauf, daß es
nach Fertigstellung mancher solcher Sperren noch immer
Wasserdurchbrüche gibt, obwohl hier das Wasser niemals unter jenem
urgewaltigen Gebirgsdruck stehen wird, wie in einem durch Pressung
schmelzenden Eisberg. Bei den Talsperren kommen vielleicht 1-4
Atmosphären, im schmelzenden Eisberge aber eventuell mehrere
Hunderte von Atmosphären in Betracht. Derselbe Grund zwingt
uns ja auch zu der Annahme, daß das Meer ständig Wasser an
den inneren Haushalt der Erde abgibt, daß auf diese Weise der Erdenvorrat an
Wasser verringert wird und es kosmischen Nachschubs dringend
bedarf. Obwohl diese Ansicht gerne bestritten wird, sprechen dafür
alle Erwägungen, und es gibt unter den Vulkanforschern und
Erdbebenfachleuten Anhänger genügend, welche dieser Meinung
ebenso beistimmen. Daß im Erdinnern schon vollkommenes
Gleichgewicht hinsichtlich des Wasserhaushalts der Erde herrschen
muß, ist ja doch eine ganz willkürliche Annahme, denn sie
ist einfach nicht wahr, wie selbst schon viele Bergleute beweisen
können... Es gibt auch in größeren Tiefen
noch sehr trocken anstehende Gesteine, wechsellagernd mit feuchten und
oft überlagert von schwimmendem Gebirge. Diese Trennung ist
oft nur durch schwache wasserundurchlässige Schichten
bedingt. Reißt durch irgendeine Gewalt, durch ein Erdbeben
oder durch sekundären Gebirgsdruck eine solche Schicht, so findet
dann der Ausgleich des Wassers statt, und das Wasser strebt zur
Tiefe. Daß in sehr großen Tiefen keine Hohlräume
mehr vorhanden sind, ist ja auch nur eine theoretische Erwägung,
jedenfalls gibt es aber in 1500 m Tiefe solche Hohlräume noch zur
Genüge. Das Wasser spielt im Erdinnern zweifellos eine
große Rolle, bestimmt aber im vulkanischen
Kräftehaushalt. Davon kann uns jeder Vulkanausbruch
überzeugen, denn mit diesen kommt das Wasser als Wasserdampf
wieder an die Oberfläche oder als Wasserstoff, welcher in
große atmosphärischen Höhen entweicht. Dieses
Wasser entstammt aber bestimmt den Tiefen der Erde, ob es nun vorher
als Oberflächenwasser eingedrungen ist oder aber als juveniles
Wasser dort schon vorhanden war. Im Erdinnern sind die Elemente
des Wassers bestimmt vorhanden, und wir wissen auch, daß sie dort
große Reaktionen eingehen können. Wirkt doch schon
Wasserdampf bei 1000 Grad Wärme wie eine sehr starke Säure,
die sogar die SiO2 (Kieselsäure) austreiben
kann. Wenn wir alle diese Ansichten kennen, dann wundert es uns
nicht, wenn das Wasser des Eisberges entweder durch Spalten, durch
Risse, durch feinste, heute kaum erkennbare Poren im Laufe der langen,
langen Zeiträume vollkommen entschwunden ist. .... Verschiedene
Theorien nehmen an, daß Kaolin nur bei Anwesenheit von Braunkohle
entstehen kann, und zwar auf diese Weise, daß die Abwässer,
wahrscheinlich mit den Humussäuren aus der Braunkohle
geschwängert, das Liegendgestein, hier Granit gedacht, zu der
Kaolinisierung veranlaßt haben (WEL-Institut:
das Endprodukt ist
als "Fireclay" bekannt). Gerade hier sehen wir deutlich
jene
Spalten, welche man im Liegenden zur Auspressung der Eisbergwässer
fordert. Sollen die Säuren aus der Braunkohle in der Lage
sein, festen Granit auf 10-20 m Höhe zu verändern, so weist
dies auf eine ganz starke Flözentwässerung hin.
Ganz eigenartig mutet uns auch
jene Einwendung an, wenn man die
gewaltigen Mächtigkeiten der (Flöz)Schichten im Ausmaße
von 3-400 m gegen die Welteislehre heranzieht, denn hier liegt doch
nicht zum geringsten der wunde Punkt der Torf- und Moortheorie.
Solche mächtige Bildungen, besonders wenn wir dabei bedenken,
daß während der Bildungszeit Faltungen, Überschiebungen
und Überkippungen gleichzeitig einhergehen, können wir wohl
mit den Anschauungen der Welteislehre erklären, wir können
sie aber niemals autochthon denken, denn daß sich irgend in einem
kleinen Teile, in einem abgelegenem Revier ausgerechnet ein kleiner
Stöpsel der Erdkruste wunschgemäß in hundertfacher
Wiederholung gesenkt und wieder gehoben haben soll, um so gewaltigen
Schichtenbau zu ermöglichen, ist
doch noch viel unfaßbarer. So kommen wir dem
Rätsel der Kohlenentstehung nicht bei. Selbst die
stärkeren, heute als bauwürdig bezeichneten Flöze
spielen hier keine so große Rolle, wie die kleinsten
Flözchen und die feinsten Zwischenlagen. Nach der
Waldmoortheorie müßten wir in diesen feinsten Zwischenlagen,
welche dem sich aufbauenden Moor als Wurzelboden gedient haben
müssen, doch Spuren dieser
Würzelchen vorfinden. Dies gelingt aber nicht. Die
Beschaffenheit der Zwischenlagerungen weist vielmehr meistens darauf
hin, daß wir es hier mit vollkommener Schichtentrennung zu tun
haben, daß sich das eine nicht aus dem andern ableiten
läßt. Auch wenn wir das Waldmoor, was übrigens zu
bezweifeln ist, noch so fest denken, eine Überschwemmung desselben
kann sich nicht in vollkommen ebenen Schichten ausgewirkt haben.
Solche Überschwemmungen würden wir heute bestimmt noch als
solche wiedererkennen. Es ist hier leider nicht der Raum, auf die
vielen, speziell die Entstehung der Kohlen betreffenden Einwirkungen
näher einzugehen.... Die Kohlengeologie ist es ja vornehmlich
gewesen, welche die Anhängerschaft der Welteislehre
hauptsächlich unter den Bergingenieuren so bedeutend vermehrt hat.
Und so wie wir für die Entstehung der Kohlen eine neue Fundierung benötigen, so verlangt auch die Frage der Entstehung des Steinsalzes und seiner Begleiter sowie die des Erdöls eine gründliche Nachprüfung. Als ein einstmaliger Schüler des international berühmten, kürzlich (Mitte der 20iger Jahre des 20. Jahrhunderts) verstorbenen großen Erdölgeologen Hans von Höfer will ich nur die Ansicht dieses Gelehrten vertreten, der sich die Entstehung des Erdöls nur durch eine Katastrophe in der Fauna erklärte. Wenn er auch seinerzeit von den Ansichten der Welteislehre nichts wußte, die Ursachen dieser Katastrophen daher woanders gesucht hat, die Begleiterscheinungen des Erdöls hatten ihm aber den richtigen Weg gewiesen: "Ohne kataklysmatisches Tiersterben kann es kein Erdöl geben."
Und so wie wir für die Entstehung der Kohlen eine neue Fundierung benötigen, so verlangt auch die Frage der Entstehung des Steinsalzes und seiner Begleiter sowie die des Erdöls eine gründliche Nachprüfung. Als ein einstmaliger Schüler des international berühmten, kürzlich (Mitte der 20iger Jahre des 20. Jahrhunderts) verstorbenen großen Erdölgeologen Hans von Höfer will ich nur die Ansicht dieses Gelehrten vertreten, der sich die Entstehung des Erdöls nur durch eine Katastrophe in der Fauna erklärte. Wenn er auch seinerzeit von den Ansichten der Welteislehre nichts wußte, die Ursachen dieser Katastrophen daher woanders gesucht hat, die Begleiterscheinungen des Erdöls hatten ihm aber den richtigen Weg gewiesen: "Ohne kataklysmatisches Tiersterben kann es kein Erdöl geben."
Es ist leider undenkbar,
einzeln auf (womöglich) weitere
Einwendungen noch näher einzugehen, von denen eine große
Anzahl lediglich auf mangelhafte Kenntnis der Welteislehre
zurückzuführen sind. Die oben angeführten
Tatsachen haben jedoch schon zur Genüge bewiesen, daß die
heutigen Ansichten der Geologie, soweit sie den Aufbau der Schichten,
der nutzbaren Lagerstätten der Gebirge und sonstigen Erdformen
betreffen, auf einem vollkommen falschen Fundament aufgebaut sind (WEL-Institut: dies bis in unsere
gegenwärtige Zeit), denn sie fußen alle auf den
Hypothesen von Kant-Laplace, welche als unmöglich erkannt worden
sind, und sie fußen ferner noch auf der aus diesen Hypothesen
hervorgehenden Kontraktionstheorie oder ihren Modifikationen (WEL-Institut: Plattentektonik-Theorie),
deren Unhaltbarkeit wie hier zur Genüge dargetan haben.
.... Hat sich erst einmal die Geologie auf diese neue Plattform
(der Welteislehre) gestellt und werden von dieser aus all die vielen
schon geleisteten Kleinarbeiten gedeutet, so wird sich alsbald der
über noch vielen Erscheinungen schwebende Schleier lüften und
die verborgenen Schätze der Natur werden uns zwangsläufig
zugute kommen, zum Ruhm der Wissenschaft, zum Fortschritt der
angewandten Technik und zum Segen der Kultur der aufstrebenden
Menschheit.
Berginspektor Dr. Ing. Fritz Plasche
(Quelle: Monatsheft "Schlüssel zum Weltgeschehen", Heft 4, S. 221-248, Jahrg. 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)